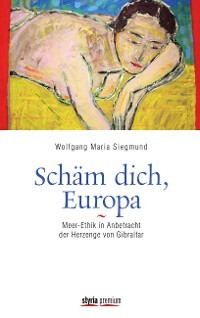Czytaj książkę: «Schäm dich, Europa!»
Wolfgang Maria Siegmund
Schäm dich,
Europa
~
Meer-Ethik in Anbetracht
der „Herzenge“ von Gibraltar

Veröffentlicht mit Unterstützung des Forschungsrates der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt.
IMPRESSUM
ISBN 9783990401927

© 2013 by Styria premium
in der Verlagsgruppe Styria GmbH & Co KG
Wien · Graz · Klagenfurt
Bücher aus der Verlagsgruppe Styria gibt es in jeder Buchhandlung und im Online-Shop
Covergestaltung: Bruno Wegscheider
Coverbild: Linda von Alten, Acrylcollage auf Leinwand, 100x100 cm
Buchgestaltung: Anna Caterina Wegscheider
1.digitale Auflage: Zeilenwert GmbH 2014
Für meinen Vater, der mir schon früh das ver-MITTEL-nde MEER gezeigt hat
INHALT
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Vorwort
1. Stapellauf oder „Auf die Schiffe, ihr Philosophen!“
1.1 Was im Grunde nicht hierher gehört – aber dennoch meinen Schreibgrund ausmacht
1.2 Die zweite Untiefe
1.3 Neben Oliven & Landwein sind in diesem Falle die Fragen der wichtigste Proviant
2. Bordnotizen zu den Biografien meiner SchiffsbeSatzung
2.1 Zu Monsieur Emmanuel Lévinas oder Die Unendlichkeit ist mitten unter uns
2.2 Vom maghrebinischen Derrida, dem ganz Anderen vom gegenüberliegenden Kap
2.3 Zu Giorgio Agamben und seiner Ethik im Namen aller Namenlosen
3. Die erste Enttäuschung oder Verwende deinen eigenen Verstand!
3.1 Funken-Sprüche vom Festland: Unruhen in den Vororten von Paris!
3.2 Die Mudras der Goldenen Drei
4. Erster Tauchgang oder Der Gründungssatz der Ethik fiel erst in der allerletzten Runde
4.1 Zweite Tauchfahrt oder 152 Millionen Kilometer über der Welt
4.2 In der Philosophie ging erstmals das Licht an, als jene Sonnenfinsternis über sie kam oder Wie sich das Abendland im Morgenland erfand
4.3 Eine Ethik vom Gehen und vom Begreifen
4.4 Wenn Landzungen philosophieren
4.5 Indem die Landschaft das Böse speichert, erzählt sie uns vom Guten
5. Die Fahrt ins Epizentrum einer ethischen Aporie
5.1 Heimfahrt oder Immer an Ithaka vorbei
5.2 Reise in etwas, was es nie gab
5.3 Weil jede Flüchtlingsspur ins Eigene führt
6. Die vier Masten einer mittelmeerischen Ethik, wenn wir nicht wollen, dass der Mensch an uns vorübergeht
7. Der gelungene Morgen am Ende einer philosophischen Nacht
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Verzeichnis der Abbildungen
Bildnachweis
Vieles, woraus der Westen berechtigt seinen Stolz bezieht, seine frühen Erkenntnisse in Wissenschaft, Philosophie und Kunst – und damit die Ursprünge seines Wertesystems – hat er den Bewohnern beiderseits des Mittelmeeres zu verdanken. Unter dieser gemeinsamen Sonne, für Platon das sichtbare Symbol für das Gute, wurden die Schrift, die Zahl, das Geld erfunden. Ja, die ersten Meister der Philosophie lebten und lehrten allesamt in der heutigen Türkei. Es ist arabischen Übersetzern zu verdanken, wenn wir heute die Schriften des Aristoteles in Form von günstigen Reclambüchern in Händen halten; der Bewässerungskunst der Mauren, wenn wir abends in Tomaten beißen, deren Haut nach Südspaniens Neusklaven schmeckt (ein Fortschritt, dessen Nichteintritt leicht zu verschmerzen wäre). Und ganz ohne den Auftritt des jüdischen Lennons der Levante hinge in unseren Schulen noch immer das Porträt vom Goldenen Kalb. Doch den Anfang unseres Begreifens provozierte die glitzernde Weite dieses Meeres, das uns alle das Staunen lehrte, gemeinsam fragend in dieser Welt zu stehen.
Umso beschämender der Umstand, wie sich Europa, nach Erhalt all dieser Gaben, mit einer Mauer der Abwehr vor seinen südlichen Ideenspendern, seinen Nachbarn verschließt. Das Abendland nimmt es somit in Kauf, die lebenserhaltende Blutbahn des Kreativen zu kappen, die „Herzenge“ von Gibraltar noch weiter zu schließen. Die sokratisch-ethische Präambel, „es sei besser, Unrecht zu erleiden, als Unrecht zu tun“, wird der endgültigen Austrocknung überlassen, ja auf den Kopf gestellt. Die Abwehr des Anderen läuft im Moment auf höchsten Touren, aber somit auch die moralische Gefahr für den Westen, im Schatten der untergehenden Sonne die eigenen Werte gleich mit zu begraben.
Davor hat schon vor Jahren Albert Camus, selbst ein Bewohner der anderen Meeresseite, in seiner radikal humanistischen Schrift über das „mittelmeerische Denken“ gewarnt, vor dieser neuen Verrohung Europas. Ohne den notwendigen Austausch von Licht und Schatten, des Eigenen mit dem Andern und dabei immer Nemesis, die Göttin des Maßes im Blickpunkt, käme eine ethische Verwüstung auf uns zu. Diese Gedankenspur nimmt der Verfasser dieses Pamphlets, mehr Literat als Philosoph, noch einmal auf. Neben Camus lädt er drei weitere große Denker der Ethik auf sein fiktives Schiff: Jacques Derrida, geboren am „anderen Kap“, Emmanuel Lévinas, der wohl radikalste Ethiker unserer Tage, und Giorgio Agamben, sie alle kommen mit an Bord für diese Zeitreise zu den Anfängen des Abendlandes, als das Gute seine erste Setzung hier empfing. Dabei schrammt ihr Schiff auch die Gegenwart. An westlichen Verbannungsinseln, für das Böse bis hinauf in unsere Tage geöffnet, zieht es vorbei. Alle vier Denker halten ein Puzzle einer Meeresethik in der Hand, doch dann … Und dazu taucht noch ein Familienrätsel auf, eine Sache, worüber der eigene Großvater nie sprach …
Das Buch wurde nicht für den alles wissenden Philosophen geschrieben, sondern für den interessierten Laien, der neben ernsten Fakten den Mix aus Literatur, Philosophie und Reisebericht nicht scheut. Doch auch hier werden dem Zorn, den ein Pamphlet einfach braucht, zum Ausgleich die Selbstironie und das Augenzwinkern als Maß zur Seite gestellt.
Alle nichtkursiven Dialoge der philosophischen Bordbesatzung sowie die Figur Stane entspringen der Fantasie des Verfassers.
I.
STAPELLAUF ODER „AUF DIE SCHIFFE, IHR PHILOSOPHEN!“

Abb. 1
„(…) eine neue Gerechtigkeit tut not! Und eine neue Losung! Und neue Philosophen! Auch die moralische Erde ist rund! Auch die moralische Erde hat ihre Antipoden! Auch die Antipoden haben ihr Recht des Daseins. Es gibt noch eine andere Welt zu entdecken – und mehr als eine! Auf die Schiffe, ihr Philosophen!“1
Auch wenn der Verfasser dieser Arbeit – mehr Literat als Philosoph – sogleich dem Aufruf Nietzsches folgen möchte, so sei man nicht enttäuscht: Es werden bestenfalls Papierschiffe sein, Dreimaster aus zerkauten Bleistiftenden, die mit ihm auslaufen, um danach über selbst entworfene Karten zu kreuzen, über Skizzen und Entwürfe der nautischen, der geophilosophischen Unmöglichkeit. Es erwartet uns keine Reise in den vergnüglichen Kreis der Sonne, denn manche dieser Tiefen, auf die wir stoßen, entstammen keiner natürlichen geologischen Gegebenheit, sie wurden und werden vom Westen eigenhändig geschürft. Im besagten Fall handelt es sich um einen Riss in der inzwischen gnadenlos gewordenen Vernunft Europas, ja um einen gewaltig und täglich wachsenden Trenngraben zwischen Nord und Süd, es handelt sich um einen moralischen Abgrund, der an seiner engsten Stelle 14 Kilometer Breite misst.

Abb. 2
An dieser Stelle überlässt Europa die Schmutzarbeit einem Meer, mittels Tiefe, Kälte und Wellengewalt, das menschliche Strandgut aus Afrika verschwinden zu lassen. Und der aufgeklärte Kontinent sieht vom Festland zu … Gegen diese „Herz-Enge“ von Gibraltar, wie ich diese Passage hier bezeichnen möchte, wird also meine kleine Flotte anzusegeln haben, denn eine neue Gerechtigkeit, wie Nietzsche meint, tut in diesem Falle mehr als not.
Und der Verfasser bittet schon in dieser Einleitung um Nachsicht. Was die strenge, reine Philosophenlehre betrifft – er wird sich aus dem Werkzeugkasten der poetischen Philosophie zu bedienen wissen. Eine hybride Textgestalt sei damit gemeint, die stets auch aus dem Nebelhaften, Undeutlichen ihre Konturen bezieht. Poetische Philosophie gedacht als Bastard, als Mischling, die gerade wegen ihrer unreinen Andersheit sich nicht abhalten lässt, das Große anzukläffen, hin und her strolcht zwischen beiden Lagern, je nach Laune. Denn der fast unleserliche Auftragsschein, weshalb wir hier sind, trägt nach wie vor keine Unterschrift, lässt jede Deutung offen …
I.I Was im Grunde nicht hierher gehört – aber dennoch meinen Schreibgrund ausmacht
Meine zwei Meeresgründe, die mich zu dieser Arbeit führten, sind naiv, folkloristisch und reichen fast dreißig Jahre zurück. Man musste nur strahlend jung sein, keine 26 Jahre, einen olivgrünen Rucksack sein Eigen nennen, mit einer Schlafmatte obenauf, und schon war man Besitzer eines Interrailtickets, das einen, wie in meinem Falle, vom hintersten südsteirischen Dorf bis nach Fes kutschierte, für sehr wenig Geld. Einmal Afrika retour. Ich weiß noch, es war hellster Tag, als ich in Algeciras das Fährschiff nahm, doch mit jeder Meile wurde es scheinbar oder tatsächlich dunkler um mich. Tiefblaue Finsternis. Noch heute bin ich gegen jede Wahrheit der Uhr überzeugt, Tanger, das sagenhafte „sündig-morbidelibertäre“ Tanger bei tiefster Nacht vom Meer aus erstmals erblickt zu haben. Vor mir das pulsierende, von einem unbekannten Rhythmus gesteuerte Aufzucken der Lichter, von Saiteninstrumenten begleitet, von denen nichts in unseren Musikbüchern stand. Ich meinte, ganz Afrika in diesem Moment authentisch zu spüren, zu hören. Eine irritierende Energie floss in meinen weiß-müden europäischen Bauch. Damals kam es mir nicht verwunderlich vor, dass die Stadt und ihre Bewohner vor meinen Augen denselben Auftritt hatten, so exotisch, urban und wild, wie ich über sie zu Hause gelesen hatte, zwischen sanften Weingärten, rabiaten Traktoren und alten Männern in ihren Gummistiefeln. Ich wusste nicht, dass ein festgelegtes, starres Bild vom Anderen mit mir auf Reisen ging. Mit allen Vorurteilen, mit allen Klischees.
Ich sah, was ich gelesen hatte, ich war nicht imstande, mir die fremden Buchstaben aus den Augen zu reiben, um selber zu sehen. Und mit jedem Näherkommen kochten die Gerüchte an Deck. Harmlose Jungs aus Düsseldorf kramten auf einmal riesige Bowiemesser aus ihrer Armytasche hervor, andere meinten, ohne ihre tragbaren Wasserfilteranlagen gingen sie niemals von Bord, denn im Ostteil der Stadt, da stechen sie dich ab, während sie dich im Westteil bloß vergiften. Wir waren strahlend jung, keine 26 und hatten von „post-colonial-studies“ noch nichts gehört. Scheu, wie ausgesetzte Katzen, die in einem Käfig voller Wölfe ihren Nachtplatz zu suchen hätten, tappten wir durch das nachtgrelle oder tagdunkle Weiß der Häuserstraßen, vorneweg ein zentnerschwerer Judoka mit Vaters Leuchtgaspistole im Sack.
Als wir uns am nächsten Morgen wieder trafen, wir, die wir mit unseren olivgrünen Rucksäcken aus ganz Europa kamen, waren wir mehr als erstaunt, dass keiner fehlte, jeder die Nacht überlebt hatte, nichts geschehen war. Im Gegenteil, unsere Hotels waren sauber und günstig, die anderen Menschen überraschend nett. Tage später, wieder am anderen Kap, in der sicheren Nestwärme Europas … Ganz friedlich schlief jeder von uns in den Ecken der Bahnhofshalle von Lissabon ein. Als wir uns am nächsten Morgen an den Schaltern trafen, waren wir mehr als erstaunt, die Hälfte von uns hatte man ausgeraubt, mit Messern bedroht, ein Dutzend Rucksäcke fehlten. „Und was das Irritierendste daran ist“, meinte der zentnerschwere Judoka mit der Leuchtgaspistole, „diese verdammten Hunde waren alle so weiß wie wir …“
I.2 Die zweite Untiefe
Als ich in den Monaten darauf meine ersten Gedichte zu schreiben begann und mich wie die meisten bei der Wahl: Sartre oder Camus für den letztgenannten entschied, las ich in Der Mensch in der Revolte erstmals jenen Begriff, der mich in den nächsten Jahren nie mehr loslassen sollte:
Das Mittelmeerische Denken. Damals wusste ich nicht, was damit gemeint war, jenes Maßhalten, jener Ausgleich von Schatten und Licht. Dennoch bergen diese drei Wörter alles in sich, was ich damals wollte: Schreiben am Meer, leben am Meer. Eine freie Schriftstellerexistenz führen unter der prallsten Sonne. Am besten in Tanger oder notfalls in Tipasa. Auf die Schiffe! Mittelmeerisches Denken: Das war jährlich auf den Kykladen vor Tavernen sitzen, im pissoirgrünen und natürlich kragenlosen Hemd aus dem steif gebügelten Besitz der Großväterschaft, das war mit Renaissancebüchern aus dem Verlag Wagenbach durch südlich verlassene Kirchen streifen, auf der Suche nach einem noch unentdeckten Piero della Francesca, das war ein Leben ohne jeden Riss, ohne jeden Schatten und mit Texten, die man sich aus dem geliebten Meer erbeutet.
Viele Jahre später nahm ich das Buch aus reiner Nostalgie wieder zur Hand, blätterte zurück zur besagten Stelle: Und plötzlich umgab mich diese taghelle Dunkelheit, wie damals in Tanger. Unter der besagten Überschrift meiner damaligen Sehnsucht las ich nun Camus’ überaus leidenschaftliche, schmerzvolle Abrechnung mit Europa, seine Warnung an die westliche Demokratie, nicht ins Diktatorische, Totalitäre abzugleiten. Er sprach von dem, was nach der Sonne kommt, er sprach von ihrem Rücken aus, er redete von dem, worauf sie nicht fiel. Er sprach von Folterkammern in den Kellern der Demokratie, von Schreibern, die zu all dem schwiegen, und das beunruhigende Gefühl umgab mich: Er redete auch von mir. Von einem, der monatlich die deutschsprachige Ausgabe von Le Monde ins Haus bekam und donnerstags Die Zeit, damit die Zeit verginge, gleich wie der frühe Zorn, denn auch der war längst in mir verflossen.
Doch diese Wieder-Lektüre war ein Schlag in mein Schamgefühl, die Seiten drückten mich tief in mein auf Eis gelegtes Dagegensein. Ich hatte also in all den Jahren den Text nicht verstanden. Ich vernahm nur die gleißende Überschrift, das mittelmeerische Denken, jene drei Sehnsuchtswörter, alles Übrige hatte ich ausgeblendet. Gleich wie Meursault, der Held in Der Fremde, der seine Menschlichkeit nicht mehr erkannte, weil ihm am Strand die Sonne dazwischenkam, hatte auch ich nichts gesehen. Und es war wie damals am Fährschiff nach Tanger, wo ich mit jugendlicher Unbekümmertheit über ein kommendes Grab spazieren fuhr. (Die Dunkelziffer spricht bereits von weit mehr als 15 000 toten Migranten.) Nur dieses Mal sah ich nicht etwas vor mir, was ich gelesen hatte, sondern las etwas, was ich in all den Jahren in diesem weiten Blau nicht gesehen hatte: die Rückseite des Meeres, die Nachtmeerfahrt, die Katabasis, den Moment, wo der Mittag des Menschseins mit einem Handstreich erlischt.2 Camus’ textliche Wunde aus dem Jahre 1951 zog sich in schwarzen Lettern über das Blatt, ja seine dunkle Prophetie riss in mir die Fragen der Fragen auf …
I.3 Neben Oliven & Landwein sind in diesem Falle die Fragen der wichtigste Proviant
Was ist also nur mit diesem Meer geschehen, diesem „Meer-Denken“, dem wir Europäer alles zu verdanken haben, die Schrift, die Zahl, Logos und Mythos? Das alte Schmelzwasserbecken, das stets gefüllt war mit jüdischen, christlichen, islamischen Tropfen, dieser Vermittler inmitten aller nur denkbaren Gegensätze ist plötzlich zu einem ständig überwachten Grenzort geschrumpft. Gibt es für diesen noch immer schönen verwitterten Umschlagplatz der Ideenkreuzung eine dritte Renaissance? Eine neue Gerechtigkeit, eine neue Ethik, einen moralischen Entwurf, der nicht mit seinem Anspruch universeller Umarmung abermals die Schwächsten erdrückt? Ergibt dieser westliche Werte-Hegemonialismus noch Sinn, wenn in seinem Namen unentwegt neue, vermeintlich gerechte Kriege entstehen? Kann nicht irgendwann eine Ethik im Kommen sein, die sich bewegt, die mit Außenbürgern Fuß an Fuß, Hand in Hand flüchtet, läuft, die sich nicht fortstiehlt, sondern bei ihm, beim Letzten bleibt? Ist eine „transportable Ethik“, wie sie der Verfasser hier nennen möchte, denkbar?

Abb. 3
Die Zeit drängt, auf die Schiffe, ihr Philosophen. Ich werde in diesem Fall nur Berichterstatter sein, ein Leichtmatrose am Deck der „Neuen Gerechtigkeit“. Es wäre verrückt und zugleich vermessen, ginge ich bei dieser waghalsigen Mission alleine an Bord. Und da die Namen auf den Büchern ohnehin sich stets auf Reisen befinden, in unseren Taschen, Koffern, Citybags, fällt es mir nicht allzu schwer, eine Anzahl von radikal erlesenen Denkfiguren an Bord zu holen, sie virtuell an Deck zu bitten. Bedingung ist nur: Es müssen radikale Denker der Ethik sein, Überdenker der anderen Seite, des Ausgegrenzten, also auch vom algerischen Ufer. Deshalb bitte ich natürlich Albert Camus an Bord.
Nun zum nächsten Gast und Missionsbegleiter: Jacques Derrida. Hier gibt es einiges, was die beiden pieds noirs vereint, wie die großen Franzosen ihre „Kleinen von drüben“ abwertend zu nennen pflegten. Das reicht weit über Kindheitserinnerungen hinaus, wie die gemeinsame frühe Liebe zum Fußballspiel auf den rotkargen Plätzen von Algier. Es war überraschend für mich, auf keine einzige namhafte Untersuchung gestoßen zu sein, die sich mit der Ähnlichkeit dieser zwei Anderen befasst. Denn sie beide kannten nur allzu gut die schmerzhafte koloniale Überfahrt von Algier nach Marseille. Auf dieser Schreibfahrt wird also vom maghrebinischen Derrida die Rede sein, von jenem Mann vom anderen Kap.
Doch was wäre eine Mittelmeerfahrt ohne einen echten Rabbi vom östlichen Ende des Gestades, einem Gelehrten, der zwar rein körperlich in Frankreich lebte, aber was sagt das schon … Sein Werk birgt die wohl radikalste Ethik der postmodernen Zeit. Sein Hauptwerk Totalität und Unendlichkeit lässt er mit einem äußerst mysteriösen Satz beginnen, den ich in meinem Logbuch untersuchen werde: „Das wahre Leben ist abwesend. Aber wir sind auf der Welt.“ Emmanuel Lévinas, der Doyen des anderen Denkens, den zeitlebens eine tiefe Freundschaft mit Derrida verband.
In Rom schließlich holt sich das Schiff noch einen weiteren Passagier an Bord. Giorgio Agamben. Dunkelpoetisch spricht er die vernichtendste Kritik über das jetzige Europa aus. Doch auch er verfügt über einen Plan, dem Desaster zu entrinnen.
Dieses Aufeinandertreffen der Genannten ist nicht dem Zufall geschuldet, jeder der vier Männer hält ein wichtiges Puzzleteil bereit, für das Ausströmen, In-Bewegung-Setzen einer Mittelmeerischen Ethik, die sich im Gleichklang mit der Aristotelischen Handlungsethik für die „Untersten“ dynamisiert.
Für die Besatzung gilt, und da steht sie im Widerspruch zu Nietzsche, dass sie nicht schon wieder eine andere Welt entdecken will, sondern im Gegenteil, sie will dem frierenden Anderen dieser blank gelegten Welt eine ethische Decke reichen, jenem Antipoden, der unverschuldet auf der unteren Seite der Welt zu stehen hat.
2.
BORDNOTIZEN ZU DEN BIOGRAFIEN MEINER SCHIFFSBESATZUNG
2.I Zu Monsieur Emmanuel Lévinas oder Die Unendlichkeit ist mitten unter uns

Abb. 4
Müsste man das philosophische Werk von Emmanuel Lévinas mit wenigen Worten beschreiben, könnte ein Satz von Robert Musil hilfreich sein: „Die Reise an den Rand der Möglichkeit.“ Monsieur Lévinas würde in sanfter Rabbimanier dazu nicken und dabei eine kleine Korrektur vornehmen, die sein Werk so wundervoll schwer in seiner Leichtigkeit macht. Er würde sagen: „Reise an den Rand der Möglichkeit, ja, und danach wage die Reise darüber hinaus …“ Er hätte damit in keinster Weise übertrieben, im Gegenteil. Lévinas versteht sich in der Kunst, dem Bodenschweren, dem niemals Verrückbaren, dem Steindenken deutscher Gigantenschaft jene Spannbreite an Flügel zu verleihen, damit das Blei im Denken fliegt, damit es flirrt und lodert. Dieser Mann, ein moralischer Nietzsche aus Frankreich, der 1906 in Litauen geboren wurde und als erster Husserl ins Französische übersetzte, wird ein Zertrümmerer der sanftesten Art. Er wird ein zweiter Ikarus, der sich aus Klugheit der Sonne nicht nur nähert, nein, der mit ihr fliegt, auf ihr, in ihr. Nur einmal wird er stürzen, 1942 – 45 gerät er in die Gefangenschaft der Nazis. Dieses Deutschland wird er danach nie mehr betreten, dieses Deutschland, das die Seinen zu Tode gebracht hat. „Denn der Tod“, wie er einmal sagen wird, „der Tod des anderen ist dein erster Tod.“
Diese jüdische Kollektiv-Wunde, in keinem Exil des Exils sein zu dürfen, diesen Hiat wird er mit dem weißen Laken der Philosophie notdürftig verbinden, tagaus, tagein. Für ihn, für uns, für das Andere. Nie wird man ihn dabei klagen hören, nur der stampfende Rhythmus des Dagegenhaltens strömt auch noch aus dem neunzigjährigen Körper seiner Schrift. Die Unmöglichkeit denken, mit dem Denken darüber hinaus. Der Inhalt einer Vase kann größer als deren Umfang sein. Das sind die Werkzeuge seiner Zauberschaft.
Ich schlage sein Werk auf, Totalität und Unendlichkeit, und mit diesem Aufklappen nehme ich ungewollt den vordersten Platz an der Reeling ein. Hier beginnt die Meeresfahrt mitten hinein in das dichteste Staunen. Allein für diesen Eröffnungssatz hätte es sich gelohnt, das Lesen zu erlernen. Ein wundervoll zerrissener Satz, vollkommen in seiner komplizierten Einfachheit, wird uns, die Leser, hier erwarten. „DAS WAHRE LEBEN IST ABWESEND, ABER WIR SIND AUF DER WELT.“3
Doch dann nach einer Weile spüre ich den Hinterhalt und wie diese Wörter hart in meinen Nacken schlagen. Immerzu. Allein, die Umkehr dieser Aussage, dass ich die Anwesenheit eines falschen Lebens wäre, raubt mir für eine Weile den Atem, verweigert mir den Ausstieg. Wo will Monsieur Lévinas mit uns hin, ins wahre Leben, aber dort sind wir dann ja nicht mehr. Will er zu jenem Meridian, wo noch keiner war, in die fremdeste Fremde? Aber wer führt uns von dort wieder sicher zurück? Vor mir stößt sich das Meer immer weiter in den Himmel hinein und wird mit der Zeit zum anderen Blau.
Mit jeder Stunde dieser Fahrt gerate ich tiefer hinein in diesen Sog einer „Taghellen Mystik“. Vertrautes schleicht sich davon und kehrt als Frage wieder. Ermattung, ich schlafe ein. Mein Ich liegt immer bei mir. Dieses immer Bei-mir-Sein bezeichnet Lévinas als die „Totalität des Seins“. Ich ist für ihn nur ein vom Tod begrenztes Kreisen, das sich nur dann und wann aus den eigenen Ketten sprengt. Gibt es denn keine Flucht aus den Umrissen der eigenen Haut, frage ich mich. Gibt es denn keine Architektur des Seins, die mich abreißt, neu gestaltet? Monsieur Lévinas, könnte ich an dieser Stelle schreien, greifen Sie ein, tun Sie doch was! In Die Zeit und der Andere lese ich seine Meinung dazu:
„Man kann zwischen Seienden alles austauschen, nur nicht das Existieren. In diesem Sinn heißt Sein, sich durch das Existieren isolieren. Insofern ich bin, bin ich Monade (…), bin ich ohne Tür und ohne Fenster.“4
Ich ist also ein Ding, dem ich lebend nie entweichen werde. Eine große, schrecklich schöne Einsamkeit. Ich ist der Nachname meiner ewigen Gefangenschaft in mir. Ich frage mich, ich frage den Mann hinter der Schrift, ob nicht Sokrates, dieser allwissende Nichtwisser, eine Lösung hätte. Über meinen Vorschlag kann Monsieur Lévinas nur lachen, er flüstert mir zwischen den Buchstaben zu: „Bei Sokrates beginnt ja das Problem, es ist diese Stelle im Dialog Alkibiades. Dort fängt das Dilemma an.“
Und ich blättere zurück, und das Schiff nimmt Kurs auf Athen. Mit jeder Seemeile nähern wir uns dem Marktgeschrei der Händler. Ich sehe, wie sich auf dem Rücken der Frauen und Sklaven Kisten stapeln, die sich schaukelnd durch die Agora bewegen. Auch wenn die Träger ein juristisches Nichts bedeuten, ihre Last bewegt sich doch. Vorbei an diesem abendländischen Zug der Ungerechtigkeit, der sich in mich einritzt wie der Geruch von Safran, Pfeffer, wildem Majoran. Zwischen hängenden Gänsen und Fischen, die in Salzlaugen liegen, wage ich mich näher an zwei Männer heran, die ganz erhaben durch die Menge schreiten. Der eine schön und eitel, der andere von einer Klugheit, die sich nur selten wäscht. Ich höre nur Wortfetzen, die Sokrates zu diesem Alkibiades spricht, ich höre nur, dass die Sorge um sich selbst, das epimeleia heautou, das Wichtigste sei. Dann käme lange nichts, dann käme erst der andere. „Finde das Selbst deines Selbst, das auto to auto. So wird alles gut und du, Alkibiades, wirst herrschen.“
Das war soeben die völlig missglückte Geburtsstunde des Ichs“, flüstert Monsieur Lévinas plötzlich im weißen Knitterleinen neben mir und fächelt uns mit seinem Panamahut keuchend zurück ins Heute. „Wie du siehst, sind Ich-Werdung und Herrschen ein kraftstrotzendes Brüderpaar, unter dem wir immerfort zu leiden haben“, fügt er dann noch hinzu. Und über dem heutigen Athen, diesem erblindeten Auge des Philosophen, senkt sich die Zeit, da alle Läden schließen. Nervöses Hupen setzt ein, so von Auto zu Auto. Hinter verdunkelten Scheiben sieht man schwer gepanzerte Gesichter mit ihrer Tötungsabsicht ringen … Aber ich schweife ab …
Die Reise ins Rätsel Lévinas beginnt mit jenem Aufsatz, geschrieben im Jahre 1935. De lévasion. Hier steckt der Grundgedanke, die Wurzel, die sich später zur prächtigen Platane erheben wird. Drei Jahre vor Sartre nennt er darin den Ekel als „die eigentliche Erfahrung des Seins“, oder auch: „Das Übel zu sein“ (male d’ être). Das Sein als Last. Männer wie er spüren, was bald auf Europa zukommen wird: dieser Brandgeruch mitten aus dem Herzen der kantischen Ländereien. Und die Spitze der Windrose weist längst in Richtung Ekel, weist auf Leichengeruch und auf das gestiefelte Näherrücken der Nazis. Gleich wie Sartre denkt er an Ausbruch, aber wie kommt man aus diesem anonymen Sein, aus diesem „Es gibt“, wie Lévinas es nennt? Und er hat einen Plan: Wir Seiende müssen aus dem Sein hinaus und dann noch einmal weiter. Descartes hilft ihm dabei. In seiner dritten Meditation5 spricht er von der Idee des Unendlichen, die ein Mensch zwar nicht zu denken vermag, aber dennoch hätten wir ohne diese Idee keine Vorstellung darüber, wie endlich, wie unvollkommen wir sind.
Aber wo liegt diese Küste, dieses Jenseits des Seins, wie gelangt man dorthin? Ein Ich, das unentwegt das Fremde zum Eigenen macht, diese Aneignungsmaschine ist doch der verfehlteste Reisebegleiter dorthin. Aber mit wem sonst könnten wir reisen, außer mit uns? Und wieder stellt Lévinas eine Frage auf den Kopf. Er fragt nicht: Was ist das Sein? Er fragt sich: Wer ist das Sein? Wer steckt da in dieser Maske? Die deutsche Jemeinigkeit ist ihm zu wenig. Und er fordert, dass die Ontologie der Ethik als erster Philosophie zu weichen habe.
Diese Umkehr der Frage bildet den schmerzvollen Abschied zwischen Lévinas und Heidegger. Für Heidegger, der als Rektor eine Zeit lang das stramme Heil deckt, ist das neutrale Sein der heilige Gral. Nach seiner Lehre, die Lévinas trotz aller Gegensätze als Jahrhundertleistung schätzt, wird uns das Dasein – in dem unser Ich ein Leben lang suizidgefährdet steckt – vom großen, götterhaften Sein geschickt. Dieses Denken birgt für Lévinas keine Lösung. Er spürt zwar den Ekel, aber er hat im Unterschied zum Heideggermenschen keine Angst. In diesem Moment hilft ihm Platon weiter. Im Staat spricht dieser erstmals von einem Guten jenseits des Seins. Die Spur ist gelegt. Das Jenseits des Seins blitzt auf im Antlitz des Anderen. Das Jenseits des Seins liegt dort, wo der Andere ganz anders als ich seit Jahrtausenden wohnt.
Aber was führt mich da hin? Auf keinen Fall das Bedürfnis, meint Lévinas. Das Bedürfnis sei bloß ein Hunger, den man stillt. Unser Reisebegleiter sei das Begehren. Und so heißt es in Totalität und Unendlichkeit:
„Das Begehren ist Begehren des absolut Anderen. Unabhängig vom Hunger, den man sättigt, vom Durst, den man löscht, von den Sinnen, die man befriedigt.“6
Aber damit eröffnet sich ein weiteres Problem. Es muss ein Land sein, in das wir wollen, und das wir doch niemals besuchen werden. Sonst wäre es kein Begehren. Das Begehrte muss unsichtbar bleiben. Das Gelingen des Begehrens liegt in seiner Unerfüllbarkeit. Doch dieses Land, Jenseits des Seins, liegt nach Lévinas nicht jenseits von uns. Aber was heißt das?
Tagtäglich taucht es im Antlitz des Anderen vor uns auf. Doch dieser Andere ist absolut und unentwegt anders als ich. Kein Alter Ego, wie noch bei Husserl, kein Du, wie bei Martin Buber. Ich und der Andere bilden nach Lévinas keine Symmetrie, beide sind nicht reziprok. Und so heißt die Lévinassche Losung: erst der Andere, dann ich. Aber er spricht hier nicht aus Frömmigkeit, und so wären wir beim nächsten Punkt seines paradoxalen Denkens. Unser Ich sei ein entfremdetes Ich, angekettet an sich selber. Und das macht den Schwindel bei der Lektüre von Lévinas aus – diese Entfremdung sei gut, äußerst brauchbar, wie er meint. Erst über die dritte Person, erst über das ER, SIE, ES, über den Anderen, wird unser kleines, unfertiges, ans Gitterbett geschnalltes Ich erwachsen. Autonomie durch Heteronomie. Dazu kommt noch: Dieser Andere verfügt über einen Ruf, den mein unfertiges Ich zu erfüllen hat, und der lautet: Du kannst und wirst mich nicht töten, deine Hand langt nicht in dieses Unsichtbare hinein. Es entzieht sich, wenn du es wagst. Diesen Ruf zu beantworten, mich zu äußern und somit einen Fuß ins Undenkbare zu stellen, bildet meine Verantwortung vor diesem Antlitz. Diese Denkfigur nennt Lévinas den Widerstand der Ethik. Und so schreibt er im besagten ersten Großwerk: