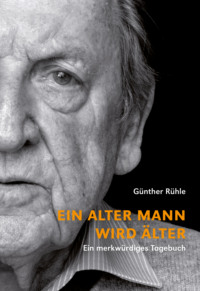Czytaj książkę: «Ein alter Mann wird älter»
Günther Rühle
Ein alter Mann wird älter
Ein merkwürdiges Tagebuch
Herausgegeben
und mit einem Nachwort versehen
von Gerhard Ahrens

Günther Rühle
Ein alter Mann wird älter
Anmerkungen
Anhang
Editorische Notiz
Günther Rühle · Leben und Werk
Günther Rühle · Bibliographie
Nachwort
Gerhard Ahrens
Der andere Günther Rühle
Warum schreib ich das alles. Ich weiß nicht mehr, was ich schon alles geschrieben habe. In mir öffnet sich anscheinend so eine Art innerer Tresor. Ich war doch immer meine eigene Verschlusssache. g. r.
Inhalt
Mein merkwürdiges Tagebuch
Oktober 2020
November 2020
Dezember 2020
Januar 2021
Februar 2021
März 2021
April 2021
Vermächtnis
Anhang
Editorische Notiz
Günther Rühle: Leben und Werk
Günther Rühle: Bibliographie (Auswahl)
Der andere Günther Rühle
Mein merkwürdiges Tagebuch
Ein Prolog
I
Auf einmal machte es RUMS. Da merkte ich, ich wurde doch 96. Bis dahin sagte ich immer zum Scherz: »Na ja, ich bin ja auch erst 96«, wenn einer sagte: »Sie sind ja ganz schön fit.« Als wäre man ein Bestaun-Objekt. Jetzt war der Punkt. Die abgestellte Baumaschine am Kreisel hatte unten noch Kanten, die ich nicht sah, jetzt war unten der Riss im Schweller. Teuerste Stelle. Der Entschluss muss in mir gewartet haben. Nie mehr Autofahren. Schluss nach 66 Jahren. Ich wurde ein Taxist. Ein gutes halbes Jahr saß ich fortan im Taxi hinten rechts, wo immer die Direktoren sitzen. Es war ein ganz neues Fahrgefühl. Herrlich. Manche Fahrer, ob kroatisch, tschetschenisch, machten einem die Tür noch auf beim Aussteigen. Man konnte noch in die Stadt, an den Geldautomaten, im Supermarkt einkaufen. Auswählen. Man war nicht im Ruhestand. Noch immer nicht.
Als Journalist muss man nicht in den Ruhestand, solang einem noch was einfällt und man noch schreiben kann, sogar noch Lust dazu hat und merkt, dass man gar nicht aufhören will und kann mit dem Schreiben. Man denkt erst beim Schreiben. Ich konnte noch schreiben. Den ganzen Tag. Ich war in eine Arbeit geraten, die noch lange nicht aufhören wollte und sollte. Ich bin ins Theater geraten, ich weiß nicht, wie. Das Warum beschäftigt mich jetzt, da ich stillgestellt bin. Ich las damals, blätternd in alten Theaterkritiken von 1897, und plötzlich funkte es. Ich hatte den Beruf eigentlich schon hinter mir, war sogar aus Berlin zurück. Da, als ich einen Bericht, von wem war der nur, las, wie der alte Fontane mit Paul Schlenther in die erste Aufführung der »Gespenster« ging, 1897. Eine Stunde später setzte ich mich an die Tasten und schrieb drauflos. Der Text eröffnete dann vier Jahre danach mein »Theater in Deutschland«, fast tausend Seiten, die sich fortsetzten und deren Ende noch nicht abzusehen war, als es RUMS machte. Da war ich sicher, der dritte Band könnte noch fertig werden.1
Das eben erhielt mich froh, zufrieden, ich gehörte nicht zu denen, die nach dem Ausscheiden aus dem Beruf in ein Loch fallen und ihre Ehefrauen mit ihrer Langeweile quälen. Bei uns war es eher umgekehrt. Als meine Frau, die unvergessbare Margret, mit 67 aufhören musste, jungen Menschen in der Schule gutes Deutsch und richtiges Englisch beizubringen, dankte sie mir eines Tages, dass ich sie beschäftigte, aus den inzwischen in Breslau aufgefundenen Kerr-Briefen ein druckfertiges Manuskript zu tippen.2
Ich muss einhalten. Wenn man so unfreiwillig in einen Ruhestand getrieben wird wie ich eben, wachsen und wuchern in einem längst vergessene und verdrängte, auch vertriebene Kräuter und Unkräuter der Erinnerung wieder hoch. Die Zeit baut sich zurück, die man doch verlassen hatte.
Der Rums mit dem Auto war nicht das einzige Zeichen, dass es Zeit werde, in ein neues Lebensalter einzutreten. Sich einzugestehen, dass man doch inzwischen gealtert sei. Sich als alter Mann zu begreifen. Ruhe geben. Das Alleinsein stürzt über viele zusammen, erdrückend. Über Vereinsamte stürzt sich Einsamkeit. Wie viele Anrufe kommen jetzt: »Ich will nur deine Stimme hören« – Illusion des Zusammenseins. Anrufe sind die Verkehrsmittel des Alterns.
Was hier an Buchstaben so dahinfließt, ist auf gut Glück ertippt. Ich kann den Text nicht mehr lesen. Es wird sich jemand finden, der die falschen Buchstaben rauskehrt und das Passende zusammenführt. Damit sind wir am Punkt meines Alterns. Das Schwinden der Sehkraft ist wie ein Raub. Fort sind alles Gold und Silber. Wer füttert fortan dich – fortan? Jetzt?
II
Ich hoffe, gefüttert zu werden bleibt mir erspart. Damit beginnt der Verfall. Man ist außer Kraft gesetzt.
Mich rüttelt immer schmerzend die Vorstellung, dass Walter Jens, auch Joachim Kaiser, in ihrer Demenz gefüttert werden mussten. Das waren doch souveräne, autarke, selbstbewusste Menschen, wachen Geistes, belebenden Denkens, bannenden Sprechens. Außer Dienst Gestellte zu Lebzeiten, der hohe Geist verloschen, ohne den Körper mitzunehmen. Man ist dann wohl eine lebende Hülle.
Wenn man jetzt eine halbe Stunde vor dem Haus auf und ab geht, man sagt noch immer »Spaziergang«, obwohl es keiner ist. Drüben im Wald, ja; aber hier flaniert man auf der Sicherheitsroute vor den Häusern der Nachbarn, die einen noch freundlicher grüßen und immer dieselbe Frage stellen: »Wie geht’s?« – obwohl sie doch sehen, wie es einem geht, Schritt für Schritt, und mit Stock. Zweimal am Tag 1299 Schritte, das ist zweimal ums Karree. Vor einem halben Jahr hat man die Schritte noch gezählt – Zählen ist eine Einübung ins Altern –, jetzt weiß man, wie viele es sind bis zu dieser oder jener Ecke. Und wie viele bis zur Haustür.
Die Krise, die mit dem Fällen der Birke vor unserem Haus, meinem Sturz, dem Tod von Monika Schoeller3 begann, scheint überwunden. Sie enthielt Wandlungen. Es stiegen die Gefühle des Alterns, das Verlangsamen der Bewegungen. Den Spaziergang zum Sportplatz musste ich aufgeben, der halbstündige Weg durchs Dorf wird mühsamer, zwingt zum Stehenbleiben, gestützt auf Onkel Heinis Stock. Im Haus ist die Bewegung normal, fühle ich mich jünger, aber das Bewusstsein der Jahre trifft mich immer wie ein Hammer. Ich weiß, ich lebe in glücklichen Umständen, schmerzlos, noch wachen Geistes, voller, wenn auch gedämpfter Arbeitskraft, finanziell sorgenlos.
Auch die Not, die mit dem Enden des Autofahrens kam, die Unbeweglichkeit, sich zu versorgen, ist gelöst. Delia und Dumitru sind wie liebende Verwandte, kamen vorhin im strömenden Regen mit den Lebensmitteln, die ich brauchte, weil Rewe wegen der Corona-Angst nicht liefert, kamen stolz und mit Freude.
Der Wechsel des Kardiologen hat sich gelohnt, Schüßler scheint alles in den Griff zu bekommen, ein neues Hörgerät haben wir bestellt, das alte wurde trefflich wiederhergestellt. So höre ich fast im Überfluss, nur die Augen verlassen mich. Die Ärztin in Kronberg sagt, keine Behandlung möglich, die Makula trocken. Ich hoffe, ich verliere das Sehen nicht. Das Lesen ist mühsam und wird von Tag zu Tag schwerer. Heute Peymanns Biographie, zwei Seiten eine ganze Stunde (gut, zu klein gedruckt), aber die Welt ist mir wie hinter Milchglas. Selbst mit Brille kann ich manche Überschrift in der Zeitung nicht mehr lesen. Brauche Vergrößerung in allem, auch im Willen zum Leben, damit die Anfechtungen, das Verlangen nach Schluss, wieder wegkommen.
Neunzig Jahre brauchte es, bis ich ein Verhältnis zu mir selbst bekam. Ich interessierte mich nie für mich, nur insofern: Was kannst du, was steckt in dir = das Rühlesche Leistungsprinzip. Jetzt fühlt man sich, horcht in sich, erlebt die merkwürdigsten Dinge.
III
Schon seit längerem merke ich, dass in mir eine merkwürdige Phantasie sitzt. Ich schlafe fest, erwache und sehe Personen im Zimmer, körperlich, neben mir, über mir, die sich nach drei, vier, fünf Sekunden auflösen. Wie Besucher. Vorhin schlafe ich vor dem Fernseher ein, bei einer Sendung über Mata Hari. Ich erwache, es kniet eine Art Zwerg vor mir und reicht mir etwas zu. Neulich, ich saß im Arbeitszimmer, im Sessel – Margrets letztes Geburtstagsgeschenk –, schlief, erwachte, hinter mir ein Geräusch, es löste sich eine große Person in langem weißen Mantel, kommt hinter meinem Rücken hervor, geht zur Tür, löst sich dort auf. Was war das? Ein Schutzengel? Vorgestern, ich erwache morgens, es ist schon hell, an der Decke des Schlafzimmers ein schwarzes, wohlgefügtes, mit Blumen umwundenes Kreuz. Zehn Sekunden etwa. Was ist das alles? Morgen muss ich über die »Iphigenie« von Peymann schreiben.
IV
Die Krise war der Anfang des Endes. Ich sehe fast nichts mehr, musste vorige Woche alle Pläne für Vollendung TGIII4 aufgeben. Mit dem Verlag ist sicher, dass er das Buch machen will. Hermann Beil5 und Stephan Dörschel6 wollen weitermachen – großes Glück. Diese Zeilen werden geschrieben, bevor ich, auch nach langem Suchen, wo und wie, keine Mails mehr schreiben kann. Schlussbrief an Beil und Dörschel, ich weiß nicht, was noch wird. Ich torkle durchs Haus. Kann keine Uhr mehr lesen. Ich suche schon eine Stunde auf meinem Computer das Schlussstück zu TGIII. Das Denkmal, Steins »Faust«. Ich habe es wohl weggelöscht. Das war das Letzte, was ich noch konnte vor zwölf Tagen, dann dreimal umgeschrieben. Das Leben müsste längst weg sein, es ist eine Quälerei. Die Kräfte schwinden, man wackelt beim Gehen, erkennt nur noch die Konturen, Bewegung bald nur noch aus Erinnerung. Ich male mir alle möglichen Sorten von Suizid aus.

Oktober 2020
10. Oktober 2020
Tagesgespräch 1
Nun ist es aus. Vor acht Wochen ging Schreiben und Lesen gerade noch. Drei Untersuchungen, trockene Makula, Altersdegeneration. Man ist wie abgeschnitten von seinem Leben. Ich bin jetzt – fast plötzlich – ein anderer. Ohne Zweck und Sinn. Wie einst, bevor man sich den Zweck beruflich zugelegt, dem auch einen Sinn zugelegt hat. Mein Zweck muss das Schreiben, der Sinn dessen Inhalt gewesen sein. Ich, der fröhliche Bub aus der Bäckerei Poths in Weilburg, bin im Theater gelandet, dort fixiert durch die Arbeit und die Meinung der anderen, Leser genannt. Wessen Geschöpf ist man? Das der Eltern, seiner selbst oder der anderen? So plötzlich außer Dienst, außer Funktion gestellt, lebt man nur noch für sich. Wird sich selbst das Ereignis des Tages. Was konnte ich vorgestern noch, gestern, heute. Nächste Woche wird man noch schlechter sehen, die Uhr nicht mehr erkennen. Man braucht das dritte Bein, das Wackeln beginnt, man braucht Hilfe und Hilfen. Heitere Einsicht (sehr vorübergehend), man hat noch eine Entwicklung. Wird Altersunternehmer. Wer putzt das Haus, macht die Wäsche, kocht. Die zunehmenden Reduktionen schaffen Bewegung für andere. Sinn, Zweck? Die Fragen von früher lösen sich auf. Fließen weg ins Überflüssige, ersetzen sich, werden gar wörtlich: Was wurde aus diesem und jenem? Wie kommst du durch? Redlich? Deutlich erkennbar? Verantwortlich oder unsicher, taumelnd, ziellos, schuldhaft? Warst du schäbig, was war falsch, was richtig? Die Fragen tropfen in einen hinein, rumoren. Hängt im Hintergrund noch immer das Jüngste Gericht? Lass das. Draußen kommt die Abendsonne.
11. Oktober 2020
Tagesgespräch 2
Doch wieder aufgewacht, kräftiger, wacher als letzte Woche, obwohl man jetzt jeden Abend bittet, es möge die Nacht die letzte Gnade empfangen, möglichst sanft nachts wegschlafen. Das früh eingeübte Beten hat sich wieder eingeschlichen, das in dem Tagesbetrieb und seinem Freiseinwollen sich weggeschoben hatte. Wie ein verlorener Text krabbelte es aus dem seltsamen Computer unseres Gehirns wieder hervor, als das Danksagen begann, Dank für das Erstrebte, Erreichte, Gefundene, an wen? Denke nicht weiter. Wer oder was ist »Der Herr«? Du »entschläfst« dich mit dem Grübeln, raubst dir den Schlaf fast. Was ist das einsilbige »Ent«: Entbehren, entsagen, enttrümmern, entlassen, entbinden, entkräften. »Ent« bedeutet dem Wort, was es sagt. Will man denn nicht schlafen, obwohl man den ewigen Schlaf sucht? Ein »du entschläfst«, der Euphemismus für »entleben«. Es gehört zu den heimlichen Milderungen, mit denen wir entschärfen.
17. Oktober 2020
Von wegen entschlafen. Es trieb mich nach der Rasur in neuen Schlaf. Wir können uns nicht entschlafen, es entschläft uns. Müßige Qual der Gedanken. Sie bohren sich in den Kopf, das kommt immer öfter. Versprechen ist auch sowas. Es erhalten. Wenn man anfängt, kommt man aus dem Gedankendreh schwer wieder raus. Verschwendete Zeit. Wenn die Augen sich von ihrem Dienst zurückziehen und alles neblig wird, auf der Straße wie im Wohnzimmer, fällt man in sich selbst zurück, in den Wust nicht verarbeiteter Gedanken, Gefühle, Erinnerungen. Erst wundert man sich, wo das herkommt, dann staunt man, was da kommt, wie man lachen musste, als der Vater die Treppe runterfiel und man nachher die Dresche bekam. Fast spürt man sie wieder und hört sich rufen: »Hör auf, ich habe es doch nicht böse gemeint.« Man sieht auf einmal in die andere Zeit. Achtzig Jahre zurück, wenn die Augen verlöschen, der Leib vergeht, wo bleiben dann die Gedanken. Wieder so ein Drehwurm. Ich musste raus aus dem Sessel und draußen die tausend Schritte gehen, die ich jetzt einübe.
18. Oktober 2020
Ich treibe in eine Landschaft voller Nebel. Er wird von Morgen zu Morgen dichter. Ich habe schon ein eigenes Mess-System. Wie viele der kleineren Fliesen im Bad sehe ich noch. Ich verliere die Kontrolle über die Zeit. Die Uhren im Haus versinken im Nebel. Noch reicht es für die Stufen der Treppe. Wie lange noch? Ich lebe immer mehr von den eingeübten Wegen, Schritten. Ich messe Räume und Entfernungen immer mehr aus Einübung und Wohlgefühl. Gestern Abend war ich fast verzweifelt, kam mit der Kassette von dem Lautsprecherturm von Braun, dem Renommierstück von vor vierzig Jahren, nicht mehr zurecht. Die Dinge, die wir machen, haben eine andere Lebenszeit als wir selbst. Schreibt man deswegen Bücher, um sich über seine Zeit hinaus zu erhalten? Meine Absicht war das nie. Ich lebte aus der gegenwärtigen Lust am Schreiben, aus der täglichen Forderung. Wenn es in der Redaktion mal knallte, sagte ich im stillen Trotz oft: »Ich werde euch alle überleben«. Das war Übermut, nun ist es so, und man will raus aus diesem Leben. Das Fallenlassen ist auch ein schönes Gefühl. Leise Wonne im Übergang: anderswohin. Dann rebelliert der Rest des Lebenswillens. Plötzlich singt man laut ins leere Haus, in dem die Vergangenheit stillsteht:
»Heidewitzka, Herr Kapitän« — oder noch jugendlich frecher: »Heidewitzka, mein Mann ist krank, er liegt besoffen unterm Kleiderschrank.«7 Man erschrickt vor sich selbst. Wie sagt Goethe: »Das Alter macht nicht kindisch, wie man spricht. Es findet uns nur noch als wahre Kinder.«8 So oder so ähnlich. Ich kann es nicht mehr nachschlagen. Man kann nur noch in seinem Kopf lesen, Bücher gehen nicht mehr. Adieu Zitatenhort von vier Generationen. Google weiß es wohl, aber selbst da ist jetzt alles im Nebel.
19. Oktober 2020
Die Nachtruhe
Die Nachtruhe hat den Augen nichts gebracht, eher den Nebel verdichtet. Das Üben hier wird schwer, ich muss die Buchstaben auf der Tastatur schon suchen. Es handle sich um Netzhautablösung. So steht es jetzt im Bericht. Gottlob habe ich morgen Termin bei Frau Schmidt. Ich soll den Frankfurter Bericht mitnehmen. Hoffentlich finde ich ihn.
Die tausend Schritte vor dem Haus gehen. Meine rumänische Lebenshilfe, Krankenschwester oben in der Rehaklinik, ist krank. Wer hilft mir?
Ich jammere mich nicht ins Unbekannte. Ein Dutzend Mal am Tag auch die Namen meiner Toten und noch lebenden Nächsten. So belebt man sich künstlich den leeren Raum um sich, übt wenigstens die Stimme. Mein Sprechen wird immer holpriger. Man schweigt fast den ganzen Tag. Manchmal entdeckt man sich in Selbstgesprächen. Man kommt sich komisch vor, wenn man sich entdeckt. Es bleibt das Telefon als Übungsgerät, man ruft die sechs, sieben Menschen an, die einem noch nah sind, zu Gesprächen, die mit dem immer schon fünfmal Gesagten enden und in guten Wünschen. Gestapelt füllten sie schon das halbe Haus. Es ist also noch etwas Platz.
Der Anteil der Eisware an meiner Ernährung wächst, das Kochen mindert die Lust wegen dauernder Wiederholung von Bratwurst mit Kartoffeln und Salat.
Ich war für mich interessiert, nicht an mir.
Ich denke, meist samstagabends, wenn ich mich langlege: wieder eine Woche weg, eine Woche näher am Exitus, den man oft will und oft nicht. Letzte Woche noch. Aber nicht jetzt. Jetzt nicht! Die Gefühle lösen einander ab. Morgens in sich gespalten, wünscht man sich das Ende und greift noch nach dem Leben. Zweimal und oft am selben Tag.
Ich wollte von der Zauberbrille erzählen, die man mir zu verpassen sich anschickt …
20. Oktober 2020
Es ist nun sicher: Der Umbau beginnt. Ich komme von der wunderbaren Augenärztin zurück, der zwei hochrenommierte Fachkollegen ihre Diagnose bestätigt haben. Richte dich ein in dem beschädigten Zustand. Trockene Makula, keine Hoffnung für das linke Auge. Dreimal die gleiche Diagnose, das muss reichen. Es hilft weiter nur die Brille mit der Kamera, die die Texte, die ich lesen will, fotografiert, in Sprache umsetzt und mündlich berichtet, was sie liest, und ich das hören kann, was ich mit den Fingern benannt habe. »Sie müssen das tüchtig üben.« Üben und sogar tüchtig. Noch ein Apparat und einer ganz neuer Art. Blinde Studenten sollen damit sogar das Examen geschafft haben.
Es fing vor fast 50 Jahren an. Statt der Zähne: Implantat. Dann die Brillen, drei Stück, für Ferne, Nähe und den Computer. Dann musste das Herz gestützt werden. Zwei Stents und ein Herzschrittmacher. Jetzt also dieser Apparat. Sehe hörend, wohin du nicht siehst. Denn man muss den Kopf etwas schräg halten, mit dem rechten Auge knapp am zu lesenden Text vorbeigucken, damit die Kamera, die dein Auge ist, lesen kann. Werde ich die Geduld haben, ich kämpfe seit Jahren schon mit den Einstellungen auf dem Computer. Das Angebot ist reichlich, der Irrtum unausweichlich. Man kann sich schon einen künftigen Menschen vorstellen, der aus lauter Ersatzteilen besteht. Mit eigenen Olympischen Spielen. Mich schauderte interessiert; wenn ich die Anfänge bei den Paralympics noch sehen könnte. Die Brille, die mir zuwächst, ist nichts fürs Fernsehen. Es bleibt mir eine akustische Erregungsstation. Meine Zukunft wird sichtbar im Verschwinden des Sichtbaren.
Eben brachte die Post das neue Buch von Bernd Feuchtner über »Die Oper des 20. Jahrhunderts in 100 Meisterwerken« – munter, freundlich und höchste Kompetenz bewahrend. 1992 habe ich ihn als Musikkritiker an den Tagesspiegel geholt. Da begann seine Karriere. Ein zarter, freundlicher, gescheiter, empfindsamer Mann. Das wollte, sollte, könnte ich lesen. Ich habe großen Nachholbedarf in Sachen Oper. Aber mit 96 bleibt das Meiste beim Wollen. Es gibt eine merkwürdige Lust zu denken: »Ich könnte« – auch wenn man nicht kann. Möglichkeiten sind der Saft der Hoffnung. Und die Hoffnung eine andere Art des Atmens.