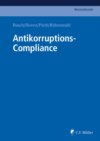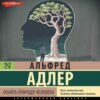Czytaj książkę: «Praxishandbuch Medien-, IT- und Urheberrecht»
Praxishandbuch Medien-, IT- und Urheberrecht
Herausgegeben von
Prof. Dr. Rolf Schwartmann
Bearbeitet von
Dr. Markus Bagh, LL.M. · Peer Bießmann · Marc Oliver Brock · Doris Brocker
Ina Depprich · Prof. Dr. Bernd Eckardt
Prof. Dr. Dieter Frey, LL.M. · Prof. Klaus Gennen · Dr. Anne Hahn
Dr. Christian-Henner Hentsch, M.A., LL.M. · Martin W. Huff · Dr. Carsten Intveen
Viktor Janik · Prof. Dr. Tobias O. Keber
Dr. Thomas Köstlin, M.A. · Dr. Katja Kuck · Jasmin Kundan
Jens Kunzmann · Nicola Lamprecht-Weißenborn, LL.M.
Dr. Niels Lepperhoff · Josef Limper · Sebastian Möllmann · Dr. Christoph J. Müller
Sara Ohr · Prof. Dr. Christian Russ · Michael Schmittmann
Dr. Matthias Schulenberg, LL.M. · Prof. Dr. Rolf Schwartmann
Prof. Dr. Stefan Sporn · Dr. Frederic Ufer
4., neu bearbeitete Auflage

Impressum
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-8114-4706-6
E-Mail: kundenservice@cfmueller.de
Telefon: +49 89 2183 7923
Telefax: +49 89 2183 7620
© 2017 C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg
Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM) Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des ebooks das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen. Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Verlag schützt seine ebooks vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Bei Kauf im Webshop des Verlages werden die ebooks mit einem nicht sichtbaren digitalen Wasserzeichen individuell pro Nutzer signiert. Bei Kauf in anderen ebook-Webshops erfolgt die Signatur durch die Shopbetreiber. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Vorwort
Die vierte Auflage des Praxishandbuchs Medien, IT- und Urheberrecht erscheint drei Jahre nach der Vorauflage. Seine Konzeption als kompakter Ratgeber für den Praktiker in drei Rechtsgebieten, die sich zunehmend verzahnen, hat sich insbesondere als Begleitliteratur in der Fachanwaltsausbildung bewährt.
Im Herbst 2017 zeigt sich deutlich, wie rasant die Digitalisierung voranschreitet. Mit der zunehmenden Bedeutung neuer Mediendienste in der Gesellschaft steigt auch der Bedarf in der anwaltlichen Beratung und Prozessvertretung im Bereich der neuen Medien. Sie sind längst nicht mehr nur das Spezialgebiet von Großkanzleien. Diesen Entwicklungen trägt das Praxishandbuch in seiner Neuauflage Rechnung. Die Schwerpunkte der in der Regel grundlegenden Überarbeitungen waren vielfach der Digitalisierung und den Aktivitäten des nationalen und europäischen Gesetzgebers in diesem Kontext geschuldet.
Besonders hervorzuheben sind die Anpassungen im Datenschutzrecht an die bereits geltende, aber erst Ende Mai 2018 anwendbare Datenschutz-Grundverordnung und das ebenfalls ab diesem Zeitpunkt geltende geänderte Bundesdatenschutzgesetz. Da das Praxishandbuch zum Zeitpunkt des Erscheinens sowohl die aktuelle und die schon feststehende künftige Rechtslage abbilden muss, haben wir uns in den Kapiteln mit Bezug zum Datenschutzrecht dazu entschieden, an den relevanten Stellen im Text die aktuelle und die künftige Rechtslage als Ausblick darzustellen, wobei letzteres bisweilen nur in Form eines Ausblicks sinnvoll war.
Zudem ist etwa auf größere Änderungen im Urheberrecht hinzuweisen, wo das Kapitel zum Recht der Verwertungsgesellschaften nun unter erweiterter Autorenschaft verfasst wurde. Weitere grundlegende Überarbeitungen wurden unter anderem im Jugendschutzrecht, im Recht der Sozialen Medien und im Recht der Telemedien erforderlich.
Ich danke allen Autorinnen und Autoren sowie dem Verlag für die engagierte und immer aufwendiger werdende umfassende Aktualisierung des Handbuchs. Über Anregungen und Kritik unter rolf.schwartmann@th-koeln.de freue ich mich.
Köln, im Oktober 2017 Rolf Schwartmann
Vorwort zur 1. Auflage
Wie sehr Medienrecht, Informationstechnikrecht und Urheberrecht miteinander verklammert sind, mag folgendes Beispiel verdeutlichen.
Ein Unternehmen, das eine Internetpräsenz mit bewegten Bildern plant, ist zunächst mit dem öffentlich-rechtlichen und dem zivilen Medienrecht konfrontiert. Da Inhalte an die Allgemeinheit gerichtet werden, ist grundsätzlich das Rundfunkrecht zu beachten. Es ist vom Recht der Telemedien und vom Telekommunikationsrecht abzugrenzen. Allein das Rundfunkrecht hat spezielle Vorgaben zu beachten, die sowohl ex ante (Zulassung) als auch ex post (z. B. Werbe- und Jugendschutzvorschriften) greifen. Tangiert ist bei zusätzlichen Textdarstellungen auch das Presserecht. Hinzu kommen z. B. Fragen hinsichtlich der Verbreitungstechnik und der Regulierung des speziellen Verbreitungswegs, des Wettbewerbs- und Datenschutzrechts. Bei der für den Netzauftritt zu erwerbenden und zu pflegenden Hard- und Software müssen Lösungen im Bereich des Informationstechnikrechts gefunden werden. Soll das Netz als Vertriebsweg genutzt werden, ist das Recht des elektronischen Geschäftsverkehrs (E-Commerce) zu beachten. Das Urheberrecht, dessen Spezialbereiche wie das Verlagsrecht und das Musikrecht sowie benachbarte Gebiete, etwa das Wettbewerbsrecht und das Markenrecht, erweitern das Anforderungsprofil. Dieses ergibt sich in allen der genannten Gebiete nicht allein aus dem nationalen Recht, sondern zunehmend auch aus dem internationalen, insbesondere dem europäischen Recht.
Vorliegendes Handbuch soll dem Praktiker dabei helfen, eine Schneise durch das Dickicht der sich stellenden Probleme zu schlagen. Sein Umfang trägt dem Facettenreichtum Rechnung, den obiges Beispiel nur in Ansätzen verdeutlichen kann. Alle Fragen werden in der Regel nicht miteinander verwoben auftreten. Aber auch bei der Lösung von Einzelproblemen ist der Blick für das Gesamtsystem unverzichtbar. Zusätzlich werden Spezialgebiete des Medien-, IT- und Urheberrechts behandelt. Etwa Arbeitsrecht und Medien, Sport und Medienrecht, Beihilfe- und Vergaberecht im Medien- und IT-Bereich, das Recht der deutschen und europäischen Kulturförderung und das Film- und Fernsehvertragsrecht. Die umfassende Abhandlung erfolgt zum einen aus Gründen der Vollständigkeit und zum anderen, um die Anforderungen der Curricula der Fachanwaltschaften für Urheber- und Medienrecht und für Informationstechnologierecht in einem Handbuch vollständig abbilden zu können.
Das Buch ist von Praktikern für Praktiker geschrieben. Die Autorinnen und Autoren sind in erster Linie Rechtsanwälte und in den von ihnen bearbeiteten Bereichen ausgewiesene Experten. Ihre berufliche Herkunft ist so inhomogen wie das Medienrecht selbst, weil sie die Facetten der Mediengattungen und der Medienbranche (öffentlich-rechtlicher Rundfunk, privater Rundfunk, Printunternehmen, Kabelnetzbetreiber, Telekommunikationsunternehmen, Bundeskartellamt, Produktionsfirmen und beratende Anwaltschaft) spiegelt.
Im Rundfunkrecht konnte das Gebührenurteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem September 2007 und noch kurz vor Drucklegung eine Vorstellung und erste kurze Bewertung des Entwurfs für den 10. Rundfunkänderungsstaatsvertrag erfolgen. Er liegt seit Ende Oktober 2007 in einer abschließenden Fassung vor und enthält insbesondere die sog. „Plattformregulierung“. Zudem hat die Richtlinie für audiovisuelle Mediendienste Berücksichtigung finden können, welche Ende 2007 die EG-Fernsehrichtlinie ersetzen wird. Beim IT-Recht konnte im Vergaberecht das Muster zum EVB-IT-Systemvertrag von August 2007 und im Strafrecht das 41. Strafrechtsänderungsgesetz zur Bekämpfung der Computerkriminalität ebenfalls aus dem August 2007 berücksichtigt werden. Das „Zweite Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft“ (sog. „Zweiter Korb“), das im September 2007 verabschiedet wurde und am 1. Januar 2008 in Kraft treten wird, hat Eingang in die urheberrechtlichen Beiträge gefunden.
Über Anregungen und Kritik an medienrecht@fh-koeln.de freuen wir uns.
Köln, im November 2007 Rolf Schwartmann
Bearbeiterverzeichnis
| Dr. Markus Bagh, LL.M. Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz und für Urheber- und Medienrecht, LLR Legerlotz Laschet und Partner Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Köln | 22. Kapitel (zusammen mit Gennen) |
| Peer Bießmann Rechtsanwalt, Leiter Legal & Business Affairs Brainpool TV GmbH, Köln; Scheuermann Westerhoff Strittmatter Rechtsanwälte, Köln | 34. Kapitel (zusammen mit Möllmann) |
| Marc Oliver Brock Rechtsanwalt, PricewaterhouseCoopers Legal Aktiengesellschaft Rechtsanwaltsgesellschaft, Düsseldorf | 10. Kapitel (zusammen mit Schmittmann) |
| Doris Brocker Justiziarin, LfM NRW, Düsseldorf | 5. Kapitel |
| Ina Depprich Rechtsanwältin, GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, München | 31. Kapitel |
| Prof. Dr. Bernd Eckardt Technische Hochschule Köln | 14. Kapitel |
| Prof. Dr. Dieter Frey, LL.M. (Brügge) Rechtsanwalt, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht, FREY Rechtsanwälte Partnerschaft, Köln | 15. Kapitel |
| Prof. Klaus Gennen Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und für Arbeitsrecht, LLR Legerlotz Laschet und Partner Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Köln; Professur Kölner Forschungsstelle für Medienrecht, TH Köln | 21. Kapitel, 22. Kapitel (zusammen mit Bagh), 24. Kapitel, 25. und 29. Kapitel (zusammen mit Intveen) |
| Dr. Anne Hahn Rechtsanwältin, SSB Söder Schwarz Berlinger Rechtsanwälte PartG mbB München | 6. Kapitel (zusammen mit Lamprecht-Weißenborn) |
| Dr. Christian-Henner Hentsch, M.A. LL.M. Rechtsanwalt, Kölner Forschungsstelle für Medienrecht, TH Köln; Justiziar, BIU – Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware, Berlin | 27. Kapitel (zusammen mit Sporn) |
| Martin W. Huff Rechtsanwalt, LLR Legerlotz Laschet und Partner Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Köln; Geschäftsführer Rechtsanwaltskammer Köln | 18. Kapitel |
| Dr. Carsten Intveen Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht, LLR Legerlotz Laschet und Partner Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Köln | 25. und 29. Kapitel (zusammen mit Gennen) |
| Viktor Janik Rechtsanwalt, Head of Regulatory Affairs, Unity Media Group, Köln; Lehrbeauftragter Universität Mainz | 8. Kapitel |
| Prof. Dr. Tobias O. Keber Hochschule der Medien, Stuttgart; Universität Koblenz-Landau | 20. und 23. Kapitel |
| Dr. Thomas Köstlin, M.A. Geschäftsführer, Exponatus/Büro für Ausstellungsmanagement, Berlin | 17. Kapitel |
| Dr. Katja Kuck Rechtsanwältin; GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Köln | 26. Kapitel |
| Jasmin Kundan Regierungsdirektorin, Bundeskartellamt, Bonn | 13. Kapitel |
| Jens Kunzmann Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, Cornelius Bartenbach Haesemann & Partner Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Köln | 30. Kapitel |
| Nicola Lamprecht-Weißenborn, LL.M. (Eur.) Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf | 2. Kapitel (zusammen mit Schwartmann), 6. Kapitel (zusammen mit Hahn) |
| Dr. Niels Lepperhoff Geschäftsführer, XAMIT Bewertungsgesellschaft mbH, Düsseldorf | 12. Kapitel |
| Josef Limper Rechtsanwalt, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht und für Steuerrecht, Wirtschaftsmediator, Wülfing Zeuner Rechel, Rechtsanwälte Steuerberater, Köln | 32. Kapitel |
| Sebastian Möllmann Rechtsanwalt, Legal & Business Affairs, Brainpool TV GmbH, Köln; Scheuermann Westerhoff Strittmatter Rechtsanwälte, Köln | 33. Kapitel, 34. Kapitel (zusammen mit Bießmann) |
| Dr. Christoph J. Müller Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Köln | 16. Kapitel |
| Sara Ohr Ass. Jur., Kölner Forschungsstelle für Medienrecht, TH Köln | 11. Kapitel (zusammen mit Schwartmann) |
| Prof. Dr. Christian Russ Rechtsanwalt, Notar, Fuhrmann Wallenfels, Wiesbaden; Lehrbeauftragter Universität Mainz und Fachhochschule Wiesbaden | 28. Kapitel |
| Michael Schmittmann Rechtsanwalt, Heuking Kühn Lüer Wojtek, Partnerschaft mbB von Rechtsanwälten und Steuerberatern, Düsseldorf; Lehrbeauftragter Universität Hannover | 10. Kapitel (zusammen mit Brock) |
| Dr. Matthias Schulenberg, LL.M. (Wisconsin-Madison) Rechtsanwalt, Syndikusrechtsanwalt, Köln | 9. Kapitel |
| Prof. Dr. Rolf Schwartmann Leiter der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht, TH Köln | 1. Kapitel, 2. Kapitel (zusammen mit Lamprecht-Weißenborn), 3., 4., 7. Kapitel, 11. Kapitel (zusammen mit Ohr) |
| Prof. Dr. Stefan Sporn Rechtsanwalt, Senior Vice President International Distribution, RTL International GmbH, Köln | 27. Kapitel (zusammen mit Hentsch) |
| Dr. Frederic Ufer Rechtsanwalt, Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten (VATM) e.V., Köln | 19. Kapitel |
Zitiervorschlag:
Schwartmann/Gennen Praxishandbuch Medienrecht, 21. Kap. Rn. 5
Inhaltsübersicht
Vorwort
Vorwort zur 1. Auflage
Bearbeiterverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Teil Medienrecht
Rundfunkrecht
1. KapitelRahmenbedingungen der Rundfunkregulierung
2. KapitelRundfunk im internationalen Recht
3. KapitelRundfunkrechtliche Grundlagen
4. KapitelÖffentlich-rechtlicher Rundfunk
5. KapitelPrivater Rundfunk
6. KapitelRecht der Werbung in Rundfunk und Presse
7. KapitelJugendschutzrecht
8. KapitelRundfunktechnik und Infrastrukturregulierung
Presserecht
9. KapitelPresse- und Äußerungsrecht, insbesondere Recht der Wort- und Bildberichterstattung
Telemedienrecht
10. KapitelTelemedien
Soziale Medien
11. KapitelRechtsfragen beim Einsatz sozialer Medien
12. KapitelTechnische Aspekte des Einsatzes von Social Media
Sondergebiete des Medienrechts
13. KapitelKartellrecht und Medien
14. KapitelWettbewerbsrecht und Medien
15. KapitelMedienrecht und Sport
16. KapitelArbeitsrecht und Medien
17. KapitelRecht der deutschen und europäischen Kulturförderung
18. KapitelGrundzüge der Justizberichterstattung und der Öffentlichkeitsarbeit der Justiz
2. Teil Telekommunikationsrecht
19. KapitelTelekommunikationsrecht
3. Teil Datenschutzrecht
20. KapitelDatenschutzrecht
4. Teil Informationstechnikrecht
21. KapitelIT-Vertragsrecht
22. KapitelGrundlagen des elektronischen Geschäftsverkehrs, Internetrecht
23. KapitelIT-Strafrecht
5. Teil Vergaberecht
24. KapitelÜbersicht über das Vergaberecht
25. KapitelÜbersicht über das IT-Vertragsrecht der öffentlichen Auftraggeber
6. Teil Urheberrecht und benachbarte Rechtsgebiete
26. KapitelUrheberrecht und Leistungsschutzrechte
27. KapitelRecht der Verwertungsgesellschaften
28. KapitelUrheberrecht und Verlagsrecht
29. KapitelUrheberrecht und Software
30. KapitelIT-Immaterialgüterrecht, Kennzeichen- und Domainrecht
31. KapitelFilm- und Fernsehvertragsrecht
32. KapitelMusikrecht
33. KapitelMusik in Film und Fernsehen
34. KapitelUrheberrechtsverletzungen – zivilrechtliche und strafrechtliche Konsequenzen
Stichwortverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Vorwort zur 1. Auflage
Bearbeiterverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Teil Medienrecht
Rundfunkrecht
1. KapitelRahmenbedingungen der Rundfunkregulierung
I.Wirtschaftliche Anforderungen an die Rundfunkregulierung
II.Überblick über das System der Rundfunkregulierung
1.Regulierung der Inhalte
2.Regulierung von Verbreitungsentgelten
3.Regulierung der Infrastruktur
4.Regulierung der Empfangstechnik
5.Regulierung von Nutzungsentgelten
III.Neuordnung der Rundfunkregulierung in Zeiten von Digitalisierung und Konvergenz
1.Bedürfnis zur Anpassung bisheriger Regelungsstrukturen
2.Einheitliche Regulierung von Rundfunk und Telemedien
3.Aktuelle Regulierungsansätze
IV.Ansätze zur Deregulierung
1.Regulierungsziele und Regulierungsinstrumente
2.Regulierungskriterien
2. KapitelRundfunk im internationalen Recht
I.Rundfunk im Völkerrecht
1.Allgemeines universelles Völkerrecht
2.Wirtschaftsvölkerrecht
2.1Recht der Fernmeldeunion und Frequenzverwaltung
2.2Recht der WTO
3.Recht des Europarates
II.Rundfunkregulierung im Recht der Europäischen Union
1.Primärrecht
2.Sekundärrecht
2.1Audiovisueller Bereich
2.2Benachbarte Regelungsbereiche
3. KapitelRundfunkrechtliche Grundlagen
I.Entwicklung des Rundfunkrechts
II.Rundfunk im Grundgesetz
1.Rundfunkfreiheit
2.Rundfunkbegriff
2.1Der klassische Rundfunkbegriff
2.2Rundfunkbegriff und Neue Medien
2.2.1Strukturprobleme des Rundfunkbegriffs
2.2.2Onlinedienste als Rundfunk
2.2.2.1Verfassungsrechtliche Einordnung
2.2.2.2Einfachgesetzliche Einordnung
2.2.2.3Reformwille bei Streaming TV im Internet – Anzeigepflicht anstatt Lizenz
3.Meinungsfreiheit
3.1Schutzbereich
3.2Schranken
3.3Schranken-Schranken
4.Träger der Rundfunkfreiheit
5.Schutzbereich und Schranken der Rundfunkfreiheit
6.Rundfunkrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
7.Institutionelle Garantien
8.Dienende und ausgestaltungsbedürftige Rundfunkfreiheit
9.Staatsferne
III.Rundfunk im einfachen Recht
1.Rundfunkstaatsverträge
2.Weiteres Landesrecht, insbesondere Rundfunk-/Mediengesetze
4. KapitelÖffentlich-rechtlicher Rundfunk
I.Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
II.Organisation und Aufsicht
1.Aufsichtsgremien
1.1Rundfunkrat (Fernsehrat)
1.2Verwaltungsrat
1.3Zusammensetzung der Aufsichtsgremien
1.3.1Problemstellung
1.3.2Fehlende Staatsferne
1.3.3Gleichheitssatz
2.Intendant
3.Prozessuale Fragen
III.Programmauftrag
1.Klassischer Programmauftrag
2.Programmauftrag und Neue Medien
2.1Online-Aktivitäten
2.2Programmauftrag für Onlinedienste
2.2.1Europarechtliche Einordnung
2.2.2Verfassungsrechtliche Einordnung
2.2.3Einfachgesetzliche Einordnung
2.2.3.1Programmauftrag
2.2.3.2Telemedien nach § 11d RStV
2.2.3.3Drei-Stufen-Test
IV.Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
1.Beitragsfinanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
1.1Die ehemalige Rundfunkgebühr
1.2Der Rundfunkbeitrag als neues Modell der Rundfunkfinanzierung
1.3 Rundfunkfinanzierung in der beihilferechtlichen Einschätzung der Europäischen Kommission
1.4 Finanzgewährleistungsanspruch nach nationalem Recht
1.4.1Verfassungsrechtliche Vorgaben im Dualen System
1.4.2Sicherung durch Verfahren
2.Sonstige Finanzierungsquellen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
3.Kommerzielle Betätigung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
5. KapitelPrivater Rundfunk
I.Grundsätzliches
II.Die Besonderheiten des privaten Rundfunkrechts
III.Rechtsgrundlagen des privaten Rundfunkrechts
IV.Regulierungsbehörden im privaten Rundfunk
1.Landesmedienanstalten
2.Zusammenarbeit der Landesmedienanstalten
2.1Zusammenarbeit in der ALM
2.2Organe
2.3Gemeinsame Geschäftsstelle
V.Regulierungsfelder
1.Zulassung
1.1Zulassungsbedürftigkeit
1.2Vorgaben an den Veranstalter
1.3Anforderungen an das Programm
1.4Wirtschaftliche und organisatorische Leistungsfähigkeit
1.5Einhaltung der Regelungen zur Sicherung der Meinungsvielfalt
1.6Sonderfall Teleshopping
VI.Zugang zu Übertragungskapazitäten – §§ 50 ff. RStV
VII.Aufsicht über den privaten Rundfunk
1.Werberegelungen
2.Programmgrundsätze
3.Gewinnspiele
6. KapitelRecht der Werbung im Rundfunk
A.Die Werbung in den Medien
B.Werbung und Wettbewerbsrecht
I.Die UWG-Novellen 2004, 2008 und 2015
II. Anwendbarkeit des UWG
1.Geschäftliche Handlung und objektiver Zusammenhang
2.Vor der Novelle 2008: Wettbewerbsförderungsabsicht
III.Verbot unterschwelliger Werbung
IV.Verbot getarnter Werbung
V.Formen getarnter Werbung
1.Allgemeines
2.Redaktionelle Werbung/Schleichwerbung
3.Produktplatzierung
VI.Rechtsfolgen
C.Werbung im Rundfunk
I.Die Trennung von Werbung und Programm und Erkennbarkeit
II.Schleichwerbung
1.Indizien für Schleichwerbung
2.Redaktionelle Veranlassung
III.Produktplatzierung
1.Begriff der Produktplatzierung
2.Voraussetzungen einer zulässigen Produktplatzierung
2.1Genres
2.2Kennzeichnungspflichten
2.3Themenplatzierung
IV.Teleshopping
V.Sponsoring
1.Sendungssponsoring
2.Ereignissponsoring
3.Titelsponsoring
VI.Virtuelle Werbung
VII.Besondere Formen von Werbung und medialer Einbindung
1.Gewinnspiele
2.Ausstatterhinweise
3.Regionalisierung und Personalisierung von Werbung
4.Kombination verschiedener Werbeformen
VIII.Dauerwerbesendung
IX.Einfügung und zulässiger Umfang der Werbung
1.Gesamtdauer der Werbung
2.Einfügung der Werbung
3.Split Screen
X.Hinweise auf eigene Programme, Begleitmaterial, Social Advertising und Wahlwerbung
XI.Verstöße
D.Werbung in Telemedien
I.Technische Regulierung im Telemediengesetz
II.Inhaltliche Regulierung im Rundfunkstaatsvertrag
E.Werbung und Jugendmedienschutz
F.Herausforderungen der Werberegulierung
7. KapitelJugendschutzrecht
A.Schutzpflichten des Staates
B.Schutzpflichten Privater
I.Einführung von Internetfiltern
II.Kritik
III.Verantwortlichkeit der Provider
C.Gesetzliche Ausgestaltung
I.Gesetzgebungskompetenzen
II.Das Jugendschutzgesetz
1.Anwendungsbereich
2.Alterskennzeichnung
3.Liste jugendgefährdender Medien (Indizierung)
III.Der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag
1.Anwendungsbereich (Zweck des Vertrages)
2.Klassifizierung von Angeboten
2.1Unzulässige Angebote (§ 4 JMStV)
2.2Entwicklungsbeeinträchtigende Angebote (§ 5 JMStV)
2.3Besonderheiten bei Werbung und Teleshopping (§ 6 JMStV)
2.4Rechtsfolgen
3.Novellierung des JMStV
3.1Gescheiterte Novellierung 2010/2011
3.2JMStV 2016
D.Aufsicht
I.Aufsicht nach dem Jugendschutzgesetz
1.Landes- und Bundesbehörden
2.Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM)
3.Die freiwillige Selbstkontrolle
II.Aufsicht nach dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag
1.Der Jugendschutzbeauftragte
2.Die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM)
3.Zusammenarbeit von KJM und Freiwilliger Selbstkontrolle
3.1Aufgabe der freiwilligen Selbstkontrolle am Beispiel der FSM
3.2Ablauf das Prüfverfahrens
3.3Umfang und Grenzen des Beurteilungsspielraums der Freiwilligen Selbstkontrolle
8. KapitelRundfunktechnik und Infrastrukturregulierung
I.Einführung
II.Digitalisierung
1.Politische Bedeutung
1.1Die Digitalisierung von Programminhalten
1.2Multiplexing
2.Bilddarstellung
2.1High Definition Television (HDTV)
2.2Bildformate
2.3Regulierung von Breitbildformaten
III.Verbreitungsinfrastrukturen
1.Terrestrik
1.1Übertragungstechnik
1.2Rechtliche Rahmenbedingungen
2.Satellit
2.1Übertragungstechnik
2.2Rechtliche Rahmenbedingungen
3.Kabel
3.1Übertragungstechnik
3.2Rechtliche Rahmenbedingungen
3.2.1Rundfunkrechtliche Regulierung
3.2.2Wettbewerbsrechtliche Regulierung
3.2.3Urheberrechtliche Regulierung
4.Internet – IPTV
4.1Übertragungstechnik
4.2Rechtliche Rahmenbedingungen
5.Mobilfunknetze
5.1Übertragungstechnik
5.2Rechtliche Rahmenbedingungen
IV.Verschlüsselungs- und Empfangstechnik
1.Zugangsberechtigungssysteme
1.1Zugangsberechtigungssysteme: Nutzen und Technik
1.2Regulierung von Zugangsberechtigungssystemen
2.Digitale Empfangsgeräte
2.1Anwendungs-Programmierschnittstelle (API)
2.1.1Funktionsweise
2.1.2Regulierung
2.2Common Interface
3.Navigator und Electronic Programme Guide (EPG)
3.1Funktionsweise
3.2Regulierung
Presserecht
9. KapitelPresse- und Äußerungsrecht, insbesondere Recht der Wort- und Bildberichterstattung
A.Die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen in der Wort- und Bildberichterstattung
I.Die Freiheitsrechte des Art. 5 Abs. 1 GG
1.Meinungsäußerungsfreiheit
2.Informationsfreiheit
3.Pressefreiheit
4.Rundfunkfreiheit
5.Filmfreiheit
II.Die Ausstrahlungswirkungen der Grundrechte aus Art. 5 Abs. 1 GG auf die zivilrechtliche Betrachtung der Wort- und Bildberichterstattung
III.Die Grundrechtsschranken nach Art. 5 Abs. 2 GG
IV.Das Zensurverbot
V.Die Kunstfreiheit und ihre Ausstrahlungswirkung auf die zivilrechtliche Betrachtung der Wort- und Bildberichterstattung
B.Die Wortberichterstattung
I.Grundsätzliches
1.Ermittlung des Aussagegehalts einer Äußerung
1.1Empfängerverständnis
1.2Berücksichtigung des Verständnisses aufgrund des Mediums
1.3Kontextbetrachtung
1.4Offene und verdeckte Äußerungen
1.5Rechtsbegriffe und andere Begrifflichkeiten
1.6Mehrdeutige Darstellungen
1.7Verdacht, Zweifel, Gerüchte
1.8Fragen
1.9Zitate
1.10Satire
1.11Erkennbarkeit bei der Wortberichterstattung
2.Tatsachenbehauptung oder Meinungsäußerung
2.1Kriterien der Abgrenzung
2.2Einzelfälle
3.Behaupten und Verbreiten
3.1Behaupten
3.2Verbreiten
3.3Sich-zu-eigen-machen, sich distanzieren
II.Die Verletzung von Rechten Dritter durch die Wortberichterstattung
1.Persönlichkeitsrechte
1.1Die Rechtsgrundlagen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts