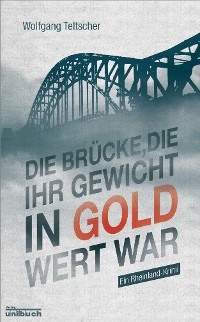Czytaj książkę: «Die Brücke, die ihr Gewicht in Gold wert war»
Wolfgang Teltscher
DIE BRÜCKE, DIE IHR GEWICHT IN GOLD WERT WAR
Ein Rheinland-Krimi

© 2017 zu Klampen Verlag · Röse 21 · 31832 Springe
Satz: Germano Wallmann · Gronau · www.geisterwort.de
Umschlaggestaltung: © Hildendesign · München · www.hildendesign.de
Bildmotiv: © wikimedia commons,
Foto: Unbekannt (US-amerikanischer Armeeangehöriger)
ISBN 978-3-934900-45-5
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.dnb.de› abrufbar.
Die Brücke ist ihr Gewicht in Gold wert.
Aussage von General Eisenhower, nachdem die Brücke
von Remagen am 7. März 1945 von alliierten Truppen
eingenommen wurde.
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Textbeginn
Der Autor
Was er mit dem Rest des Tages anfangen sollte, wusste er nicht. Es lohnte sich auch nicht, darüber nachzudenken, denn es war nicht mehr viel davon übrig. Also saß er in seinem alten VW und döste vor sich hin. Nachts stellte er oft sein Auto auf diesem Gelände um das alte Gebäude ab. Das kostete nichts und ersparte ihm die Suche nach einem Parkplatz. Sein Zuhause war eine Zweizimmerwohnung mit Kochnische in einem unspektakulären älteren Haus, dessen andere Zimmer von dem Eigentümer bewohnt wurden. Ein Parkplatz war nicht Teil seiner Miete. Er würde gern so komfortabel wie die meisten Leute in Remagen wohnen, konnte sich eine bessere Wohnung jedoch wegen ständiger finanzieller Engpässe nicht leisten. Zu den wenigen Freuden, die sein bisheriges Leben lebenswert gemacht hatten, gehörten zwei Freundinnen, aber beide Beziehungen hatten nur kurz angedauert. Das hatte vor allem an ihm selbst gelegen, das hatte er ohne Bedauern akzeptiert, er hatte einer Frau nämlich nicht bieten können, was sie von ihrem Mann erwarten durfte. Er hatte sich daher damit abgefunden, allein durch das Leben zu gehen. Natürlich wäre es schön, jemanden für regelmäßigen Sex zu haben, aber was nicht war, war halt nicht, und für den Notfall gab es ja auch andere Möglichkeiten.
Er blickte durch die Windschutzscheibe. Es fing an zu nieseln, ein weiterer Grund, im Auto sitzen zu bleiben. Der Mai war vor einer Woche gekommen, die Nächte waren jetzt mild genug, dass man es ohne laufenden Motor und Heizung im Wagen aushalten konnte.
Das alte Gebäude, das vor ihm aufragte, sollte vor dem Krieg eine Klosterschule gewesen sein. Das war lange vor seiner Zeit gewesen. Aus den oberen Stockwerken müsste man damals freie Sicht auf den Rhein gehabt haben, das war bestimmt romantisch. Heute wurde die Sicht durch Bäume versperrt, die über die Jahre unkontrolliert in die Höhe gewachsen waren. Auf der anderen Seite des Gebäudes führte eine Bundesstraße den Hang entlang, daneben Eisenbahngleise, auf denen ununterbrochen Passagier- und Güterzüge nach Bonn im Norden oder Koblenz im Süden ratterten. Dieser Verkehr hatte von der Romantik am Rhein nicht viel übrig gelassen.
Bis zum Ende des Krieges war das Haus von den Nazis für einen gemeinnützigen Zweck zweckentfremdet worden, gemeinnützig jedenfalls im Sinne der Nazis. Was sich genau während des Krieges hinter seinen Mauern abgespielt hatte, hatten die Menschen in der Gegend weitgehend aus ihrer Erinnerung gelöscht. Kurz nach dem Krieg hatte sich angeblich eine Hosenfabrik vorübergehend darin niedergelassen, deren Fabrikgelände in Köln durch Bomben dem Erdboden gleichgemacht worden war. Ob das stimmte, konnte er nicht beschwören, aber es interessierte ihn auch nicht. Auf jeden Fall war das Haus Ende der fünfziger oder Anfang der sechziger Jahre von der Bundeswehr übernommen worden.
Außer den Musterungen, die darin stattfanden, hatte die Bundeswehr damals ein Institut hier eingerichtet, das mit Medizin und Statistiken zu tun hatte. Soldaten, Ärzte und Zahlenreihen, eine komische Mischung, er konnte sich darunter nichts Rechtes vorstellen. Der Komplex war in dieser Zeit von einem Gitter umgeben und nicht für die Öffentlichkeit zugänglich gewesen.
Nachdem der Kalte Krieg vorbei war, und die Bundeswehr sich neu organisieren musste, hatte sich das Institut offensichtlich erübrigt. Das große Haus und das dazugehörende Gelände gammelten nun seit Jahren vor sich hin. Die Zukunft des Anwesens lag im Dunklen, so dunkel, wie es der heutige Abend war. Das war ihm nur recht. Solange hier keiner wohnte oder arbeitete, konnte er sein Auto unbehelligt auf dem Gelände abstellen. Niemanden kümmerte es, dass das Einfahrtstor zur Straße offen stand, denn es gab hier nichts mehr zu holen, für das es sich lohnte, ein Tor zu verschließen.
Sein Blick fiel auf die steile felsige Wand, die sich hinter und seitlich des Gebäudes in die Höhe zog. Sie war mit Büschen überwachsen, wirkte unheimlich und bedrohlich. Er parkte sein Auto stets nahe der Felswand am Ende des Grundstücks, aber er war noch nie auf die Idee gekommen, den Hang in näheren Augenschein zu nehmen. Er hatte keine Sorge, dass sein Auto gestohlen werden könnte, dafür war es zu alt, verbeult und zerkratzt. Wenn es trotzdem jemand stehlen sollte, hoffte er, würde die Versicherung ihm dafür mehr zahlen, als es noch wert war.
Er schreckte auf. Eine Person ging an seinem Auto vorbei. Er duckte sich in seinen Sitz, weil er keine Lust hatte, entdeckt zu werden und eine Diskussion führen zu müssen, ob er hier parken durfte oder nicht. Die Person leuchtete den Boden mit einer Taschenlampe ab, ein runder Lichtfleck torkelte vor ihr her. Es war ein Mann, so viel konnte er erkennen. Der Mann ging an dem Auto vorbei auf den Hang zu, er schien das Auto nicht wahrzunehmen, und falls doch, ignorierte er es. Er wusste offensichtlich nicht, dass er beobachtet wurde, und schaute weder nach links noch nach rechts. Dann verschwand er nur wenige Meter entfernt zwischen den Sträuchern. Vielleicht war das ja der Platz, wo er manchmal zum Pinkeln hinging, wenn er es nicht bis nach Hause schaffte.
Der Mann im Auto wartete darauf, dass der Fremde wieder aus den Büschen hervorkam. Nichts geschah. Er fragte sich, ob er vielleicht eingeschlafen und es nur ein Traum gewesen war, als er glaubte, eine Person gesehen zu haben.
Nein, sagte er sich, ich habe deutlich das Licht der Taschenlampe gesehen, wie es auf dem Boden entlang gehüpft und dann zwischen den Büschen verschwunden ist. So etwas träumt man nicht.
Er war nervös und entschied sich, erst einmal eine Zigarette zu rauchen. Minuten verstrichen und immer noch tat sich nichts. Es war, als hätte sich der andere Mann in Luft aufgelöst. Es musste also einen Weg geben, der hinter den Sträuchern an dem Hang entlang ging oder einen Tunnel, der in den Hang hinein führte. Der Mann im Auto war sich sicher, dass er keinen Geist gesehen hatte. Geister haben keine Taschenlampen.
Wie schön es hier ist, freute er sich, wie schön, dass ich hier wohnen darf.
War das die Wahrheit oder belog er sich, weil er seine Gefühle nicht zugeben wollte? Wenn er ehrlich war, vermisste er Niedersachsen, den Ort, wo er aufgewachsen war und die längste Zeit seines Lebens verbracht hatte. Nein, schöner als im Rheinland ist es dort oben im Norden nicht, dachte er, nicht nach der allgemeinen Vorstellung von Schönheit. Aber was schön ist, ist Ansichtssache, das liegt ausschließlich in persönlichem Empfinden.
Kommissar Erhard Marder hatte sich auf eine Bank gesetzt und schaute nun dem Fluss zu. Vor einer Woche wäre das unmöglich gewesen, da hatte der Rhein mit seinem Hochwasser den Weg am Ufer überschwemmt, der normalerweise für Fußgänger und Radfahrer reserviert war. Nun hatte der Fluss wieder Vernunft angenommen und sich in sein Bett zurückgezogen.
Auch im Norden hatte er an einem großen Fluss gelebt. Nördlich von Hamburg, nicht weit von Stade, war die Elbe ein mächtiger Strom, deutlich gewaltiger als der Rhein bei Remagen. Es war jedoch nicht die Größe oder Breite der beiden Flüsse, die den wesentlichen Unterschied zwischen ihnen ausmachte. Der Unterschied waren die Flüsse selbst und alles, was sie umgab. Landschaft, Menschen, Städte und Dörfer.
Der Rhein floss Tag und Nacht unaufhaltsam in die gleiche Richtung, nur der Pegelstand änderte sich je nach Wetterlage, langsam, ohne dass man genau voraussehen konnte, wann er seinen Höchst- oder Tiefststand erreichen würde. Am Unterlauf der Elbe wechselte die Richtung des Wassers zweimal täglich, bei Ebbe strebte das Wasser ins Meer hinaus, bei Flut kam es zurück. Wenn starke Stürme aus dem Norden das Wasser in den Fluss drückten, drohten dem Land Überflutungen. Zum Glück gab es Deiche, die das regelten. Das war nicht immer so gewesen, früher hatten die Menschen bei Sturmfluten oft ihr Hab und Gut verloren. Aber solange er dort gelebt hatte, hatten die Deiche stets dem Wasser standgehalten. Als 1953 die letzte große Sturmflut über das Land an der Elbe hereingebrochen war, war er gerade erst geboren worden, und diese Katastrophe war noch nicht in seine Erinnerung aufgenommen.
Er liebte die Landschaft seiner Kindheit. Das Land kam flach bei den Deichen an, auf der anderen Seite der Elbe ging es ebenso flach weiter. Entwässerungskanäle unterteilten die Wiesen, auf denen Obstbäume standen, dazwischen weideten Kühe. Auf den Deichen grasten Schafherden. Viele Dörfer und Städte reichten nicht einmal bis an den Fluss, sie riegelten sich in sicherer Ferne durch Siele gegen Sturm und Fluten ab. Das war die Welt, wie er sie kannte, und er hatte als Kind geglaubt, dass sie überall so war.
Am Rhein waren die Städte romantischer als an der Elbe, sie schmiegten sich an die Ufer des Flusses und zogen sich in die Hügel hinauf. Die Sicht auf die Ortschaften von den Schiffen her wurde meistens von einer stattlichen Kirche beherrscht, die über die Häuser an der Promenade ragte. Er musste sich eingestehen, dass er diese Landschaft schön und reizvoll fand. Was ihn anfangs gestört hatte, waren die Busse mit Touristen, deren Insassen sich über die Städte an den Ufern ergossen. Aber er hatte inzwischen gelernt, das zu akzeptieren, denn ohne diese Besucher müssten die meisten Restaurants und Eisdielen am Fluss schließen, vor denen er gern in der Sonne saß.
An den Ufern der Unterelbe sah man Touristenbusse selten, das Blöken der Schafe war oft das lauteste Geräusch. Wenn sie nicht im Freien, sondern im Stall waren, und kein Sturm herrschte, war es unendlich still. Das war beruhigend, aber wenn er ehrlich war, war ihm diese Ruhe manchmal auf die Nerven gegangen. Dann hatte er sich gefragt, wo der Rest der Menschheit hingekommen war.
Was der Rhein und die Elbe gemeinsam hatten, waren Schiffe. Allerdings konnten diese nicht unterschiedlicher sein. Die auf der Elbe hatten einen Größenvorteil. Die neue Generation der Übersee-Frachter beförderte oft Tausende von Containern zwischen Hamburg und den Häfen der Weltmeere. Diese Containerschiffe hatten die Seefahrt und den weltweiten Handel revolutioniert und dabei die Romantik aus der christlichen Seefahrt vertrieben. Der Gedanke, was alles im Meer verschwinden würde, wenn so ein Schiff unterging, konnte einem Angst und Schrecken einjagen. Das sollte Gott verhüten, was er aber nicht immer getan hatte, es war schon mehr als einmal passiert. Die Containerschiffe, die den Rhein hinauf- und hinunterzockelten, hatten in den letzten Jahren ebenfalls an Länge und Breite zugelegt. Im Vergleich zu ihren großen Brüdern, die die Ozeane befuhren, wirkten sie dennoch wie Spielzeugschiffe.
Marder und seine Frau hatten sich bewusst entschieden, ins Rheinland zu ziehen. Er hatte länger gebraucht, als er erwartet hatte, sich auf das Leben in seiner neuen Heimat einzustellen. Er hatte nicht voraussehen können, dass ihn an manchen Tagen, noch mehr in manchen Nächten, wenn er nicht einschlafen konnte, die Sehnsucht nach dem flachen Land einholen würde. Er hätte nie geglaubt, dass er den ständigen Wind aus Nord/Nordwest, auf den er oft geschimpft hatte, vermissen würde.
Seine Frau hatte sich mit der Umstellung leichter getan, es schien ihr von Anfang an zwischen den Menschen im Rheintal zu gefallen. Das gab sie auch unumwunden zu. Sie hatte schnell Anschluss gefunden, im Fitnessclub und in der Kirchengemeinde hatte sie Freundinnen gemacht, mit denen sie sich gern in einem der Cafés der Stadt zum Plaudern und Schlemmen traf. Als sie einmal erwähnte, was eine dieser Frauen über ihre Pänz berichtet hatte, hatte er sie hilflos angeschaut. Er musste sich erst erklären lassen, dass mit Pänz Kinder gemeint sind. Und das war nicht das einzige Wort, das er neu lernen musste.
Sein Arbeitsplatz hatte sich bisher als so wenig aufregend herausgestellt, wie er es sich erhofft hatte. In kleinen Städten wie Remagen gab es eben meistens nur kleine Kriminalität, die von kleinen Verbrechern begangen wurde. Er war sich jedoch bewusst, dass das nicht immer so bleiben musste, denn manchmal schwappte das Verbrechen auch in freundliche und friedliche Orte, wo man nicht darauf vorbereitet war. Auch Remagen war davon nicht verschont geblieben. Vor fast zwanzig Jahren hatte es einen brutalen Raubmord in der Stadt gegeben, dem vier Menschen zum Opfer gefallen waren. Dieses Verbrechen hatte die Menschen zutiefst erschüttert, aber es war nun Teil der Geschichte des Ortes, und das tägliche Leben war längst wieder zur Normalität einer beschaulichen Kleinstadt zurückgekehrt.
Der Kommissar erhob sich. Das Entenpaar, das sich in seiner Nähe niedergelassen hatte, sprang verschreckt auf, lief aufgeregt zur Kante der Promenade und überlegte, ob es sich ins rettende Wasser stürzen sollte. Da Marder sich ihnen nicht weiter näherte, ließen sie es sein. Die Sonne hatte sich hinter einer Wolke versteckt, die über der Eifel aus dem Westen heranrückte und das linke Rheinufer in Schatten hüllte, während die weißen Häuser auf der anderen Seite des Flusses noch im Sonnenlicht glänzten. Er schlenderte flussaufwärts und wäre dabei fast von einem Radfahrer in bunter Renntracht über den Haufen gefahren worden. Er entschuldigte sich bei dem Mann, obwohl es eigentlich dessen Pflicht gewesen wäre, dies zu tun.
Er erreichte die Endtürme der ehemaligen Ludendorff-Brücke. Auf beiden Seiten des Rheins standen sie schwarz und beherrschend. Es schien, als blickten sie sich über den Fluss starr an, als hätten sie ein gemeinsames Geheimnis, über das sie nicht sprechen wollten. Die Brücke, die die Türme einmal verbunden hatte, war vor vielen Jahren ins Wasser gestürzt. In ihrer dunklen und unbeweglichen Wucht waren sie eine stumme Mahnung an die Menschheit, dass Kriege nie Brücken schlugen, sondern zerstörten. Er blieb stehen, betrachtete auf einer Tafel die in Erz gegossenen Schilderungen der Ereignisse am Ende des Zweiten Weltkrieges. Welche Tragödien hatten sich hier abgespielt, welche Hoffnungen wurden hier zu Grabe getragen? Gut, dass das die Vergangenheit war. Es wurden damals, nachdem dieser große Krieg vorüber war, aber auch Hoffnungen geboren, von denen sich eine Reihe erfüllt hatte. Marder war dankbar, dass er das Glück gehabt hatte, nicht eine Generation früher auf die Welt gekommen zu sein. Mit diesem Gedanken und der Zuversicht auf eine Zukunft in Frieden entschloss er sich, nach Hause zu gehen.
D urch die Einnahme der Brücke von Remagen durch amerikanische Truppen wurde der Zweite Weltkrieg nicht entschieden, da er es im Winter 1945 bereits war, nach Ansicht mancher Historiker jedoch um Wochen oder sogar Monate verkürzt.
In Erpel, gegenüber von Remagen, auf der rechten Seite des Rheins, waren damals deutsche Einheiten stationiert, die im Eisenbahntunnel am Ende der Brücke eine Verteidigungsposition errichtet hatten. Ihre Aufgabe sollte es sein, die Amerikaner am Überqueren des Flusses zu hindern, falls sie je bis zum westlichen Ufer des Rheins vorstoßen sollten. Das war nach den Verlautbarungen der deutschen Militärführung jedoch kaum zu befürchten, der Feind würden lange vorher weit im Westen besiegt worden sein.
Einer der in Erpel eingesetzten Offiziere war kein ehrlicher Mann. Vor der Nazizeit hatte er mehrmals wegen Betrügereien in Haft gesessen, da er aber als einer der Ersten in seiner Stadt der NSDAP beigetreten war, hatte man sein Vorstrafenregister bereinigt. Danach war sein Aufstieg in eine Offiziersposition in der deutschen Wehrmacht nicht mehr aufzuhalten. Er kannte natürlich die Volkssagen um den Nibelungenschatz, aber auch er wusste nicht, wo dieser auf dem Grund des Rheins ruhte. Er plante daher, sich selbst einen Schatz zu schaffen. Um das zu erreichen, betrog er nicht nur die Menschen am Rhein, sondern das gesamte deutsche Volk.
Er suchte Häuser oder Wohnungen in der Umgebung der Brücke auf, die den Eindruck machten, von wohlsituierten Menschen bewohnt zu sein. Er ließ die Leute mit großem Nachdruck wissen, dass er von der Obersten Heeresleitung beauftragt sei, Schmuckstücke wie Goldringe, Halsketten, Armbänder oder Ähnliches einzusammeln. Das sei notwendig, um die Wehrkraft des deutschen Heeres zu stärken, und sie würden für ihre Opfer nach Ende des Krieges reichlich belohnt werden. Drei ihm untergeordnete Soldaten waren als Handlanger in seine Machenschaften eingeweiht. Sie gaben ihren Opfern zu verstehen, dass jeder Widerstand zwecklos sei, der Führer erwarte in dieser schweren Stunde des deutschen Volkes von jedem einen Beitrag zum Gelingen des baldigen Endsieges. Niemand wagte, sich diesen Anordnungen zu widersetzen, niemand wollte seine Familie in Gefahr bringen, weil er zu hartnäckig an weltlichen Gütern hing.
Im Laufe der letzten Kriegswochen war durch diese verbrecherische Aktion einiges an Werten zusammengekommen. Die ergaunerten Schmuckstücke waren mehr als ausreichend, um den Männern, vor allem dem Offizier, nach dem Krieg als Anfangskapital für einen Neubeginn zu dienen, egal, ob Deutschland verlieren oder gewinnen würde. Die Soldaten hatten im hinteren Bereich des Tunnels, in den die Gleise der Züge von der Brücke mündeten, eine Stelle ausgesucht, wo sie nachts ihre Beute heimlich verscharrten, mit der Absicht, diese nach Kriegsende ebenso heimlich wieder auszugraben. Dieser Plan funktionierte, zumindest der Teil, der davon ausging, dass keiner ihrer anderen Kameraden etwas von diesen nächtlichen Aktivitäten mitbekam.
Anfang März 1945 gelang es den Amerikanern, die Brücke zu erobern. Darüber waren sie selbst überrascht, denn zu diesem Zeitpunkt rechnete die alliierte Heeresführung nicht mehr damit, dass noch eine funktionsfähige Brücke über den Rhein existierte. Diese Tatsache ging später als das Wunder von Remagen in die Geschichte des Zweiten Weltkrieges ein. Die Brücke hatte allen Versuchen standgehalten, sie zu zerstören, obwohl sie, je nach Kriegslage, erst von Feind und dann von Freund bombardiert und beschossen worden war. Kurz bevor die Alliierten sie einnahmen, hatte sie einen letzten verzweifelten Sprengversuch der Deutschen überstanden. Man hatte jedoch nur minderwertigen Sprengstoff zur Verfügung, dazu lediglich die Hälfte der für diese Sprengung eigentlich notwendigen Menge, außerdem war das Zündkabel in einem schadhaften Zustand. Alles keine idealen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Sprengung. Die Brücke erhob sich nach der Zündung des Sprengstoffes kurz von ihren Sockeln, setzte sich dann wieder auf ihnen nieder und fiel nicht ins Wasser wie von den Deutschen geplant. Sie war zwar beschädigt, aber verwendungsfähig. Da die deutsche Führung Schuldige für diesen Misserfolg brauchte, wurden fünf Offiziere, die für die geplante Zerstörung zuständig gewesen waren, nach einem kurzen Prozess vor einem Standgericht hingerichtet.
Die Amerikaner überquerten den Rhein mit ihren Panzern trotz Beschuss ohne entscheidende Verluste. Viele deutsche Soldaten, die versucht hatten, die Brücke bis zur letzten Patrone zu verteidigen, gerieten in Gefangenschaft. Nach der Eroberung versuchten die Alliierten, den Schaden an der Brücke zu reparieren, um den nachrückenden Militäreinheiten den Übergang über den Rhein zu ermöglichen. Das gelang, wenn auch nur für eine Woche; aber das reichte den amerikanischen Streitkräften, um sich östlich des Rheins zu etablieren. Dann brach die Brücke zusammen infolge der Sprengschäden, Bombardierungen und der Belastung durch das Übersetzen von schweren Panzern. Nur die Endtürme an beiden Ufern blieben stehen. Einige Pfeiler im Fluss ragten noch für einige Jahre in die Höhe und hielten nutzlos gewordene Planken mit Eisenbahngleisen in der Luft. Zu diesem Zeitpunkt hatten die alliierten Truppen am Ufer in Erpel den Nachschub mit Pontonbrücken gesichert. Bei dem Zusammenbruch der Ludendorff-Brücke kamen über dreißig Menschen zu Tode, die meisten davon waren amerikanische Soldaten, aber auch Kriegsgefangene, die bei den Reparaturarbeiten eingesetzt wurden. Zu den Toten gehörte auch der Offizier, der sich die verbrecherische Beschlagnahme des Schmucks ausgedacht hatte.
Seine Gehilfen hatten ebenfalls nicht viel Glück. Keiner von ihnen kam in den Genuss des Schatzes, wie sie es sich bei ihrem bösen Tun ausgemalt hatten. Zwei der drei Soldaten wurden nach dem Verlust der Brücke von der Wehrmacht an andere Fronten geschickt. Einer von ihnen kam in den letzten unsinnigen Kriegstagen ums Leben, der andere geriet in russische Kriegsgefangenschaft und wurde nach Sibirien verschleppt, ohne dass man je wieder von ihm hörte. Beide hatten keine Möglichkeit gefunden, ihr Geheimnis um die vergrabenen Schätze preiszugeben.
Nur dem dritten, Engelbert Bergmeister, erging es besser. Er desertierte von der deutschen Wehrmacht, geriet jedoch ebenfalls in Kriegsgefangenschaft. Er wurde, wie viele seiner Kameraden, in dem Lager auf den Wiesen am Rhein zwischen Remagen und Sinzig untergebracht. Das war wegen der dort herrschenden Bedingungen ein hartes Los für alle Gefangenen, von denen viele nicht überlebten. Für Engelbert war es trotzdem ein glücklicher Umstand. Seine Familie kam aus Remagen und er hatte es nicht weit nach Hause, als er nach einigen Monaten aus dem Schlamm des Lagers entlassen wurde. In dieser Zeit hatte er sein Wissen um den vergrabenen Schmuck mit niemandem geteilt. Ende 1945 kehrte er in das Haus seiner Eltern in der Hermann-Göring-Straße zurück, die nun natürlich nicht mehr so hieß.