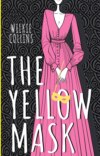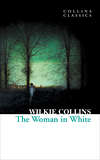Czytaj książkę: «Zwei Schicksalswege», strona 17
Sie hatte mir nie wieder geschrieben und seit unserer letzten Trennung war sie mir auch in meinen Träumen nie wieder erschienen. Sie war wohl ohne Zweifel mit ihrem Leben im Auslande ausgesöhnt. Ich verzieh ihr, dass sie mich vergessen hatte. Ich gedachte an sie und an Andere mit den versöhnlichen Gefühlen eines Menschen, dessen Geist schon dieser Welt entrückt ist und dessen Vorstellungen sich immer enger nur um den Gedanken an seinen eigenen Tod sammeln.
Das Auf- und Abgehen fing an mich zu ermüden. Die Einsamkeit des Ortes bedrückte mich. Meine Nerven wurden durch das Bewusstsein meiner eigenen Unentschlossenheit verstimmt. Endlich, nachdem ich noch einen langen Blick durch die Bäume auf den See geworfen hatte, kam ich zu einem festen Entschluss. Ich wollte versuchen, ob ein guter Schwimmer sich wirklich ertränken kann.
Vierunddreißigster Kapitel
Eine nächtliche Erscheinung
Ich kehrte in das Wohnzimmer des Häuschens zurück, zog einen Stuhl an das Fenster und schlug eine leere Seite meines Notizbuches aus. Um im Falle meines Todes meinen Testamentsvollstreckern manche Mühe und Ungewissheit zu ersparen, musste ich ihnen noch einige Weisungen geben. Indem ich meinen letztwilligen Bestimmungen die gewöhnliche Aufschrift »Notizen für meine Rückkehr nach London« als Deckmantel gab, begann ich zu schreiben.
Als ich eine Seite des Notizbuches beschrieben und die andere eben aufgeschlagen hatte, überkam mich eine gewisse Schwerfälligkeit, die mich hinderte, meine Gedanken auf dem Gegenstand, den ich vor hatte, zu richten. Sofort erinnerte ich mich eines ähnlichen Zustandes, der mich in Shetland befallen hatte. als ich mich vergebens bemühte, den Brief an meine Mutter zu verfassen, den Miss Dunroß für mich schreiben wollte. Durch den Vergleich, den ich zwischen damals und jetzt anstellte, wurden meine Gedanken jetzt, wie damals, auf meine letzten Erinnerungen an Frau van Brandt, gelenkt. Eine oder zwei Minuten später gewahrte ich wiederum die seltsame körperliche Empfindung, deren ich mir zum ersten Male in dem Garten bei Mr. Dunroß’s Hause bewusst wurde. Dasselbe geheimnisvolle Beben durchzitterte mich von Kopf bis Fuß. Ich blickte zwar wieder um mich, hatte aber kein klares Bewusstsein von den Gegenständen, auf denen meine Augen ruhten. Meine Nerven zitterten an diesem milden Sommerabende, als ob elektrische Strömungen in der Luft wären, denen ein Sturm folgen würde. Ich legte mein Notizbuch und Bleistift auf den Tisch und erhob mich, um wieder hinaus unter die Bäume zu gehen. Es erwies sich aber, dass selbst die kleine Anstrengung, das Zimmer zu durchschreiten, über meine Kräfte war. Ich stand an die Stelle gewurzelt und hielt mein Gesicht der offenen Tür zugewendet, durch die das Mondlicht hereinströmte.
Es verging eine Weile, da, als ich immer noch durch die Tür hinaussah, bemerkte ich, dass sich etwas, weit unten zwischen den Bäumen, die das Ufer des Sees einfassten, bewegte. Ich hatte zuerst den Eindruck, als ob zwei graue Schatten sich langsam durch die Baumstämme zu mir heranschlängelten. Allmälig aber gewannen die Schatten bestimmtere Umrisse, bis sie sich mir als zwei vollständig bekleidete Gestalten darstellten, von denen die eine größer war als die andere. Als sie näher und näher herankamen, verschwand die dunkelgraue Färbung um sie her. Sie wurden von einem ihnen eigenen, inneren Lichte sanft erhellt, als sie der geöffneten Tür näher traten. Ich stand zum dritten Male in der geisterhaften Gegenwart von Frau von Brandt und neben ihr an ihrer Hand erblickte ich eine zweite nie vorhergesehene Gestalt, es war die Erscheinung ihres Kindes.
So standen die Beiden Hand in Hand vor mir, selbst durch den hellen Mondschein hindurch umstrahlt von ihrem überirdischen Lichte. Das Antlitz der Mutter blickte mich wiederum mit den traurigen, stehenden Augen, deren ich mich so wohl erinnerte, an. Das unschuldige Antlitz des Kindes aber strahlte von einem engelhaften Lächeln. In unaussprechlicher Spannung erwartete ich das erste Wort, das sie sprechen, die erste Bewegung, die sie machen würden. Zuerst erfolgte die Bewegung. Das Kind ließ die Hand der Mutter los und, sich leise aufwärts hebend, schwebte es in der Luft als eine sanftstrahlende Erscheinung, die aus dem dunklen Hintergrunde der Bäume hervorleuchtete. Die Mutter glitt in das Zimmer und blieb vor dem Tische stehen, auf den ich mein Notizbuch und Bleistift niedergelegt hatte, als ich nicht mehr zu schreiben vermochte. Wie bei den früheren Malen nahm sie auch jetzt den Bleistift und schrieb auf die leere Seite, dann winkte sie mir wie früher, zu ihr zu kommen. Ich näherte mich ihrer ausgestreckten Hand und empfand wiederum die geheimnisvolle Wonne, als sie meine Brust berührte, wiederum hörte ich sie mit ihrer leisen, melodischen Stimme die Worte wiederholen: »Gedenke mein. Komm zu mir.« Ihre Hand sank zu meiner Brust herab. Das bleiche Licht, das mir ihre Gestalt enthüllt hatte, zitterte, erblasste und verschwand. Sie hatte gesprochen und war verschwunden. Ich ergriff das geöffnete Notizbuch und fand diesmal nur folgende Worte von der Geisterhand geschrieben:
»Folge dem Kinde.«
Ich sah in die einsame, nächtliche Landschaft wiederum hinaus. Dort, mild auf dem dunklen Hintergrunde der Bäume erglänzend, schwebte in der Luft noch immer die Erscheinung des Kindes im Sternenlichte.
Ohne es mir selbst klar bewusst zu sein, trat ich vor und überschritt die Türschwelle. Zwischen den Bäumen bewegte sich vor mir her die sanft leuchtende Gestalt des Kindes. Ich folgte ihm, als befände ich mich im Zauberbann. Die Erscheinung, die immer vor mir herschwebte, führte mich durch den Wald, an meiner alten Heimat vorbei, zurück zu den einsamen Nebenwegen, auf denen ich von dem Marktflecken nach dem Hause hergewandert war. Die lichte Gestalt des Kindes, die tief unten an dem wolkenlosen Himmel schwebte, hielt von Zeit zu Zeit still, als wir beide unseren Weg zurücklegten. Sein strahlendes Gesicht blickte lächelnd auf mich nieder, dann winkte es mit seiner kleinen Hand und schwebte wieder weiter, indem es mich geleitete, wie in alter Zeit der Stern den Weisen des Morgenlandes ihren Weg zeigte.
Ich erreichte die Stadt. Die Luftgestalt des Kindes hielt an und schwebte über dem Hause, wo ich am Abend meinen Reisewagen zurückgelassen hatte. Ich befahl, dass die Pferde zu einer weiteren Reise angespannt wurden. Der Postillon erwartete meine weiteren Bestimmungen. Ich blickte aufwärts. Des Kindes Hand deutete südwärts, den Weg nach London entlang. Ich gab dem Manne den Befehl, nach dem Orte zurückzukehren, wo ich den Wagen gemietet hatte. Im Weiterfahren sah ich von Zeit zu Zeit aus dem Fenster. Die lichte Gestalt des Kindes schwebte vor mir her, tief unten am wolkenlosen Himmel dahingleitend. Ich wechselte von Station zu Station die Pferde und fuhr die ganze Nacht hindurch immer weiter, bis die Sonne am östlichen Himmel aufging. Ob es Nacht oder Tag war, die Gestalt des Kindes schwebte in ihrem gleichmäßigen, geheimnisvollen Lichte immer vor mir her. Sie geleitete mich eine Meile nach der andern vorwärts auf dem Wege nach Süden, bis wir die ländlichen Umgebungen hinter uns ließen und durch das Getöse und Gewirre der großen Stadt hindurch, im Schatten des alten Tower anlangten, wo wir vor uns den Fluss, der daran vorüberfließt, erblickten.
Der Postillon kam an die Wagentür und fragte mich, ob ich noch ferner seiner Dienste bedürfe. Als ich die Gestalt des Kindes auf seiner lustigen Bahn stillstehen sah, hatte ich ihm zugerufen, dass er anhalten möchte. Nun sah ich wieder hinauf. Die Hand des Kindes wies nach dem Flusse. Ich bezahlte den Postillon und verließ den Wagen. Das Kind führte mich, vor mir herschwebend, zu einem Landungsplatz, der mit Reisenden und ihrem Gepäck angefüllt war. Ein Schiff lag vor der Landungsbrücke, eben zur Abfahrt gerüstet. Das Kind führte mich an Bord des Schiffes und verweilte dann über mir in der dunstigen Luft schwebend. Ich sah hinauf. Das Kind sah mit seinem strahlenden Lächeln zu mir nieder und deutete den Strom entlang, ostwärts auf die ferne See. Während meine Augen fest auf die sanft dahingleitende Gestalt geheftet waren, sah ich sie verschwinden, aufwärts, immer aufwärts zu dem höheren Lichte, wie die Lerche aufwärts und weiter aufwärts an dem Morgenhimmel verschwindet. So war ich nun wieder mit meinen irdischen Mitmenschen allein und mir blieb kein anderer Aufschluss, um mich weiter zu führen, als die Hand des Kindes, die ostwärts auf die ferne See gedeutet hatte.
Ein Matrose wickelte in meiner Nähe auf dem Deck einen losen Ankertau auf. Ich fragte ihn, nach welchem Hafen das Schiff steuere. Der Mann sah mich mit mürrischem Erstaunen an und antwortete: »Noch Rotterdam.«
Fünfunddreißigstes Kapitel
Über Land und Meer
Es kümmerte mich wenig, nach welchem Hafen das Schiff steuerte, wusste ich doch, wohin ich auch ging, dass ich auf dem sicheren Wege zu Frau van Brandt war. Sie bedurfte wiederum meiner und hatte nach mir verlangt. Wohin die Geisterhand des Kindes gewiesen hatte, dahin musste ich meinen Weg verfolgen, ob er mich ins Ausland führte oder in die Heimat wies. Ich war überzeugt, dass ich weiter geleitet werden würde, so wie ich das Festland betrat und hielt an diesem Glauben so fest, wie an dem Bewusstsein, dass mich die Geistererscheinung des Kindes bis hierher geführt hatte.
Ich hatte zwei Nächte hindurch nicht geschlafen – nun übermannte mich die Müdigkeit. Ich stieg in die Kajüte hinab und legte mich in einen leeren Winkel nieder, um zu schlafen. Als ich wieder erwachte war es Nacht geworden, das Schiff war auf der hohen See.
Ich begab mich auf Deck um die frische Luft zu genießen, nach kurzer Zeit aber kehrte das Gefühl der Müdigkeit wieder zurück und ich schlief wiederum mehrere Stunden lang. Ohne Zweifel würde der mir befreundete Arzt dieses nimmer wiederkehrende Bedürfnis nach Ruhe, dem erschöpften Zustande meines Gehirns zugeschrieben haben, das durch die Fantasiegebilde, die es ununterbrochen viele Stunden lang beschäftigt hatten zu sehr erregt worden war. Kurz ich wachte nur dann und wann einige Augenblicke lang während der ganzen Reise, mag die Ursache dazu gewesen sein, welche sie wolle, die übrige Zeit lag ich wie ein ermüdetes Tier in Schlaf versunken.
Als ich bei Rotterdam die Küste betrat, bemühte ich mich gleich zuerst den Weg nach dem englischen Konsulat zu erfahren. Da ich nur noch eine sehr kleine Geldsumme übrig behalten hatte, war es, nach allen meinen Erfahrungen das Geratenste, dass ich, ehe ich etwas Anderes unternahm, die nötigen Schritte tat, um meine Börse wieder zu füllen.
Meine Reisetasche hatte ich bei mir. Als ich nach der Grünwasserfläche reiste, hatte ich sie in dem Gasthause des Marktfleckens zurückgelassen und der Diener hatte sie mir in den Wagen gelegt, als ich wieder nach London abreiste. Diese Tasche enthielt einige Briefe, die mir, um dem Konsul meine Identität zu beweisen, von Nutzen sein konnten. Er gab mir die nötigen Empfehlungen an das Haus in Rotterdam, das mit meinen Londoner Bankiers in Verbindung stand.
Als ich mein Geld empfangen und einige notwendige Sachen eingekauft hatte, ging ich langsam die Straße entlang, ohne zu wissen, wohin ich mich zunächst wenden würde. Ich erwartete zuversichtlich ein Ereignis, das meine Schritte leiten sollte. Kaum war ich hundert Schritte weiter gegangen, als ich an den Fensterladen eines Hauses, das allem Anscheine nach kaufmännischen Zwecken diente, den Namen »van Brandt« angeschrieben sah.
Die Haustür stand offen. Eine zweite, an einer Seite des Flures belegene Tür führte in das Geschäftslokal. Ich betrat das Zimmer und fragte nach Herrn van Brandt. Man rief mir einen jungen Mann, der der englischen Sprache mächtig war, um sich mit mir zu verständigen. Er sagte mir, dass das Geschäft von drei Inhabern desselben Namens geführt werde und fragte mich, welchen davon ich zu sprechen wünsche. Ich erinnerte mich noch des Taufnamens von van Brandt und nannte ihn; es war aber in dem Geschäft kein »Herr Ernst van Brandt« bekannt.
»Unser Haus hier ist nur von der Firma van Brandt abgezweigt,« erklärte mir der junge Mann. »Das Hauptgeschäft befindet sich in Amsterdam. Wenn Sie dort nachfragen, wird man Ihnen sicher sagen können, wo Herr Ernst van Brandt sich aufhält.«
Es kümmerte mich wenig, wohin mein Weg mich führte, wenn das Ziel nur Frau van Brandt war. Da es für diesen Tag zu spät zur Abreise war, schlief ich in einem Hotel. Die Nacht verging ruhig und ohne irgend welches Ereignis. Am nächsten Tage reiste ich mit einer gewöhnlichen Fahrgelegenheit nach Amsterdam ab.
Als ich bei meiner Ankunft dort meine Nachfragen in dem Hauptgeschäft wiederholte, wurde ich an einen der Inhaber gewiesen. Er sprach vollkommen gut Englisch und empfing mich mit einer Art von Interesse, dessen Ursache ich mir zuerst nicht erklären konnte. »Ich kenne Herrn Ernst van Brandt sehr gut,« sagte er. »Darf ich fragen ob sie ein Freund oder Verwandter der englischen Dame sind, die er uns hier als seine Frau vorgestellt hat?«
Ich bejahte die Frage und fügte hinzu, dass ich gekommen sei, um der Dame jeden Beistand zu leisten, dessen sie bedürfen könnte.
Die nächsten Worte des Kaufmannes erklärten mir das scheinbare Interesse, was er an mir gleich beim Empfange zu nehmen schien. »Sie sind sehr willkommen,« sagte er, »denn Sie befreien meine Kompagnons und mich von einer großen Sorge. Was ich damit sagen will, kann ich Ihnen nur erklären, wenn ich für einen Augenblick über die Geschäftsangelegenheiten meiner Firma zu Ihnen spreche. Wir besitzen in der altertümlichen Stadt Enkhuizen, an den Ufern der Zuidersees eine Fischerei. In früheren Zeit besaß Herr Ernst van Brandt einen Anteil daran, den er später verkaufte. In den letzten Jahren nahm der Gewinn ans dieser Quelle sehr ab und wir denken daran die Fischerei aufzugeben, wenn unsere wiederholten Bemühungen in dieser Richtung nicht von besserem Erfolge gekrönt werden. Inzwischen erinnerten wir uns an Herrn Ernst van Brandt, als wir eine unbesetzte Stelle in unserem Geschäftshause in Enkhuizen hatten und boten ihm an, ob er als Schreiber dort seine Beziehungen zu unserem Hause wieder aufnehmen wollte. Er ist mit einem meiner Kompagnons verwandt und dennoch bin ich leider gezwungen Ihnen der Wahrheit gemäß zu gestehen, dass er ein sehr schlechter Mensch ist. Er hat unser Wohlwollen für ihn durch Unterschleife belohnt, die er mit unserem Gelde gemacht hat und ist nun geflohen, ohne dass es uns bis jetzt gelungen ist, die Richtung zu ermitteln. Die englische Dame hat er mit ihrem Kinde in Enkhuizen zurückgelassen – und bis Sie heute hier ankamen, waren wir eigentlich ratlos, was wir mit ihnen anfangen sollten. Ich weiß nicht, mein Herr, ob Sie davon unterrichtet sind – aber die Lage der Dame ist dadurch doppelt trostlos, dass ernste Zweifel darüber obwalten, ob sie wirklich van Brandts Frau ist. Wir wissen bestimmt, dass er vor einigen Jahren mit einer andern Frau im Geheimen getraut worden ist und haben keinerlei Beweise, dass diese erste Frau tot ist. Wenn wir Ihnen in Ihren Anstrengungen Ihrer unglücklichen Landsmännin beizustehen, irgend wie nützlich sein können, so bitten wir Sie, ganz über unsere Dienste zu verfügen.«
Ich brauche wohl nicht zu sagen, in welcher atemloser Spannung ich diesen Worten lauschte. Nun musste sie sicher zu mir zurückkehren, wie meine arme Mutter vorausgesagt.
Die Hoffnung, die mich schon ganz verlassen, erfüllte nun wiederum mein Herz und die Zukunft, an die ich so lange zagend gedacht hatte, lag nun strahlend vom bevorstehenden Glücke vor meinen Blicken. Ich dankte dem guten Kaufmanne mit einer Innigkeit, die ihn in Erstaunen setzte. »Helfen Sie mir nur auf den Weg nach Enkhuizen,« sagte ich, »alles Übrige überlassen Sie mir dann getrost.«
»Die Reise wird Ihnen größere Ausgaben verursachen,« erwiderte der Kaufmann. »Verzeihen Sie, wenn ich Sie gerade herausfrage, ob sie auch mit Geld versehen sind?«
»Sehr reichlich!«
»Gut denn! Das Übrige ist bald getan. Ich werde Sie der Obhut eines Ihrer Landsleute übergeben, der seit vielen Jahren in unserem Comptoir angestellt ist. Als Fremder wird es für Sie am Leichtesten sein die Reise zur See zu machen und der Engländer wird Ihnen bei dem Mieten eines Bootes behilflich sein.«
In wenigen Minuten war ich mit dem Schreiber auf dem Wege nach dem Hafen.
Das Auffinden eines Bootes und die Beschaffung der nötigen Leute veranlasste Schwierigkeiten, die ich nicht vorausgesehen hatte. Als es nun endlich gelungen war, mussten wir an die Verpflegung für die Reise denken. Dank der Erfahrung meines Begleiters und der herzlichen Bereitwilligkeit mit der er alles nötige ausführte, waren meine Vorbereitungen doch noch vor Einbruch der Nacht beendet. Am nächsten Morgen konnte ich nach meinem Bestimmungsorte absegeln.
Das Boot hatte für die Fahrt auf dem Zuidersee die doppelte Annehmlichkeit, groß zu sein und verhältnismäßig wenig Wasser zu ziehen. Die Kajüte des Kapitäns war am hinteren Ende des Schiffes und die zwei oder drei Leute, die die Bemannung bildeten, waren im Bug untergebracht. Nachdem der Raum an einer Seite für den Kapitän, an der anderen für die Leute abgeteilt war, blieb die ganze Mitte des Bootes für mich und wurde mir als Kajüte überwiesen. So hatte ich keinen Grund mich über Mangel an Raum zu beklagen, da das Schiff zwischen fünfzig und sechzig Tonnen maß. Ich hatte ein bequemes Bett, einen Tisch und einige Stühle. Die Küche lag in angenehmer Entfernung von mir auf dem vorderen Ende des Bootes. Ich begab mich, auf meinen eigenen Wunsch, ohne Diener oder Dolmetscher auf die Reise, denn ich zog es vor allein zu sein. Der holländische Kapitän war früher einmal in seinem Leben in Frankreich in der kaufmännischen Marine angestellt gewesen und daher konnten wir uns, wenn es einmal nötig oder wünschenswert war, durch Vermittelung der französischen Sprache verständigen.
Wir ließen die Türme von Amsterdam hinter uns und segelten über das stille Wasser des Flusses dem Zuidersee zu.
Die Geschichte dieses wunderbaren Sees ist schon an sich selbst ein Roman. Zur Zeit als Rom die Beherrscherin der Welt war, existierte er noch nicht. Wo jetzt die Wellen rauschen, umgrenzten damals weite Waldstrecken einen großen Binnensee, der nur durch einen Fluss seinen Ausgang in die See fand. Durch andauernde Stürme angeschwollen, überflutet der See seine Ufer und seine wütenden Wellen rasteten nicht, bis sie alle Hindernisse ans ihrem Wege zerstörend, die äußerste Grenze des Landes erreicht hatten. Die große Nordsee stürzte durch die verderbliche Öffnung hinein und seit jener Zeit besteht der Zuidersee so, wie wir ihn jetzt kennen. Jahre vergingen, Generationen folgten auf einander und an den Ufern des neuen Ozeans entstanden große, bevölkerte Städte, die reich an Handel und berühmt in der Geschichte wurden. Jahrhunderte hindurch währte ihr Wohlstand, bis das nächste Ereignis in der Reihe mächtiger Verwandlungen heranreifte und zum Ausbruch kam. Die Bewohner der Städte am Zuidersee versanken, abgesondert von der übrigen Welt, eitel auf sich selbst und ihr Wohlergehen, unbekümmert um den Fortschritt die benachbarten Nationen, in jene verhängnisvolle Trägheit, die abgesonderten Völkern eigen ist. Die Wenigen aus der Bevölkerung die noch die Reliquien der alten Energie bewegt hatten, wanderten aus, während die zurückbleibende Menge geduldig dem abnehmenden Verkehr und dem Verfall ihrer Institutionen zusah. Als das neunzehnte Jahrhundert herangekommen war, zählte man die Bevölkerung die sich einst auf Tausende belief, nach Hunderten. Der Handel hörte auf, ganze Straßen waren verlassen. Häfen, die sonst von Schiffen wimmelten, waren durch die Anhäufung des Sandes, der man in keiner Weise steuerte, ganz zerstört. Jetzt nun in unserer Zeit ist gegen den Verfall dieser einst blühenden Städte keine Abhilfe mehr möglich und man zieht nun für die nächste große Verwandlung den Plan in Betracht, die nutzlose Wasserfläche auszutrocknen, um den kommenden Generationen das wiedergewonnene Land zur fruchtbaren Bearbeitung zu übergeben. Das ist in kurzem die Geschichte des Zuidersees.
Als wir weiter vorwärts kamen und den Fluss verließen, bemerkte ich die schwarzgelbe Farbe des Sees, die die Sandbänke, durch die unerfahrenen Seeleuten leicht Gefahren erwachsen können, dem flachen Wasser geben. Wir rasteten für die Nacht an der Fischerinsel Marken, die mir, beleuchtet von dem letzten Schimmer des Zwielichts, als ein armseliger verlassener, ernst aussehender Ort erschien. Hier und da erhoben sich die giebligen Hütten, die an die Hügel gelehnt waren, schwarz gegen den dunkelgrauen Himmel. Hin und wieder erschien eine menschliche Gestalt am Ufer und stand in stiller Betrachtung des fremden Bootes versunken. Das war Alles was ich von der Insel Marken sah.
In manchen Augenblicken wurde mir die Wirklichkeit meiner eigenen Tage zweifelhaft, als ich in der stillen Nacht auf einem fremden Meere wach lag,
War das Alles ein Traum? Meine Selbstmordgedanken, meine Vision von Mutter und Tochter, meine Rückreise nach der Hauptstadt, die von der Erscheinung des Kindes geleitet wurde, meine Reise nach Holland, mein nächtliches Ankern auf dem unbekannten See – waren das Alles nur, so zu sagen, Bruchstücke derselben krankhaften, inneren Verwirrung, alles Täuschungen aus denen ich jeden Augenblick erwachen konnte um mich dann wieder im Vollbesitz meiner Sinne in dem Hotel in London zu befinden? Da mich meine Zweifel immer mehr verwirrten und weiter und weiter von einem entschiedenen Schlusse ablenkten, verließ ich mein Bett und begab mich auf Deck, um die Umgebung zu wechseln. Es war eine stille, bewölkte Nacht. Die Insel war nichts weiter als ein dunklerer Schatten in der dunklen Öde um mich her. Der einzige Laut, der mein Ohr erreichte, war das schwere Atmen des Kapitäns und seiner Leute, die zu beiden Seiten von mir schliefen. Ich lauschte und blickte rings um mich her in der Dunkelheit, die mich umgab. Es zeigte sich aber keine neue Erscheinung. Als ich wieder zur Kajüte zurückkehrte und endlich einschlummerte, träumte ich nicht. Es schien als hätte ich in England Alles zurückgelassen, was sich in den letzten Ereignissen meines Lebens Geheimnisvolles und Wunderbares zugetragen hatte. Als ich Holland erreicht hatte, war ja meine Handlungsweise nur durch ganz natürliche Umstände und durch ganz alltägliche Entdeckungen, die jedermann in meiner Lage gemacht haben würde, beeinflusst worden. Was bedeutete das? Hatte meine Gabe als Geisterseher mich in dem neuen Lande unter fremden Menschen verlassen? Oder hatte mein Schicksal mich an den Ort geführt, wo die Sorgen meiner irdischer Pilgerfahrt ihr Ende erreichen sollten? Wer konnte das sagen?
Am nächsten Morgen in aller Frühe segelten wir weiter.
Unsere Richtung war beinahe nordwärts. Zu einer Seite lag mir der dunkelgelbe See, dessen Farbe sich unter gewissen Witterungseinflüssen in ein trübes Perlgrau verwandelte. Zur andern Seite war die flache sich hinschlängelnde Küste, auf der gelber Sand mit grünen Wiesenstrecken wechselte, dann und wann von Städten und Dörfern unterbrochen, deren rote, ziegelgedeckte Dächer und spitze Kirchtürme heiter zum klaren, blauen Himmel hinaufragten. Der Kapitän schlug mir einen Besuch in den berühmten Städten Edam und Hoorn vor, aber ich lehnte es ab ans Land zu gehen. Mein einziger Wunsch war die altertümliche Stadt zu erreichen in der Frau van Brandt verlassen lebte. Als wir die Richtung wechselten, um auf das Vorgebirge los zu steuern auf dem Enkhuizen liegt, ließ der Wind nach, – drehte sich dann nach einer anderen Richtung und wurde so stark, dass er die Schwierigkeiten der Fahrt sehr vergrößerte. So lange als irgend möglich, bestand ich darauf, dass wir unsern Weg fortsetzten. Nach Sonnenuntergang ließ die Gewalt des Windes nach. Die Nacht war wolkenlos, und das gestirnte Firmament lieh uns sein bleiches, melancholisches Licht. Nach Verlauf einer Stunde drehte sich der launische Wind wieder zu unserm Gunsten. Gegen zehn Uhr liefen wir in den öden Hafen von Enkhuizen ein.
Der Kapitän und seine Leute aßen ihr einfaches Abendbrot und gingen zu Bett, da sie von ihren Anstrengungen ermüdet waren. Nach einigen Augenblicken war ich der Einzige, der auf dem Boote wachte.
Ich stieg aufs Deck und blickte um mich her.
Unser Boot hatte an einem verlassenen Kai geankert. Außer einigen kleinen Schiffen, die ich nah bei dem unseren erblickte, bot der Hafen dieses einst wohlhabenden Ortes mir den Anblick einer weiten, einsamen Wasserfläche, die hier und da von öden Sandbänken unterbrochen war. Landwärts sah ich nur die einsamen Gebäude der Totenstadt – die düster schwarz und grimmig in dem geheimnisvollen Sternenscheine dastanden. Nirgends war ein menschliches Wesen oder auch nur ein verirrtes Tier zu erblicken. Der Ort sah jetzt so leer und leblos aus, als wäre er durch eine Seuche verwüstet worden und vor wenig mehr als hundert Jahren erreichte die Zahl seiner Bewohner sechzig Tausend. Seine Einwohnerzahl war auf den zehnten Teil zusammen geschrumpft, als ich Enkhuizen jetzt vor mir liegen sah.
Ich überlegte mir, was ich nun zunächst tun sollte.
Jedenfalls hatte ich geringe Aussicht, Frau van Brandt aufzufinden, wenn ich zur Nachtzeit allein und ohne Führer in die Stadt zu gehen versuchte. Und würde es mir anderseits doch möglich sein, nun ich den Ort erreicht hatte, an dem sie mit ihrem Kinde freundlos und verlassen lebte, geduldig die lange Zwischenzeit abzuwarten, die vergehen musste, ehe es Morgen wurde und die Stadt erwachte. Ich kannte meine eigene selbstquälerische Natur zu gut, um das Letztere zu wählen. Komme was da wolle, ich beschloss Enkhuizen auf den Zufall hin, zu durchwandern, dass ich das Comptoir der Fischerei entdeckte und so Frau van Brandts Adresse erfuhr.
Nachdem ich zuerst vorsichtigerweise meine Kajütentür verschlossen hatte, stieg ich vom Schiff auf den einsamen Quai und begab mich auf die nächtliche Wanderung durch die Totenstadt.