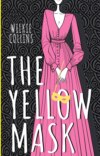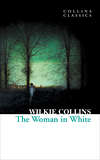Czytaj książkę: «Die Frau in Weiss», strona 18
Ich schreibe diese Zeilen lange nach Mitternacht in der Einsamkeit meines Zimmers, nachdem ich eben heimlich Laura in ihrem hübschen weißen Bettchen betrachtet habe, dem Bettchen, in dem sie seit ihrer Kindheit geschlafen hat. Da lag sie, nicht ahnend, daß ich sie betrachtete, ganz ruhig, ruhiger als ich zu hoffen gewagt, aber nicht schlafend. Der Schimmer des Nachtlichtes zeigte mir, daß ihre Augen nur halb geschlossen waren und zwischen den Lidern glänzten Thränenspuren. Mein kleines Andenken, Nichts als eine kleine Broche, lag auf dem Tischchen neben ihrem Bett und daneben ihr Gebetbuch und ihres Vaters Miniaturbildchen, das sie mitnimmt, wohin sie auch gehen mag. Ich stand einen Augenblick hinter ihrem Kissen und blickte auf sie herab, wie sie dalag und der eine Arm so weiß auf der weißen Decke ruhte – so still, so sanft athmend, daß selbst die Spitzen an ihrem Nachtkleide nicht einmal zitterten, ich stand und schaute sie an, wie ich sie zu tausend Malen angeschaut, und wie ich sie niemals wiedersehen werde – und kehrte dann leise in mein Zimmer zurück. Mein einziges Lieb! wie verlassen Du bist trotz all Deines Reichthums und all Deiner Schönheit! Der eine Mann, der sein Herzblut hergeben würde, um Dir zu dienen, ist weit von Dir in dieser stürmischen Nacht umhergetrieben auf der wüthenden See. Wer bleibt Dir sonst noch? Kein Vater, kein Bruder, kein lebendes Wesen, außer einem hülflosen, nutzlosen Weibe, das diese traurigen Zeilen schreibt und für Dich den Morgen erwartet, voll Kummer, den sie nicht stillen, voll Zweifel, die sie nicht überwinden kann. O, welch ein Schatz soll morgen in jenes Mannes Hände gegeben werden! Wenn er es jemals vergißt; wenn er je ein Haar ihres Hauptes verletzt!
Den 23. December.
Sieben Uhr. Ein wilder, rauher Morgen. Sie ist soeben ausgestanden und ist wohler und gefaßter, da die Zeit gekommen ist, als sie gestern war.
Zehn Uhr. Sie ist angekleidet. Wir haben einander umarmt und versprochen, nicht den Muth zu verlieren. Ich bin einen Augenblick auf mein Zimmer gekommen. In dem Tumulte und der Verwirrung meiner Gedanken bleibt mir noch immer diese sonderbare Idee, daß sich Etwas ereignen wird, um die Heirath zu verhindern. Hat er etwa dasselbe Gefühl? Ich sah ihn durch’s Fenster unruhig zwischen den an der Thür haltenden Wagen hin und her gehen. – Wie kann ich nur so thöricht schreiben! Die Heirath ist gewiß. In weniger als einer halben Stunde brechen wir nach der Kirche auf.
Elf Uhr. Es ist Alles vorüber. Sie sind verheirathet.
Drei Uhr. Sie sind fort! Ich bin blind vom Weinen – ich kann nicht weiter schreiben. –
Zweiter Band
Aus Miß Halcombe’s Tagebuche.
(Fortsetzung.)
Blackwater Park in Hampshire.Den 27. Juni.
Sechs Monate, die vergangen sind, sechs lange, einsame Monate, seit Laura und ich uns zuletzt gesehen!
Wie viele Tage habe ich noch zu warten? Nur einen noch! Morgen am Achtundzwanzigsten kehren die Reisenden nach England zurück. Ich kann kaum an mein Glück glauben; ich kann mir kaum vorstellen, daß die nächsten vierundzwanzig Stunden die letzten meiner Trennung von Laura sein sollen! Sie ist den ganzen Winter über mit ihrem Manne in Italien und darauf in Tyrol gewesen. Sie kommen in Begleitung von Graf Fosco und seiner Frau zurück, die sich in der Umgegend von London niederzulassen beabsichtigen und versprochen haben, die Sommermonate in Blackwater Park zuzubringen, bis sie eine passende Wohnung gefunden haben. Solange nur Laura wiederkommt ist mir’s einerlei, wer noch sonst mit kommt. Sir Percival mag sein Haus meinetwegen vom Erdgeschosse bis unter’s Dach mit Gästen anfüllen, wenn nur seine Frau und ich noch zusammen darin wohnen dürfen.
Inzwischen bin ich hier in Blackwater Park etablirt, – »dem alten und interessanten Landsitze« (wie die Grafschafts-Chronik mich freundlichst unterrichtet) »von Sir Percival Glyde, Baronet,« – und zukünftigem Aufenthaltsorte (wie ich jetzt auf eigne Verantwortung hinzufügen kann) der einfachen Marianne Halcombe, ledig, augenblicklich in einem gemüthlichen kleinen Wohnzimmer sitzend, neben sich eine Tasse Thee und um sich herum all ihr irdisches Hab und Gut, enthalten in drei Reisekoffern und einem Nachtsacke.
Ich verließ Limmeridge gestern Morgen, nachdem ich den Tag zuvor Laura’s lieben, guten Brief aus Paris erhalten hatte. Ich war ungewiß gewesen, ob ich in London oder in Hampshire mit ihnen zusammentreffen sollte, aber in diesem letzten Briefe sagte sie mir, daß Sir Percival in Southampton zu landen und von da gleich nach seinem Landsitze zu reisen beabsichtige. Er hat so viel Geld im Auslande ausgegeben, daß ihm nicht genug übrig bleibt, um den Rest der Saison in London zuzubringen, und hat sparsamerweise beschlossen, den Sommer und Herbst ruhig in Blackwater zu bleiben. Laura hat mehr als hinreichend Aufregung und Abwechselung gehabt, und freut sich auf die ländliche Ruhe und Zurückgezogenheit, die ihres Mannes Umsicht ihr verschafft. Was mich betrifft, so bin ich bereit, überall glücklich zu sein, solange ich nur bei ihr sein kann. Demzufolge sind wir Alle zum ersten Anfange auf verschiedene Weise zufrieden.
Vorige Nacht schlief ich in London und wurde dort heute so lange durch allerlei Besuche und Geschäfte abgehalten, daß ich erst nach dem Dunkelwerden in Blackwater anlangte.
Nach meinen bis jetzt empfangenen unbestimmten Eindrücke zu urtheilen, ist es ganz das Gegentheil von Limmeridge. Das Haus steht auf einer ganz flachen Ebene und ist rings von Bäumen eingeschlossen oder vielmehr erstickt, wie ich mit meinen nordländischen Begriffen es fast nennen möchte. Ich habe noch Niemanden gesehen, als den Diener, der mir die Thür öffnete, und die Haushälterin, eine sehr aufmerksame, höfliche Frau, die mich auf mein Zimmer führte und mir meinen Thee brachte. Ich habe ein hübsches kleines Wohnzimmer mit Schlafgemach am Ende eines langen Corridors in der ersten Etage. Die Zimmer der Dienerschaft und noch einige Fremdenzimmer sind in der zweiten Etage und alle Wohnzimmer im Erdgeschosse. Ich habe noch keins von ihnen gesehen und weiß noch Nichts von dem Hause, ausgenommen, daß der eine Flügel fünfhundert Jahre alt sein soll, daß es einst von einem Wallgraben umzogen war und daß es seinen Namen Blackwater von einem kleinen See im Parke erhalten hat.
Es hat soeben auf gespenstische, feierliche Weise von dem kleinen Thurme über dem Centrum des Hauses, den ich bei meiner Ankunft gesehen, elf Uhr geschlagen. Dies hat einen großen Hund erweckt, der irgendwo um eine Ecke herum ganz jämmerlich heult und gähnt. Ich höre das Echo von hallenden Schritten in den Gängen unter mir und das Geräusch des Vorschiebens und Schließens von eisernen Riegeln und Stangen an der Hausthür. Die Dienerschaft ist augenscheinlich im Begriffe; zu Bette zu gehen. Soll ich ihrem Beispiele folgen?
Nein; ich bin nicht halb schläfrig genug. Schläfrig, sage ich? Mir ist, als ob ich im ganzen Leben die Augen nicht wieder schließen würde. Die bloße Erwartung, morgen das liebe Gesicht wiederzusehen und die bekannte Stimme wieder zu hören erhält mich in fortwährender fieberhafter Aufregung. Wenn ich die Privilegien eines Mannes hätte, da ließ ich mir sofort Sir Percival’s bestes Pferd satteln und sprengte in einem Nachtgallopp davon nach Osten zu, der aufgehenden Sonne entgegen, ich ritt im langen, schweren, ununterbrochenen, stundenlangen Galopp dahin, ein Ritt wie der des berüchtigten Straßenräubers zu York. Da ich aber blos ein Weib und deshalb auf Lebenszeit zu Stillsitzen, Schicklichkeiten und Schleppröcken verurtheilt bin, muß ich versuchen, der Haushälterin keinen Anstoß zu geben und mich auf irgend eine schwächliche weibliche Art und Weise zu beruhigen
An Lesen ist nicht zu denken, ich kann meine Aufmerksamkeit nicht auf ein Buch fesseln. Ich will sehen, ob ich mich nicht schläfrig schreiben kann. Ich habe mein Tagebuch seit einiger Zeit sehr vernachlässigt. Was kann ich mir, jetzt, da ich an der Schwelle eines neuen Lebens stehe, von den Personen, Ereignissen und Wechselfällen der letzten sechs Monate zurückrufen, dem langen, traurigen, leeren Zeitraume seit Laura’s Hochzeitstage?
Walter Hartright steht in meiner Erinnerung obenan und geht zuerst in der schattenhaften Prozession meiner abwesenden Lieben an mir vorüber. Ich erhielt ein paar Zeilen von ihm, die er gleich nach ihrer Landung in Honduras und etwas heiterer und hoffnungsvoller geschrieben hatte. Etwa einen Monat oder sechs Wochen später sah ich einen Auszug aus einer amerikanischen Zeitung, welcher das Aufbrechen der Abenteurer nach ihrer Reise landeinwärts beschrieb. Man sah sie zuletzt, als sie einen wilden Urwald betraten, Jeder mit seiner Flinte auf der Schulter und sein Gepäck hinter sich tragend. Seitdem hat man alle Spur von ihnen verloren. Ich habe keine Zeile wieder von Walter gesehen, noch ist seitdem die kleinste Nachricht über die Expedition in den öffentlichen Blättern erschienen.
Ueber dem Geschick von Anna Catherick und ihrer Gefährtin Mrs. Clements schwebt noch immer dasselbe undurchdringliche Dunkel. Man hat von Keiner von Beiden je wieder etwas gehört. Ob sie im Lande sind oder in der Fremde, ob lebend oder todt, kein Mensch weiß es. Sogar Sir Percival’s Advokat hat alle Hoffnung und zugleich alle ferneren Nachforschungen aufgegeben.
Unserm guten alten Freunde, Mr. Gilmore, ist ein trauriges Hinderniß in seinem thätigen Berufsleben entgegengetreten. Zu Anfange des Frühlings hörten wir zu unserer Bestürzung, daß man ihn bewußtlos an seinem Pulte gefunden und die Aerzte erklärt haben, daß es ein Schlagflußanfall sei. Er hatte längst über Blutandrang und Eingenommenheit des Kopfes geklagt, und sein Arzt hatte ihn vor den Folgen gewarnt, die nicht ausbleiben könnten, falls er fortfahre, früh und spät zu arbeiten, als ob er noch ein junger Mann sei. Die Folge davon ist nun, daß ihm entschiedene Verordnungen ertheilt sind, auf wenigstens ein Jahr nicht wieder auf sein Bureau zu gehen und Erholung für Geist und Körper in gänzlich veränderter Lebensweise zu suchen. Das Geschäft wird demgemäß von seinem Compagnon fortgesetzt, und er selbst ist augenblicklich in Deutschland, wo er Verwandte hat, die als Kaufleute ansässig sind. Auf diese Weise haben wir noch einen treuen, zuverlässigen Freund verloren, doch, wie ich hoffe, nur auf kurze Zeit.
Die gute Mrs. Vesey reiste bis London mit mir. Wir konnten sie unmöglich zu der Einsamkeit in Limmeridge verurtheilen, nachdem Laura und ich Beide das Haus verlassen, und haben ausgemacht, daß sie bei einer unverheiratheten Schwester, die eine Pensionsanstalt in Clapham hat, leben soll. Sie soll im Herbste herkommen und ihre Schülerin, ich möchte fast sagen ihre angenommene Tochter, besuchen. Ich begleitete die gute alte Dame, bis ich sie an ihrem Bestimmungsorte in Sicherheit sah, und überließ sie der Sorgfalt ihrer Schwester in stiller Glückseligkeit über die Aussicht, Laura in wenigen Monaten wiederzusehen.
Was Mr. Fairlie betrifft, so glaube ich mich keiner Ungerechtigkeit schuldig zu machen, wenn ich sage, daß es ihm eine außerordentliche Erleichterung war, sein Haus von allen Frauenzimmern befreit zu sehen. Die Idee, daß er seine Nichte vermißt hätte, ist vollkommen widersinnig, er pflegte sie in früheren Zeiten monatelang nicht zu sehen, und was Mrs. Vesey und mich betrifft, so erlaube ich mir, seine Versicherung, daß ihm unsere Abreise das Herz breche, für das Bekenntniß seines innern Jubels, uns los zu werden, anzusehen. Seine jüngste Laune ist die, fortwährend zwei Photographen von den Schätzen und Merkwürdigkeiten in seinem Besitze Sonnenbilder abnehmen zu lassen. Eine vollständige Copie dieser Sammlung von Photogrammen soll auf die feinste Kartenpappe geklebt und mit sehr ins Auge fallenden Unterschriften in rothen Buchstaben dem Arbeiterinstitute zu Carlisle zum Geschenke gemacht werden. »Madonna und Christkind von Raphael, Eigenthum von Frederick Fairlie, Esquire.« – »Unnachahmliche Skizze von Rembrandt. In ganz-Europa-unter dem Namen ›Die Kladde‹ bekannt, nach einem Druckflecken in einer Ecke, der in keinem andern Exemplare existirt. Auf dreihundert Guineen geschätzt. Eigenthum von Frederick Fairlie, Esquire.« – »Kupfermünze aus der Zeit Tiglath Pileser’s, Eigenthum von Frederick Fairlie, Esquire.« Dutzende von diesen Photogrammen mit ähnlichen Unterschriften waren bereits vollendet, ehe ich Cumberland verließ,·und Hunderte sind noch anzufertigen; Mit dieser neuen Beschäftigung wird Mr. Fairlie auf viele Monate ein glücklicher Mann sein, und die beiden unglückseligen Photographen werden das sociale Märtyrerthum theilen, das bisher auf den Kammerdiener allein gefallen ist.
Soviel über die Personen und Ereignisse, die den vordersten Platz in meiner Erinnerung einnehmen. Was aber jetzt über die eine Person, die den ersten Platz in meinem Herzen füllt? Laura ist, während ich diese Zeilen geschrieben habe, ununterbrochen in meinen Gedanken gewesen. Was weiß ich von ihr während der letzten sechs Monate, das ich in mein Tagebuch einschreiben könnte, ehe ich es für heute Abend schließe?
Ich habe Nichts als ihre Briefe, die mir als Führer dienen könnten; und über den wichtigsten aller Gegenstände über die unsere Briefe verhandeln können, lassen sie mich alle ohne Ausnahme im Dunkeln.
Behandelt er sie mit Güte? Ist sie jetzt glücklicher, als da wir an ihrem Hochzeitstage von einander schieden? Alle meine Briefe haben diese beiden Fragen enthalten, jedesmal mehr oder weniger deutlich, bald in dieser, bald in jener Form ausgedrückt; und alle sind sie in Bezug auf diesen einen Punkt allein unbeantwortet geblieben, oder so beantwortet, als ob meine Fragen sich blos auf ihre Gesundheit bezogen hätten. Sie benachrichtigt mich zu wiederholten Malen, daß sie vollkommen wohl ist, daß das Reisen ihr wohl bekommt, daß sie zum ersten Male in ihrem Leben den Winter ohne Erkältung überstanden, aber nirgends finde ich ein Wort, das mir sagte, sie sei mit ihrer Heirath ausgesöhnt und könne jetzt ohne alle Bitterkeit und Reue auf den dreiundzwanzigsten December zurückblicken Der Name ihres Mannes erscheint in ihren Briefen nur wie der eines Freundes, der sie auf der Reise begleitet und alle Anordnungen derselben übernommen hätte. »Sir Percival« hat bestimmt, daß wir an dem und dem Tage von hier abreisen. »Sir Percival« beabsichtigt die und die Reiseroute zu nehmen. Hin und wieder nennt sie ihn auch blos »Percival«, aber doch nur sehr selten; in neun Fällen von zehnen giebt sie ihm seinen Titel.
Ich kann nicht entdecken, daß seine Ansichten und Gewohnheiten die ihrigen in irgend einer Hinsicht verändert oder gefärbt hätten. Die gewöhnliche moralische Umbildung, die fast unmerklich in einem jungen, frischen, gefühlvollen Weibe durch ihre Heirath bewirkt wird, scheint nicht mit Laura vorgegangen zu sein. Sie schreibt über ihre Gedanken und Eindrücke unter den Wundern, die sie gesehen hat, gerade wie sie wohl an Jemand Anderes geschrieben haben würde, wenn ich an ihres Mannes Stelle mit ihr gereist wäre. Ich sehe Nichts, was mir in irgend einer Beziehung eine zwischen ihnen bestehende Sympathie verriethe. Selbst wenn sie von dem Gegenstande ihrer Reisen abgeht und sich mit den Aussichten beschäftigt, die sie bei ihrer Rückkehr nach England erwarten, sind ihre Betrachtungen immer nur auf ihre Zukunft als meine Schwester gerichtet und lassen ihre Zukunft als Sir Percival’s’ Gemahlin beharrlich unberücksichtigt. Unter allem Diesem liegt dabei kein Ton der Klage verborgen, der mir verriethe, daß sie sich in ihrer Verheirathung geradezu unglücklich fühlte. Der Eindruck, den ich aus unserer Correspondenz empfangen, führt mich, Gott sei Dank, nicht zu einem so traurigen Schlusse. Ich sehe nur, wenn ich sie mir ihren Briefen nach nicht als Schwester, sondern als junge Frau vergegenwärtige, eine traurige Erstarrung, eine unveränderliche Gleichgültigkeit in ihr. Kurz, es hat während der letzten sechs Monate immer noch Laura Fairlie an mich geschrieben und niemals Lady Glyde.
Dasselbe Schweigen, welches sie in Bezug auf ihres Mannes Charakter und Betragen beobachtet, trägt sie auch in ihren wenigen Hindeutungen auf Graf Fosco mit derselben Entschlossenheit auf ihres Mannes Busenfreund über.
Aus irgend einem unerklärten Grunde scheinen der Graf und seine Gemahlin plötzlich im Herbste ihre Pläne geändert zu haben und nach Wien gegangen zu sein, anstatt, wie Sir Percival erwartet hatte, in Rom mit ihnen zusammenzutreffen. Sie verließen Wien erst im Frühling und reisten dann nach Tyrol, von wo aus sie mit den jungen Eheleuten die Rückreise nach England antraten. Laura schreibt ausführlich genug über ihr Begegnen mit ihrer Tante und versichert mich, daß dieselbe sich so sehr zu ihrem Vortheile verändert habe, daß sie als Frau so viel ruhiger und vernünftiger geworden, als sie vor ihrer Heirath war, daß ich sie kaum wieder erkennen werde, wenn ich sie hier wiedersehe. Aber in Bezug auf Graf Fosco (der mich bedeutend mehr interessirt als seine Frau) ist sie unleidlich zurückhaltend und schweigsam. Sie sagt weiter Nichts, als daß er ihr ein Räthsel ist, und daß sie mir ihre Eindrücke über ihn nicht sagen will, bis ich ihn selbst gesehen und meine eigene Meinung von ihm gefaßt habe. Dies sieht meiner Ansicht nach nicht günstig für den Grafen aus. Laura hat die feine Kindergabe, durch Instinct einen Freund zu erkennen, in weit vollkommnerem Grade bewahrt, als die meisten Leute dieselbe in spätern Jahren haben; und wenn ich mich in meiner Vermuthung, daß ihr erster Eindruck vom Grafen ein ungünstiger war, nicht täusche, so bin ich meines Theils in Gefahr, dem erlauchten Ausländer zu mißtrauen, ehe ich ihn noch mit einem Auge gesehen habe. Doch Geduld, Geduld, diese Ungewißheit und noch manche andere wird nicht viel länger mehr währen. Der morgende Tag wird den Anfang machen, alle meine Zweifel früher oder später zu lösen.
Es hat soeben Zwölf geschlagen, und ich komme zurück, um diese Blätter zu schließen, nachdem ich einen Blick aus meinen offenen Fenster geworfen.
Es ist eine stille, schwüle, mondlose Nacht. Nur wenige blasse Sterne stehen am Himmel. Die Bäume, die auf allen Seiten die Aussicht versperren, sehen in der Entfernung schwarz und fest aus, wie eine Felsenmauer. Ich höre das Quaken der Frösche, schwach und von Weitem her, und das Echo der großen Glocken summt in der luftlosen Stille, lange nachdem die Schläge aufgehört haben. Es soll mich verlangen, wie Blackwater Park bei Tage aussieht. Ich kann nicht sagen, daß der Ort mir bei Nacht besonders gefiele.
Den 28. Juni.
Ein Tag der Nachforschungen und Entdeckungen – aus vielen Gründen ein weit interessanterer Tag, als ich zu erwarten gewagt hatte.
Ich begann natürlich mit den Sehenswürdigkeiten des Hauses.
Das Hauptgebäude stammt aus der Zeit jener unendlich überschätzten Frau, der Königin Elisabeth. Im Erdgeschosse sind zwei ungeheuer lange, niedrige Gallerien, die mit einander parallel laufen, und durch scheußliche Familienportraits, die ich alle ohne Ausnahme verbrennen möchte, ein doppelt düsteres und schauerliches Aussehen erhalten. Die Zimmer, welche oberhalb dieser Gallerien liegen, sind in ziemlich gutem Stande gehalten, werden aber selten benutzt. Die höfliche Haushälterin, die mich als Führerin begleitete, erbot sich, sie mir zu zeigen, fügte aber rücksichtsvoll hinzu, sie fürchte, ich werde sie etwas in Unordnung finden. Meine Achtung für die Unbeflecktheit meiner Röcke und Strümpfe geht indessen meiner Achtung für alle Elisabethischen Schlafgemächer des Königreichs unbedingt vor; und ich schlug daher mit Entschiedenheit eine Entdeckungsreise in den höhern Regionen aus, die nur mit Gefahren für meine schöne weiße Wäsche unternommen werden konnte. Die Haushälterin sagte: »ich bin ganz Ihrer Ansicht, Miß,« und schien in mir das verständigste Frauenzimmer zu erkennen, daß ihr seit langer Zeit vorgekommen.
Soviel also über das Hauptgebäude. An jedem Ende desselben ist ein Flügel angebaut. Der halb verfallene Flügel links (wie man sich dem Hause nähert) war einst ein allein stehendes Wohngebäude und wurde im vierzehnten Jahrhunderte erbaut. Eine von Sir Percival’s mütterlichen Vorfahren – ich erinnere mich nicht, welche es war, und es ist mir auch einerlei – ließ zur besagten Zeit der Königin Elisabeth das Hauptgebäude im rechten Winkel daran flicken. Die Haushälterin sagte mir, daß die Architektur des »alten Flügels« inwendig sowohl als auswendig von Sachverständigen für außerordentlich schön erklärt werde. Nach einer ferneren Untersuchung kam ich zu der Ueberzeugung, daß die Sachverständigen erst dieser Ansicht in Bezug auf Sir Percival’s Exemplar aus dem Alterthume werden konnten, nachdem sie sich vorher aller Furcht vor Feuchtigkeit, Finsterniß und Ratten entschlagen. Unter diesen Umständen gab ich ohne alles Zaudern zu, daß ich keine Sachverständige sei und schlug vor, daß wir es mit dem »alten Flügel« machten, wie wir es schon mit den Elisabethischen Schlafgemächern gemacht. Die Haushälterin sagte nochmals, »ich bin ganz Ihrer Ansicht, Miß,« und sah mich zum zweiten Male mit einem Ausdrucke der unverkennbarsten Bewunderung für meinen außerordentlich gesunden Verstand an.
Wir gingen dann zum rechten Flügel über, der um den wunderbaren architektonischen Mischmasch von Blackwater Park zu vollenden, zur Zeit Georg’s des Zweiten erbaut war. Dies ist der bewohnbare Theil des Hauses, welcher um Laura’s willen inwendig ausgebessert und neu eingerichtet worden ist. Meine beiden Zimmer und alle die besten Schlafzimmer liegen in der ersten Etage und im Erdgeschosse: das Gesellschaftszimmer, Wohnzimmer, Eßzimmer, eine Bibliothek und ein hübsches kleines Boudoir für Laura, die alle sehr hübsch nach neuer Mode verziert und elegant mit all’ den herrlichen neuen Luxusgegenständen meublirt sind. Keine von den Stuben sind an Größe und Luftigkeit mit unsern Stuben in Limmeridge zu vergleichen; aber sie haben alle ein gemüthliches Aussehen. Ich war nach dem, was ich von Blackwater gehört, in einer schrecklichen Angst gewesen, daß ich dort Nichts als antike, steife Stühle, klösterlich bemalte Fenster, dumpfige, vermoderte Vorhänge und all jenen barbarischen Plunder finden werde, den Leute, die ohne jeglichen Begriff von Comfort geboren sind, ohne alle Rücksicht auf das, was sie ihren Bekannten schuldig sind, um sich anhäufen. Es nimmt mir daher einen außerordentlichen Stein vom Herzen, zu finden, daß das neunzehnte Jahrhundert in diese meine neue Heimath gedrungen und die garstige »gute alte Zeit« aus den Pfaden meines täglichen Lebens hier verdrängt hat.
Ich verbrachte den Morgen theils in den Zimmern des Erdgeschosses, theils außen in dem Quadrate, das von den drei Seiten des Hauses und dem hohen Eisengitter mit dem Thore, das es von vorne schützt, gebildet wird. Ein großer runder Fischteich mit steinernen Seiten und einem allegorischen bleiernen Ungeheuer in der Mitte bildet den Mittelpunkt des Vierecks. Der Teich ist voller Gold- und Silberfischchen, und von dem weichsten Rasengürtel eingefaßt, den ich je betreten habe. Ich zögerte hier auf der schattigen Seite ziemlich zufrieden bis zur Gabelfrühstücksstunde; nach derselben nahm ich meinen großen runden Hut und wanderte ohne Begleitung in den schönen warmen Sonnenschein hinaus, um mir die Parkanlagen anzusehen.
Das Tageslicht bestärkte den Eindruck vom Abende vorher, daß es nämlich im Blackwater zu viele Bäume gebe. Sie ersticken das Haus förmlich. Es sind meistens junge Bäume, und viel zu dicht gepflanzt. Ich denke mir, daß vor Sir Percival’s Zeiten auf der ganzen Besitzung auf sehr verschwenderische Weise Nutzholz gehauen worden, und daß der nächste Besitzer voll empörter Besorgniß gewesen, die Lücken möglichst schnell wieder zu füllen. Indem ich mich vor dem Hause umschaute, bemerkte ich zu meiner Linken einen Blumengarten und ging darauf zu, um zu sehen, was ich in dieser Richtung entdecken werde.
Der Garten erwies sich in der Nähe als klein, unbedeutend und schlecht gehalten. Ich ließ ihn hinter mir, trat durch ein kleines Pförtchen in der Hecke, und befand mich in einer Tannenpflanzung. Ein hübscher, künstlicher Pfad schlängelte sich durch die Bäume und ich schritt auf ihm weiter, wobei meine Erfahrungen im Norden mich belehrten, daß ich mich sandigem, haidigen Boden näherte. Nachdem ich wohl mehr als eine halbe (englische) Meile weit unter den Bäumen dahinspaziert war, machte der Pfad plötzlich eine scharfe Wendung; die Bäume hörten zu beiden Seiten auf und ich sah mich am Rande einer großen offenen Ebene und auf den Blackwater See hinab, der dem Hause diesen Namen giebt.
Der Boden, der sich vor mir hin abwärts zog, war lauter Sand, einige haidige kleine Hügel ausgenommen, welche hie und da die Einförmigkeit unterbrachen. Der See war einst offenbar bis an die Stelle gekommen, an der ich stand, und war allmälig bis auf den dritten Theil seines ehemaligen Umfanges eingetrocknet. Ich sah wie seine stillen, faulen Wasser etwa eine Viertelmeile von mir in einer Vertiefung von verschlungenem Schilfe, Rohre und von kleinen Erdhügeln in Sümpfe und Pfützen getheilt wurde. Auf dem mir gegenüberliegenden Ufer erhob sich wieder dieses Gebüsch, das die Aussicht verbarg und seine düstern Schatten auf das träge, flache Wasser warf. Als ich zum See hinabging, sah ich, daß der Boden am entgegengesetzten Ende desselben feucht und sumpfig und mit üppigem Grase und Trauerweiden bewachsen war. Das Wasser, welches auf der offenen sandigen Seite, wo die Sonne schien, ziemlich klar war, sah mir gegenüber, wo es tiefer in dem Schatten des schwammigen Ufers und dichten, überhängenden Gebüsches lag, schwarz und giftig aus. Die Frösche quakten und die Ratten schlüpften, als ich der sumpfigen Seite des Sees näher kam, in dem schattigen Wasser selbst wie lebendige Schatten aussehend ein und aus. Ich sah hier, halb aus dem Wasser heraufragend, das verfaulte Wrack eines umgeworfenen alten Bootes liegen, und auf seine trockne Oberfläche fiel durch eine Lücke in den Bäumen hindurch ein schwacher Fleck von Sonnenlicht, in dessen Mitte eine Natter, phantastisch zusammengerollt, verrätherisch still dalag. Nah und fern machte die Aussicht nur denselben traurigen Eindruck von Einsamkeit und Verfall, und die helle Pracht des Sonnenhimmels über mir schien die Düsterheit und Kahlheit der Wildniß, auf die sie herableuchtete, nur noch fühlbarer zu machen. Ich wandte mich um und ging dem höher gelegenen, haideartigen Boden, und von meinem früheren Pfade ein wenig abweichend, einem ärmlichen kleinen hölzernen Schuppen zu, der am äußersten Rande der Pflanzung stand und zu unbedeutend war, um bisher meine Aufmerksamkeit mit der großen wilden Aussicht über den See hin zu theilen.
Als ich mich dem Schuppen nahte, fand ich, daß es früher ein Boothaus gewesen war, und daß dem Anscheine nach später ein Versuch gemacht worden, es zu einer Art rohen Lusthäuschens zu machen, in das man eine Bank von Tannenästen, ein paar Sessel und einen Tisch hineinstellte. Ich trat hinein, um mich ein wenig auszuruhen und wieder zu Athem zu kommen.
Ich war kaum eine Minute in dem Boothause gewesen, als ich gewahr wurde, daß meine schnellen Athemzüge seltsamerweise irgendwo unter mir ein Echo fanden. Ich horchte einen Augenblick mit gespannter Aufmerksamkeit, und hörte ein leises Röcheln, das unter der Bank hervorzukommen schien, auf der ich saß. Meine Nerven werden nicht leicht durch Kleinigkeiten erschüttert, aber bei dieser Gelegenheit sprang ich erschrocken auf, rief, erhielt keine Antwort, sammelte meinen abhanden gekommenen Muth, und blickte unter die Bank.
Da, im fernsten Winkel kauernd, lag die hülflose Ursache meines Schreckens in der Gestalt eines armen kleinen Hundes, ein kleiner schwarz und weißer Wachtelhund. Das Thierchen winselte matt, als ich es ansah und zu mir lockte, rührte sich aber nicht. Ich rückte die Bank fort und blickte näher hin. Des armen Hündchens Augen umzogen sich schnell, und auf seinen weißen Weichen waren Blutflecke. Der Jammer eines armen schwachen, hülflosen, stummen Geschöpfes ist doch von allen Anblicken der Welt der traurigste. Ich nahm das arme Thier so zart wie mir nur möglich war vom Boden auf und legte es in eine Art improvisirter Hängematte, indem ich rund um es her die Falten meines Kleiderrockes aufnahm. Auf diese Weise trug ich es dann so schmerzlos und so schnell als möglich nach dem Hause zurück.
Da ich Niemanden im Vorsaale fand, ging ich sofort auf mein Wohnzimmer, machte aus einem meiner alten Shawls ein Bett für das Thierchen und klingelte dann. Das größte und corpulenteste aller denkbaren Stubenmädchen erschien in einem Zustande munterer Einfältigkeit, die für die Geduld einer Heiligen zu viel gewesen wäre. Ihr dickes, formloses Gesicht dehnte sich zu einem breiten Grinsen aus, als sie das verwundete Thierchen am Boden erblickte.
»Was siehst Du denn da zu lachen?« fragte ich so aufgebracht, wie wenn sie meine eigene Dienerin gewesen wäre »Weißt Du, wem der Hund gehört?«
»Nein, Miß, das weiß ich nicht.« Sie bückte sich und sah die verwundete Seite des Thierchens an, dann erhellte sich ihr Gesicht plötzlich wie durch eine Eingebung, und mit einem Kichern der Zufriedenheit auf die Wunde deutend, sagte sie: »Das hat Baxter gethan, das.«
Ich war so entrüstet, daß ich sie hätte ohrfeigen können
»Baxter?« sagte ich, »wer ist das Thier, den du Baxter nennst?«
Das Mädchen grinste breiter denn je. »Mein Gott, Miß, Baxter ist der Holz- und Wildwärter, und wenn er hier fremde Hunde jagen findet, so geht er und schießt sie, ja. Das ist den Wildwärter seine Pflicht, Miß. Der Hund wird wohl sterben. Dies ist die Stelle, wo er geschossen worden ist, nicht wahr? Das hat Baxter gethan, Miß, hat er. Baxter hat’s gethan, Miß, und ’s ist Baxter’s Pflicht, ja.«
Ich war beinahe schlecht genug zu wünschen, Baxter hätte lieber das Stubenmädchen anstatt des Hundes angeschossen. – Da ich sah, daß es nutzlos sei, von diesem begriffslosen Frauenzimmer Hülfe für den kleinen Hund zu erwarten, ersuchte ich sie, der Haushälterin meine Empfehlung zu machen und sie zu bitten, zu mir zu kommen, Sie ging, wie sie gekommen war, von einem Ohr bis zum andern grinsend. Als sie die Thür schloß, sagte sie noch einmal leise vor sich hin: »Das hat Baxter gethan, und es war Baxter seine Pflicht, war es.«