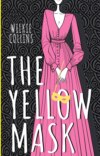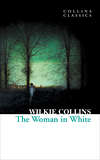Czytaj książkę: «Detektiv-Geschichten», strona 5
V
Ich hatte meine beste Kleidung angelegt und mir im ganzen früheren Leben nie so viele Mühe wie diesmal mit meiner Frisur gegeben. Hoffentlich wird niemand so töricht sein zu glauben, dass ich dies wegen Herrn Sax getan hätte. Wie konnte ich mich denn um einen Mann kümmern, der mir kaum etwas anderes als ein Fremder war. Nein! Die Person, derentwegen ich mich herausputzte, war Fräulein Melbury.
Sie warf mir, als ich mich bescheiden in die Ecke setzte, einen Blick zu, der mich reichlich für die Zeit entschädigte, die ich auf meine Toilette verwendet hatte. Die Herren traten ein. Ich blickte aus reiner Neugier unter meinem Fächer hervor nach Herrn Sax. Er war durch den Gesellschaftsanzug sehr zu seinem Vorteil verändert. Als er meiner in der Ecke gewahr wurde, schien er zweifelhaft zu sein, ob er sich mir nähern solle oder nicht. Ich erinnerte mich unserer ersten seltsamen Begegnung und konnte nicht umhin, darüber in Gedanken zu lächeln. Glaubte er vielleicht, dass ich ihn zum Nähertreten ermuntern wolle? Ehe ich mir diese Frage beantworten konnte, nahm er den leeren Platz neben mir auf dem Sofa ein. Bei jedem anderen Manne würde dies nach dem am Morgen zwischen uns Vorgefallenen ein recht keckes Benehmen gewesen sein. Er aber sah so peinlich verlegen aus, dass es eine Art Christenpflicht für mich wurde, Mitleid mit ihm zu haben. »Wollen Sie mir nicht die Hand reichen?« sagte er, gerade so, wie er es in Sandwich getan hatte. Ich blickte unter meinem Fächer hervor nach Fräulein Melbury und nahm wahr, dass sie nach uns herübersah. Ich reichte Herrn Sax die Hand.
»Was für eine Empfindung haben Sie « fragte er, »wenn Sie einem Manne die Hand reichen, den Sie hassen?«
»Ich kann es Ihnen wirklich nicht sagen« erwiderte ich in treuherziger Weise, »denn ich habe so so etwas nie getan.«
»Sie wollten in Sandwich nicht mit mir frühstücken« erklärte er, »und wollen mir nun auch nach der demütigsten Entschuldigung meinerseits das nicht verzeihen, was ich diesen Morgen tat. Soll ich unter diesen Umständen glauben, dass ich nicht ein besonderer Gegenstand Ihres Widerwillens bin? Ich wünsche, ich wäre Ihnen nie begegnet! In meinem Alter kränkt es einen Mann, wenn er unfreundlich behandelt wird und dies nicht verdient hat. Ich darf wohl sagen, Sie verstehen das nicht.«
»O ja, ich verstehe dies. Ich hörte auch, was Sie von mir zu Frau Fosdyke sagten und ich hörte Sie die Tür zuschlagen, als Sie mir aus dem Wege gingen.« Er nahm diese Antwort anscheinend mit großer Befriedigung entgegen.
»Sie lauschten also? wirklich? Ich bin froh, dies zu hören.«
»Warum?«
»Es zeigt mir, dass Sie am Ende doch einiges Interesse an mir nehmen.«
Während dieses ziemlich wertlosen Gespräches, das ich nur erwähne, weil es zeigt, dass ich keinen Groll hegte, blickte Fräulein Melbury nach uns wie der Basilisk der Alten. Sie gestand zu, über die Dreißig hinaus zu sein, und sie hatte etwas Geld – aber dies war doch sicherlich kein Grund, weshalb sie eine arme Erzieherin anstarren sollte. Bestand vielleicht schon ein zärtliches Einverständnis zwischen ihr und Herrn Sax? Sie reizte mich zu dem Versuche, dies herauszubringen, besonders da die letzten Worte, die er gesprochen hatte, mir die Gelegenheit dazu boten.
»Ich kann beweisen, dass ich ein aufrichtiges Interesse für Sie hege« begann ich wieder. »Ich kann Ihnen zugunsten einer Dame entsagen, welche einen weit besseren Anspruch auf Ihre Aufmerksamkeit hat als ich. Sie vernachlässigen diese Dame wirklich in unverantwortlicher Weise.«
Er war augenscheinlich in Verlegenheit und starrte mich in einer Weise an, die deutlich verriet, dass bis jetzt seine Zuneigung der Dame wirklich zugewendet war. Es war natiirlich unmöglich, Namen zu nennen, und ich gab daher meinen Augen nur die rechte Richtung. Er blickte in der gleichen Richtung – und seine Verlegenheit verriet sich selbst trotz seines Bestrebens, sie zu verbergen. Er errötete und schien gekränkt und überrascht zu sein. Fräulein Melbury konnte dies nicht länger ertragen. Sie erhob sich, nahm ein Lied vom Musikpulte und näherte sich uns.
»Ich will etwas singen,« sagte sie, indem sie ihm das Musikstück überreichte »Bitte, Herr Sax, wenden Sie mir das Blatt um.« Ich glaube, er zögerte – aber ich bin nicht sicher, ob ich ihn richtig beobachtete. Es ist wenig daran gelegen. Ob zögernd oder nicht, er folgte ihr nach dem Klavier.
Fräulein Melbury sang und beherrschte dabei mit vollkommener Sicherheit ihre umfangreiche Stimme. Ein Herr, der in meiner Nähe saß, sagte, sie gehöre auf die Bühne. Ich dachte auch so. Denn so groß auch unser Empfangszimmer war, für sie war es nicht ausreichend. Gleich darauf sang der Herr. Er hatte gar keine Stimme, aber sein Gesang war so lieblich und von einem so echten Gefühle durchdrungen! Ich wandte ihm das Blatt um. Eine liebe, alte Dame, die in der Nähe des Klaviers saß, fing eine Unterhaltung mit mir an und sprach von den berühmten Sängern aus dem Anfange des gegenwärtigen Jahrhunderts.
Herr Sax, auf den fortwährend Fräulein Melburys Auge gerichtet war, wanderte umher. Ich war von den Anekdoten meiner ehrwürdigen Freundin so entzückt, dass ich ihm keine Beachtung schenken konnte.
Später, als die Tischgesellschaft sich auflöste und wir uns zur Nachtruhe begeben wollten, wanderte er noch immer umher und bot mir schließlich eine Schlafzimmerkerze an. Ich händigte sie sogleich an Fräulein Melbury aus.
Es war wirklich ein sehr genussreicher Abend.
VI
Am nächsten Morgen wurden wir durch das ungewöhnliche Benehmen eines unserer Gäste beunruhigt. Herr Sax hatte Charsham Hall mit dem ersten Zuge verlassen und niemand wusste warum. Die Frauen sind – so sagen wenigstens die Philosophen – von Natur mit schweren Bürden belastet. Haben jene gelehrten Leute dabei auch die Bürde der Hysterie im Auge gehabt? Wenn das der Fall ist, dann stimme ich von ganzem Herzen ihnen bei. Es ist indessen in meinem Falle kaum der Mühe wert, davon zu sprechen, – ein ganz natürliches Leiden, das in der Einsamkeit des Zimmers zum Ausdruck kommt, mit Wasser und Eau de Cologne behandelt wird und dann, wenn ich in mein Erziehungsgeschäft vertieft bin, wieder völlig vergessen ist. Mein Lieblingszögling Fritz war früher als wir übrigen außer Bett gewesen und hatte im Obstgarten die frische Morgenluft genossen. Er hatte Herrn Sax gesehen und ihn gefragt, wann er wieder zurückkomme. Und Herr Sax hatte gesagt: »Ich werde nächsten Monat wieder zurück sein.« (O liebes Fritzchen!)
Mittlerweile hatten wir in unserem Schulzimmer die Aussicht auf eine langweilige Zeit im leeren Hause. Denn die übrigen Gäste mussten am Ende der Woche weggehen, da ihre Hauswirtin genötigt war, einigen alten Freundinnen in Schottland einen Besuch abzustatten.
Obwohl ich während der nächsten drei oder vier Tage mit Frau Fosdyke oft allein war, so sagte sie doch niemals ein Wort von Herrn Sax. Ein oder zwei Mal aber ertappte ich sie dabei, wie sie mit ihrem bedeutungsvollen Lächeln nach mir blickte, das mir unerträglich war. Fräulein Melbury wurde ebenfalls unangenehm, aber in anderer Weise. Wenn wir uns zufällig auf der Treppe begegneten, schossen rasche Blicke voll Hass und Vernichtung aus ihren schwarzen Augen.
Glaubten diese beiden Damen etwa —?
Doch nein; ich enthielt mich damals, diese Frage zu vollenden; und ich enthalte mich auch jetzt, dies hier zu tun.
Das Ende der Woche kam heran, und ich und die Kinder wurden zu Charsham Hall allein gelassen.
Ich benutzte die Mußestunden, die mir zur Verfügung standen, um an Herrn von Damian zu schreiben, und erkundigte mich ehrerbietigst nach seinem Befinden, indem ich ihn zugleich benachrichtigte, dass ich in der Erlangung einer neuen Stelle wieder sehr glücklich gewesen sei. Mit wendender Post erhielt ich die Antwort. Begierig öffnete ich sie, und schon die ersten Zeilen benachrichtigten mich von Herrn von Damians Tode.
Der Brief entfiel meiner Hand, und ich blickte unwillkürlich nach meinem kleinen Emailkreuz. Es ist mir nicht gegeben zu sagen, was ich fühlte. Man denke an alles, was ich ihm zu verdanken hatte, und erinnere sich, wie traurig mein Schicksal in der Welt war. Ich gab den Kindern frei; es war ja nur die Wahrheit, wenn ich ihnen sagte, dass mir nicht wohl sei.
Wie lange es dauerte, bis ich daran dachte, dass ich nur die ersten Zeilen des Briefes gelesen hatte, vermag ich nicht zu sagen. Als ich ihn wieder aufhob, war ich überrascht zu sehen, dass das Schreiben zwei Seiten umfasste. Kaum hatte ich einen Augenblick weiter gelesen, als mir schwindlig wurde. Als ich die drei ersten Sätze gelesen hatte, befiel mich eine schreckliche Furcht, dass ich nicht recht bei Sinnen sein möchte. Hier sind sie, um zu zeigen, dass ich nicht übertreibe:
»Das Testament unseres verstorbenen Klienten ist noch nicht eröffnet, aber mit Zustimmung der Testamentsvollstrecker setze ich Sie vertraulich davon in Kenntnis, dass Sie an diesem Testament ein ganz besonderes Interesse haben. Herr von Damian vermacht Ihnen bedingungslos sein ganzes bewegliches Vermögen, das sich auf die Summe von siebzigtausend Pfund beläuft.«
Wenn der Brief damit geendet hätte, so könnte ich mir wirklich nicht denken, welche Torheiten ich nicht begangen haben möchte. Aber der Schreiber des Briefes, einer der Anwälte des Herrn von Damian, hatte mir aus eigenem Antriebe noch etwas mehr zu sagen. Die Art und Weise, wie er es sagte, erregte mich augenblicklich. Ich kann und will die einzelnen Worte hier nicht wiederholen Es ist gerade genug, ihren empörenden Inhalt wiederzugeben. Die Absicht des Mannes war augenscheinlich die, mich merken zu lassen, dass er das Testament missbillige. Insofern will ich mich nicht über ihn beklagen – er hatte ohne Zweifel seinen Grund für die gute Meinung, die er hegte. Aber indem er »über diesen außerordentlichen Beweis von Interesse seitens des Testators einem der Familie gänzlich fremden Frauenzimmer gegenüber« seine Verwunderung ausdrückte, ließ er zugleich den Verdacht gegen einen von mir aus Herrn von Damian geübten Einfluss durchblicken, in so schändlicher Weise, dass ich mich dabei nicht aufzuhalten vermag. Die Ausdrucksweise war, wie ich hinzufügen will, schlau berechnet; denn ich selbst konnte sehen, dass sie mehr als eine Auslegung zuließ, und dass ich mich ins Unrecht setzte, wenn ich sie offen tadelte.
Aber die Absicht war klar, und sie zeigte sich, zum Teil wenigstens, schon in folgenden Sätzen:
»Der jetzige Herr von Damian ist, wie Sie ohne Zweifel wissen, durch das Testament seines Vaters nicht ernstlich berührt. Er ist bereits auf das reichlichste versorgt, da er den gesamten Grundbesitz als Erblehn übernimmt. Auch von alten Freunden, die vergessen worden sind, will ich nicht reden; aber es ist auch ein sehr naher Verwandter des verstorbenen Herrn von Damian übergangen worden. Falls dieser das Testament anfechten sollte, werden Sie natürlich wieder von uns hören, und Sie werden uns dann an Ihren Rechtsbeistand verweisen.«
Das Schreiben endigte mit einer Entschuldigung: die Mitteilung habe sich durch die Schwierigkeit verzögert, meine Adresse zu ermitteln.
Und was tat ich? An den Herrn Pfarrer schreiben oder an Frau Fosdyke? Nein, das nicht.
Anfangs war ich zu unwillig, um darüber nachzudenken, was ich tun sollte. Die Post ging erst abends spät ab; und der Kopf schmerzte mich, als wenn er zerspringen wollte. Ich hatte reichlich Muße, auszuruhen und mich zu sammeln. Als ich meine Ruhe wiedererlangt hatte, fühlte ich mich imstande, meinen Entschluss zu fassen, ohne dass ich jemand um Hilfe ansprach.
Selbst wenn ich freundlich behandelt worden wäre, so würde ich doch sicherlich das Geld nicht angenommen haben, wenn noch ein Verwandter lebte, der einen Anspruch auf dieses hatte. Was brauchte ich ein großes Vermögen! Um mir vielleicht einen Gatten zu kaufen? Nein, nein! Nach allem was ich gehört, hatte der große Lordkanzler ganz recht, wenn er sagte, dass eine Frau, die Geld zu eigener Verfügung hätte, »sechs Wochen nach der Hochzeit entweder durch Küsse oder durch Fußtritte um dieses gebracht würde.«
Die einzige Schwierigkeit, die mir entgegenstand, war nicht die, mein Vermächtnis aufzugeben, sondern meine Antwort mit der genügenden Schärfe und zu gleicher Zeit mit der gebührenden Rücksicht auf meine Selbstachtung zu geben.
Hier folgt sie:
»Mein Herr!
Ich will Sie nicht damit belästigen, dass ich versuche, meine Betrübnis auszudrücken, da ich von dem Ableben des Herrn von Damian höre. Sie würden sich wahrscheinlich auch darüber Ihre eigene Meinung bilden, und ich habe kein Verlangen, von Ihrer nicht sehr beneidenswerten Menschenkenntnis zum zweiten Mal beurteilt zu werden. Was das Vermächtnis betrifft, so fühle ich zwar die aufrichtigste Dankbarkeit gegen meinen edlen Wohltäter, aber ich lehne es trotzdem ab, sein Geld anzunehmen. Ich bitte Sie, mir diejenige Urkunde zur Unterzeichnung zu übersenden, die ich nötig habe, um die Erbschaft dem in Ihrem Schreiben erwähnten Verwandten des Herrn von Damian abzutreten. Die einzige Bedingung, auf der ich bestehe, ist die, dass mir von der Person, zu deren Gunsten ich verzichte, keinerlei Dank bezeugt werde. Selbst angenommen, dass meinen Beweggründen in diesem Falle Gerechtigkeit widerfährt, so wünsche ich doch nicht, zum Gegenstande von Kundgebungen der Erkenntlichkeit nur um deswillen gemacht zu werden, weil ich meine Schuldigkeit getan habe.«
So endigte mein Schreiben. Ich mag unrecht haben, aber ich nenne das ein scharfes Schreiben. Pünktlich kam mit der Post eine förmliche Empfangsbescheinigung an. Ich wurde ersucht, so lange mit der Urkunde zu warten, bis das Testament eröffnet worden sei, und man benachrichtigte mich, dass mein Name inzwischen streng geheim gehalten werden solle. Bei dieser Gelegenheit zeigten sich die Testamentsvollstrecker beinahe ebenso unverschämt wie der Anwalt.
Sie erachteten es als ihre Pflicht, mir Zeit zu geben, um nochmals über eine Entscheidung nachzudenken, die augenscheinlich unter dem Impulse des Augenblicks getroffen worden wäre. Ach, wie hart sind doch die Männer – wenigstens einige von ihnen! Verdrießlich schloss ich den Empfangsschein ein und entschied mich dafür, nicht mehr an ihn zu denken, bis die Zeit käme, in der ich mein Vermächtnis los würde. Ich küsste das kleine Andenken des armen Herrn von Damian. Während ich es noch betrachtete, kamen die guten Kinder unaufgefordert herein, um zu fragen, wie es mir gehe. Ich war genötigt, den Fenstervorhang in meinem Zimmer herab zu lassen, damit sie die Tränen in meinen Augen nicht sähen. Zum ersten Mal seit dem Tode meiner Mutter fühlte ich Herzweh. Vielleicht ließen mich die Kinder an die glücklichere Zeit denken, da ich selbst noch ein Kind war.
VII
Das Testament war eröffnet worden, und ich wurde benachrichtigt, dass die verlangte Urkunde in Vorbereitung sei, als Frau Fosdyke von ihrem Besuche in Schottland zurückkehrte.
Sie meinte, ich sehe sehr bleich und erschöpft aus.
»Die Zeit scheint mir gekommen zu sein,« sagte sie, »wo ich besser täte, Sie und Herrn Sax dazu zu bringen, sich gegenseitig zu verstehen. Haben Sie reuig über Ihr eigenes übles Benehmen nachgedacht?«
Die Schamröte trat mir ins Gesicht.
Ich hatte in der Tat über meine Aufführung Herrn Sax gegenüber nachgedacht, und ich schämte mich ihrer auch aufrichtig.
Frau Fosdyke fuhr, halb im Scherz, halb im Ernste, fort:
»Befragen Sie nur Ihr eigenes Schicklichkeitsgefühl! War der arme Mann zu tadeln, dass er nicht roh genug war, nein zu sagen, wenn eine Dame ihn bat, ihr das Blatt beim Vortrage umzuwenden? Konnte er es verhindern, wenn dieselbe Dame darauf aus war, mit ihm zu kokettieren? Er lief am nächsten Morgen vor ihr fort. Verdienten Sie, dass man Ihnen sagt, warum er uns verließ? Sicherlich nicht – nach der keifenden Weise, in der Sie Fräulein Melbury die Schlafzimmerkerze überreichten. Sie törichtes Mädchen! Glauben Sie, ich sähe nicht, dass Sie in ihn verliebt sind? Dem Himmel sei Dank, dass er zu arm ist, Sie zu heiraten und Sie von meinen Kindern jemals wegzunehmen. Das würde eine lange Verlobung geben, selbst wenn er großmütig genug ist, Ihnen zu verzeihen. Soll ich Fräulein Melbury bitten, mit ihm zurückzukommen?«
Sie hatte zuletzt Mitleid mit mir und setzte sich nieder, um an Herrn Sax zu schreiben. Seine Antwort, die von einem etwa zwanzig Meilen entfernt gelegenen Landhause datiert war, benachrichtigte sie, dass er in drei Tagen wieder in Carsham Hall sein werde.
Am dritten Tage kam das amtliche Schriftstück, das ich unterzeichnen sollte, mit der Post an. Es war an einem Sonntagmorgen, und ich war allein in meinem Schulzimmer.
Als mir der Rechtsanwalt schrieb, hatte er nur auf »einen überlebenden Angehörigen des Herrn von Damian, der sehr nahe mit ihm verwandt sei« angespielt. Die Urkunde sprach sich deutlicher aus. Sie bezeichnete den Anverwandten als einen Neffen des Herrn von Damian, als den Sohn seiner Schwester. Der Name folgte: es war Sextus Cyril Sax.
Ich habe auf drei verschiedenen Blättern versucht, die Wirkung zu beschreiben, welche diese Wahrnehmung auf mich hervorbrachte – und ich habe sie, eins nach dem andern, wieder zerrissen. Wenn ich nur daran denke, scheint schon mein Gemüt rettungslos in die Überraschung und Bestürzung jener Zeit zurückzusinken. Nach allem, was zwischen uns vorgefallen war, – war nun dieser Mann selbst auf dem Wege nach unserem Hause! Was würde er von mir denken, wenn er meinen Namen unter der Urkunde sah? Was um Gottes willen sollte ich tun?
Wie lange ich, die Urkunde im Schoße, bestürzt da saß, weiß ich nicht. Es klopfte jemand an der Tür des Schulzimmers, blickte herein, sagte etwas und ging wieder weg. Alsdann gab es eine Pause. Und dann wurde die Tür wieder geöffnet Eine Hand legte sich sanft auf meine Schulter. Ich blickte auf – und sah Frau Fosdyke, die mich in der größten Besorgnis fragte, was mir fehle. Der Ton ihrer Stimme brachte mich zum Sprechen. Ich konnte an nichts als an Herrn Sax denken; ich konnte nur sagen: »Ist er gekommen?«
»Ja, und er wartet darauf, Sie zu sehen.«
Indem sie in dieser Weise antwortete, blickte sie nach dem Aktenstück auf meinem Schoße. In meiner höchsten Hilflosigkeit handelte ich zuletzt wie ein verständiges Geschöpf. Ich erzählte Frau Fosdyke alles, was ich hier erzählt habe. Sie verharrte sprachlos auf ihrem Platze, bis ich zu Ende war. Dann war es ihr erstes, mich in die Arme zuschließen und mir einen Kuss zu geben. Nachdem sie mich so wieder aufgemuntert hatte, sprach sie zunächst von dem armen Herrn von Damian·
»Wir handelten alle sehr töricht« erklärte sie, »als wir ihn unnötigerweise durch unseren Einspruch gegen seine Wiederverehelichung kränkten. Ich meine Sie nicht – ich meine seinen Sohn, seinen Neffen und mich selbst. Wenn seine zweite Ehe ihn glücklich machte, was ging uns die Ungleichheit der Jahre zwischen ihm und seiner Frau an?
Ich kann Ihnen sagen, Sextus war der erste von uns, der bedauerte, was er getan hatte. Wäre es nicht die einfältige Besorgnis gewesen, eines eigennützigen Beweggrundes beschuldigt zu werden, so würde Herr von Damian gefunden haben, dass in dem Sohne seiner Schwester doch viel Tüchtiges stecke.«
Frau Fosdyke ergriff plötzlich eine Abschrift des Testamentes, die ich bis jetzt nicht einmal bemerkt hatte.
»Sehen Sie, was der gute alte Mann von Ihnen sagt« fuhr sie fort, indem sie auf die betreffenden Worte zeigte.
Ich konnte sie nicht lesen, und sie war genötigt, sie mir vorzulesen »Ich überlasse mein Barvermögen der einzigen noch lebenden Person, die des Wenigen, was ich für sie getan habe, mehr als würdig gewesen ist, und deren einfacher, uneigennütziger Natur ich, wie ich weiß, vertrauen kann.«
Ich drückte Frau Fosdyke die Hand, aber ich war nicht imstande zu sprechen. Sie ergriff zunächst das entworfene Aktenstück.
»Üben Sie Gerechtigkeit gegen sich selbst, und zeigen Sie sich über lächerliche Bedenken erhaben« sagte sie. »Sextus ist so eingenommen für Sie, dass er wohl des Opfers wert erscheint, das Sie ihm bringen wollen. Unterzeichnen Sie – und ich werde dann als Zeugin unterzeichnen.«
Ich zögerte.
»Was wird er von mir denken?« sagte ich.
»Unterzeichnen Sie!« wiederholte Frau Fosdyke, »und wir werden dann sehen.«
Ich gehorchte. Sie bat um den Brief des Rechtsanwalts. Ich gab ihr ihn so, dass die Zeilen, die des Mannes gemeine Verdächtigung enthielten, zusammengefaltet und nur die Worte darüber sichtbar waren, des Inhalts, dass ich auf mein Vermächtnis verzichtet hatte, obwohl ich nicht einmal wusste, ob die beschenkte Person ein Mann oder eine Frau war. Sie nahm dies mit dem kurzen Entwurf meines eigenen Briefes und dem unterzeichneten Verzicht – und öffnete die Tür.
»Bitte, kommen Sie bald zurück und sagen Sie mir das weitere!« bat ich.
Sie lächelte, nickte und ging hinaus.
Ach, welch eine lange Zeit verging, ehe ich das lang erwartete Klopfen an der Tür hörte! »Herein!« rief ich ungeduldig.
Frau Fosdyke hatte mich getäuscht. Statt ihrer war Herr Sax eingetreten. Er schloss die Tür. Wir beide waren allein.
Herr Sax war totenbleich; seine Augen hatten, als sie auf mir ruhten, einen wilden Ausdruck der Bestürzung angenommen. Mit eisig kalten Fingern ergriff er meine Hand und zog sie schweigend an seine Lippen. Der Anblick seiner Erregung ermutigte mich – warum weiß ich bis heute nicht, wenn sie nicht etwa an mein Mitleid appellierte. Ich war kühn genug, nach ihm aufzublicken. Schweigend legte er die Briefe auf den Tisch – und das unterzeichnete Aktenstück daneben. Als ich das sah, wurde ich noch kühner. Ich brach zuerst das Schweigen.
»Sicherlich weisen Sie das Vermächtnis nicht zurück?« fragte ich. Er antwortete mir: »Ich danke Ihnen von ganzem Herzen; ich bewundere Sie mehr, als Worte dies vermögen, aber ich kann es nicht annehmen.«
»Warum nicht?«
»Das Vermögen gehört Ihnen« sagte er freundlich. »Bedenken Sie, wie arm ich bin, und fühlen Sie mit mir, wenn ich nichts weiter sage.«
Sein Kopf sank auf seine Brust. Er streckte die eine Hand aus und flehte mich schweigend an, ihn zu verstehen. Ich konnte dies nicht länger ertragen. Ich vergaß jede Rücksicht, die eine Frau in meiner Lage hätte nehmen müssen, und die verzweifelten Worte entschlüpften mir, ehe ich sie zurückdrängen konnte:
»Sie wollen mein Vermächtnis für sich allein nicht annehmen?«
»Nein.«
»Wollen Sie mich mit annehmen?«
An jenem Abend ließ Frau Fosdyke ihrer guten Laune noch in anderer Weise die Zügel schießen. Sie überreichte mir einen Kalender. »Nach allem, meine Liebe« bemerkte sie, »haben Sie nicht nötig, sich zu schämen, zuerst gesprochen zu haben. Sie haben nur von dem alten Vorrechte unseres Geschlechtes Gebrauch gemacht. Wir haben heuer ein Schaltjahr.«