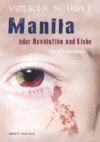Czytaj książkę: «Singapur – oder tödliche Tropen»
Volker Schult, 1960 geboren, studierte Englisch und Geschichte.
Er promovierte in Südostasienwissenschaften und war an verschiedenen deutschen Auslandsschulen als Lehrer und Schulleiter tätig. Schult veröffentlichte zahlreiche wissenschaftliche Publikationen. Zuletzt erschien 2016 im Engelsdorfer Verlag (zusammen mit B. Siever und I. Claussen) der historische Roman
„Tödlicher Orient“.
Volker Schult
SINGAPUR – ODER TÖDLICHE TROPEN
Ein Kolonialroman
Engelsdorfer Verlag
Leipzig
2017
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Copyright (2017) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Coverfoto „Langkawi - Inselparadis der Adler im Regenwald“ © haspil
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
INHALT
Cover
Der Autor
Titel
Impressum
Prolog
1. Kapitel
Insel Penang, 1899. Im Hafen von Georgetown
2. Kapitel
Insel Penang. Der Geheimauftrag
3. Kapitel
Insel Langkawi. Die Schießübungen
4. Kapitel
Straße von Malakka. Ein Gefecht mit Piraten
5. Kapitel
Nordchina. Einige Wochen vorher. Ankunft in Tsingtau
6. Kapitel
Singapur. Die ersten Eindrücke
7. Kapitel
Norddeutschland. Die Jugendfreunde
8. Kapitel
Singapur. Eine Krisensitzung im Government House
9. Kapitel
Singapur. Ein nächtliches Gespräch
10. Kapitel
Singapur. Im Kontor von Behn, Meyer & Co
11. Kapitel
Tsingtau. Auf Besichtigungstour
12. Kapitel
Singapur. Der mysteriöse Brief
13. Kapitel
Singapur. Ein gefährlicher Ausflug
14. Kapitel
Tsingtau. Das Orakel
15. Kapitel
Singapur. Das Geheimnis von Langkawi
16. Kapitel
Singapur. Der Überfall
17. Kapitel
Tsingtau. Die Fahrt in den Taifun
18. Kapitel
Singapur. Zu Ehren der Prinzessin.
19. Kapitel
Singapur. Das nächtliche Treffen
20. Kapitel
Sultanat Johor. Ein tödlicher Ausflug
21. Kapitel
Singapur. Die Opiumhöhle
22. Kapitel
Singapur. Das ersehnte Telegramm
Epilog
PROLOG
Verdammt, denkt er. Wie war das doch bloß noch? War es die tropische Hitze, der Alkohol oder die euphorische Stimmung, in der er sich nach beendetem Auftrag befand? Oder alles zusammen?
Dann das tiefblaue Meer, das Rollen der Wellen wie sie an den Strand ausliefen und die im warmen Tropenwind sich sanft biegenden Palmen. Der exotische und betörende Duft der wachsig weißen fünfzähligen Blüten der wunderschönen Frangipani.
Trotzdem, die Ereignisse, die er wie einzelne Puzzleteile vor sich sieht, ergeben kein Gesamtbild. Da kann er sich noch so anstrengen, bis Kopfschmerzen sein Gehirn martern.
Es war nachts leicht abgekühlt, nicht sonderlich stark, aber genug, um etwas Erleichterung von der tropischen Hitze zu verspüren. Eine leichte Brise bauschte das Moskitonetz und strich sanft über das Bett.
Plötzlich stand sie da, erinnert er sich. In seinem kleinen Zimmer, vor dem Moskitonetz. Nicht gerade eine ausgeprägte Schönheit, aber doch recht ansehnlich. Gewiss, ihr plattes Gesicht glich eher einer Flunder und diese strichförmigen Augen, die wie Schlitze aussahen, hatten ihn nicht sonderlich angesprochen. Aber ihre schlanke, zierliche Gestalt, die langen schwarzen Haare, ihr überraschend heller, ja fast weißer Teint und ihre kleinen festen Brüste machten den zunächst nicht allzu überwältigenden Eindruck mehr als wett.
Das war eine Überraschung, musste er zugeben. Erwartet hatte er diesen abstoßenden, dunklen, manchmal auch bronzefarbenen Teint, wie ihn die meisten Frauen in dieser gottverlassenen feuchtheißen Tropengegend haben. Er war auch so ganz anders als diese sonnengebräunte Haut der Bauernmädels zur Erntezeit in seiner norddeutschen Heimat. Dagegen stand das vorzügliche und treffliche Weiß der Bürgertöchter und der adligen Damen, letztere allerdings jenseits seiner gesellschaftlichen Stellung.
Schon wieder schweifen seine Gedanken ab. Trotz aller Anstrengungen kann er die besagte Nacht immer noch nicht vollständig rekonstruieren. Er weiß noch, wie sie sich plötzlich in seinem Bett befand, unter dem zeltartigen Moskitonetz. Und dann diese Lustschreie, die sie ausstieß, als er in sie drang. Oder waren es eher Schmerzensschreie? Doch diesen Gedanken verwirft er schnell wieder. Aber gleichzeitig beginnt sein Herz schneller zu schlagen und er atmet schwer. Ganz genau kann er sich noch an das anschließende wohlige, entspannte Gefühl erinnern. Kein Wunder nach all der Anspannung in den Tagen zuvor.
Und dann war sie fort.
Am nächsten Morgen beim Frühstück mit all den leckeren exotischen Früchten – die saftige, goldgelbe Mango stellte sich schnell als seine Lieblingsfrucht heraus – hatte sie sich nicht mehr blicken lassen. Dabei hätte er sie doch so gerne wiedergesehen und ihr zugeflüstert, wie schön er die gestrige Nacht doch empfunden hatte.
Es waren unwirkliche Stunden gewesen wie in einem schönen Traum. Für ihn zumindest.
Was er zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, ist, dass er durch sein Verhalten einen Freund in Todesgefahr bringen wird.
Sie reibt sich die Schläfen. Sie ist viel zu müde. Erschöpft lässt sie sich in ihr Bett sinken. Schon ist sie eingeschlafen. Wie lange?
Sie erahnt eine Bewegung an ihrem Bett. Im nächsten Augenblick nähern sich Hände ihrem Hals. Wollen ihn umklammern. Sie will fliehen, kann sich aber nicht bewegen. Sie ist wie gelähmt vor Überraschung und Angst. Reflexartig tritt sie mit ihrem Bein gegen etwas. Ein Aufschrei.
Sie will sich aus dem Bett winden, doch da haben bereits andere Hände ihren Knöchel gepackt. Sie verliert den Halt und schlägt auf die Kante ihres Bettes auf. Sie tritt nach den Händen, die es nun auf ihre Arme abgesehen haben. Ihr bleibt nichts andere übrig, als um sich zu treten. Sie wälzt sich auf den Bauch und will sich auf allen vieren aufrappeln, um sich in Sicherheit zu bringen.
Vergeblich.
Weg von hier, nur weg von hier, schießt es ihr durch den Kopf. Unter allen Umständen. Irgendwie. Schnellstens. Sie muss es schaffen, unbedingt zur Tür zu robben. Sie muss es schaffen. Ihre einzige Chance.
Dann holt sie tief Luft, um einen Schrei anzusetzen. Vielleicht hören sie andere Menschen und eilen ihr zu Hilfe. Hände zerren sie zurück und drehen sie auf den Rücken. Hände nähern sich ihrem Hals. Wollen zudrücken. Dann doch nicht. Aber sie reißen ihr das Jadeamulett von ihrem Hals. Ihr Glücksbringer. Sie will schreien, doch sie bringt keinen Laut hervor. Sie ringt nach Luft. Ihr Gesicht wird immer bleicher, bläulicher. Sekunden erst oder doch schon Minuten?
Keine Ahnung.
Sie spürt wie etwas Hartes, Kaltes und Glattes in sie eindringt. Ein stechender Schmerz durchfährt sie. Sie muss husten. Ihr Mund füllt sich mit Blut, rinnt über ihr Kinn, schließlich auf ihren Hals. Eine warme Flüssigkeit, daran kann sie sich noch erinnern.
Dann tut es nicht mehr weh. Der Schmerz verblasst. Genau wie die Gestalten um sie herum.
Sie sieht ein großes schwarzes Loch vor sich. Anschließend wird es dunkel und still. Ganz still.
1. KAPITEL
INSEL PENANG, 1899. IM HAFEN VON GEORGETOWN
„Wenn Sie meinen, unbedingt Schießübungen veranstalten zu müssen, Herr Kapitän, dann tun Sie es. Aber ich insistiere, dass das Schießen weitab von Georgetown und überhaupt von unserer Insel durchgeführt wird. Unsere Bevölkerung soll nicht wegen des Grollens der Granaten in Angst und Schrecken versetzt werden. Unruhe ist das Wenigste, was wir hier gebrauchen können. Das stört nur unseren regen Handelsverkehr, den Sie sicher schon bei Ihrer Einfahrt in den Hafen bemerkt haben.“
Damit endet die Belehrung durch den wenig eindrucksvollen Hafenkommandanten Anthony Jenkins. Für einen britischen Kommandanten sieht Jenkins in seiner bieder wirkenden Uniform, seinem nichtssagenden runden Allerweltgesicht, seiner Halbglatze und seinem buschig-länglichen Schnurrbart eher aus wie ein bürokratischer Langweiler in einem britischen Provinznest, der meint, es zu etwas gebracht zu haben. Typisch selbstgefälliger Engländer. Aber – und das muss Kapitänleutnant Wilhelm Kurz zugeben – der Engländer im Allgemeinen hat ein Auge dafür, welche Gegenden auf der Welt von strategisch überragender Bedeutung sind.
Da braucht Kurz sich nur seine bisherige Reise nach Penang vor Augen zu führen: Gibraltar, Malta, den Suezkanal, Aden an der Spitze der arabischen Halbinsel, von wo man den Zugang zum Roten Meer kontrolliert und Colombo auf der Insel Ceylon. Und dann erst Penang. Schon vor über einem Jahrhundert, noch kurz vor der Französischen Revolution, haben die Briten sich diese Tropeninsel unter den Nagel gerissen. Und wo war damals das Deutsche Reich? Pah, von einem „Reich“ konnte man bei dem zerrissenen Flickenteppich von kleinen und kleinsten Fürstentümern noch gar nicht sprechen. Da musste erst einer wie Bismarck kommen oder wie unser jetziger Kaiser Wilhelm II. Jawohl, jetzt wird es anders werden. Da werden sich diese Engländer noch umschauen. Aber diese Gedanken behält er lieber für sich.
Mit Penang – das muss Wilhelm Kurz zugeben – hat der Engländer geradezu einen geostrategischen Coup gelandet. Von hier aus kontrolliert er den Zugang zu der Straße von Malakka, eine der meistbefahrensten Meereswege der Welt. Am anderen Ende hat er sich in Singapur niedergelassen. Zu der damaligen Zeit noch ein malariaverseuchtes Sumpfgebiet. Und was hat er daraus gemacht? Den wichtigsten und zentralsten Handelsstützpunkt in ganz Asien aufgebaut.
Singapur ist das nächste Ziel des Kanonenboots Iltis. Auf Singapur freut sich Wilhelm Kurz schon. Aber zunächst ist er mit seinem Schiff hier in Penang – das wohl wichtigste Ziel der gesamten Asienreise.
In seiner tadellos sitzenden weißen Marineuniform, seinen zu einem akkuraten Mittelscheitel gekämmten blonden Haaren, seinem gezwirbelten „Kaiser-Wilhelm-Schnurrbart“, seinem länglich norddeutschen Gesicht, den buschigen Augenbrauen, seinen tiefliegenden blauen Augen, seiner schlanken Gestalt und seiner aufrechten Körperhaltung entspricht Wilhelm Kurz dem landläufigen Idealbild von einem Offizier der kaiserlich-deutschen Marine. Mit seinen vierunddreißig Jahren ist er schon recht erfahren, wenngleich er jünger aussieht. Obwohl noch unverheiratet, würde er den Erwartungen einer jeden Schwiegermutter entsprechen.
Aber vor allem besticht der Bart. Er ist zum modischen Leitbild einer selbstbewussten Nation geworden, jung, dynamisch, windschnittig. Wie ein Reichsadler, der seine Schwingen in die Höhe reckt, prangt er unter der Nase Kaiser Wilhelms II. und nun auch unter denen von hunderttausenden jungen Männern. Dabei ist es alles andere als einfach, dass die nach außen gekämmten, seitlich längeren Barthaare mit hochgezwirbelten Enden ihre Form behalten. So trägt man während der Nacht eine hinter den Ohren zu befestigende Bartbinde. Außerdem befeuchtet man ihn mit einer extra vom Hoffriseur des Kaisers entwickelten Barttinktur der Marke „Es ist erreicht“, eine Pomade mit dem zentralen Bestandteil des neuen Produkts Vaseline. Schnell verbreitet sich der Name eines solchen Barts als „Es-ist-erreicht-Bart“.
Mit stoischer Ruhe und in bester Manier hat sich Wilhelm Kurz die Tiraden des britischen Hafenkommandanten angehört. Von einem deutschen Marineoffizier erwartet man eine solche Haltung. Für ihn stellt das kein Problem dar. Er muss sich nicht großartig verstellen. Es entspricht vielmehr seinem Naturell.
In bestem Schulenglisch entgegnet Kapitänleutnant Kurz seelenruhig, aber mit überraschend sanfter, fast heller Stimme:
„Sir, ich weiß Ihren Hinweis sehr zu schätzen. Seien Sie versichert, mein Schiff wird der gastfreundlichen Bevölkerung von Penang keine Unbill bereiten“, wobei er bei diesen Worten innerlich grinsen muss. Aber Wilhelm Kurz fährt mit souverän gesetzter Ironie fort:
„Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um weit genug von Penang diese wichtigen Schießübungen abzuhalten. Danach werden wir unverzüglich Richtung Singapur dampfen, wo wir bereits angemeldet sind. Ich darf mich für Ihre überaus große Gastfreundschaft, die dem glorreichen Britischen Empire zur Ehre gereicht, im Namen der kaiserlich-deutschen Marine überschwänglichst bedanken. Zugleich wünsche ich Ihnen eine geruhsame Nacht und bitte, auf mein Schiff zurückkehren zu dürfen, Sir.“
Mit diesen Worten verlässt Wilhelm Kurz das Büro des Hafenkommandanten in Fort Cornwallis. Auf dem langen Korridor bleibt er erst einmal stehen, atmet tief und heftig ein.
Ursprünglich umgaben das alte Fort Cornwallis hölzerne Palisaden. Dann wurde es mit einer massiven Steinmauer versehen, allerdings nicht sonderlich hoch, wie Kapitänleutnant Kurz mit einem kurzen Seitenblick bemerkt. Zwar umschließt das Fort ein Graben von neun Meter Breite und zwei Meter Tiefe, aber einer richtigen Belagerung würde es keinesfalls ernsthaft standhalten. Es hat mehr symbolische als militärisch-strategische Funktion.
Außerdem dekorieren die altertümlichen Kanonen das Fort eher, als dass sie es schützen. Ursprünglich haben die Holländer sie dem Sultan von Johor vor zwei oder drei Jahrhunderten als Geschenk überreicht. Dann aber wurden sie von den Portugiesen in Besitz genommen und gelangten irgendwie nach Java und anschließend in das Sultanat Aceh an der Nordspitze von Sumatra, bevor die Kanonen in den Besitz der Engländer kamen.
Und die hatten dann nichts Besseres zu tun, als Fort Cornwallis mit diesen Museumsstücken auszustatten. Die Briten verstehe, wer will. Aber so richtig hat Wilhelm Kurz die Ausführungen von Jenkins, die der ihm mit stolzgeschwellter Brust vortrug, nicht behalten. Komplizierte Geschichte hier unten. Das einzige, was ihn als Marineoffizier wirklich interessiert, ist der einundzwanzig Meter hohe Leuchtturm, der sich in der nordöstlichen Ecke des Forts befindet.
Dann setzt Kapitänleutnant Wilhelm Kurz seinen Weg mit resoluten Schritten fort. Als er in den gerade angebrochenen Tropenabend tritt, kann er sich ein wohlgefälliges Lächeln nicht verkneifen. Das hätte ja gar nicht besser laufen können, sagt er zu sich selbst, schließt die Augen und atmet noch einmal tief durch.
Der Jenkins hat das geschluckt. Natürlich werden wir die Schießübungen fern von Penang abhalten. Ganz in unserem Sinne. Den Engländern geht mittlerweile jedes Gespür für die Interessen anderer Mächte ab. Sie sind selbstgefällig geworden. So ist es eben, wenn man seit Jahrzehnten die Welt beherrscht. Keinen Schneid mehr, sondern ein Krämervolk durch und durch eben. Ausgenommen davon bleibt ihre Marine, die Royal Navy. Wie fast jeder deutsche Marineoffizier spricht auch Wilhelm Kurz nur voller Hochachtung und großer Anerkennung von ihr.
Währenddessen denkt Hafenkommandant Jenkins in seinem Büro nach. Schön, der Deutsche scheint es ihm abgenommen zu haben, dass er, Jenkins, nichts weiß. Soll er es doch glauben. Gut, dass wir so effektive Kontakte in dieser Gegend unterhalten. Schließlich sind wir schon länger hier, als diese Neuankömmlinge und arroganten deutschen Aufsteiger. Und ganz so unbestechlich, wie sie sich immer gerieren, sind sie auch nicht. Dieser deutsche Newbronner oder wie auch immer der heißt, war nicht ganz billig, aber dann umso williger. Ja, ja, Geld regiert die Welt.
Die Kontakte zu unserem chinesischen Mittelsmann sind auch hergestellt, sinniert Anthony Jenkins weiter. Auch nicht ganz billig. Aber was bedeutet schnöder Mammon gegen Einfluss und Macht. Was bilden diese Deutschen sich eigentlich ein, sich in dieser Gegend, die doch eindeutig unser Einflussgebiet ist, einmischen zu wollen? Typisch deutsche Arroganz. Aufsteiger eben. Na ja, die werden noch ihr blaues Wunder erleben. Aber wir müssen wachsam sein und unsere Widersacher nicht unterschätzen. Das ist das Schlimmste, was wir tun können. Wir müssen einen klaren Kopf bewahren und entschlossen handeln, wenn nötig. Dazu sind selbstverständlich sowohl er, Anthony Jenkins, als auch seine Kollegen in Singapur bereit. Da ist er sich sicher.
Auf dem Weg zurück zu seinem Schiff wird Wilhelm Kurz wieder deutlich, was für ein geschäftiger und betriebsamer Hafen Georgetown doch ist. Von hier fahren alle möglichen Arten von Schiffen in die Straße von Malakka ein und aus, von einheimischen Auslegerbooten, Sampans, die als Fischerboote oder für kleinere Transporte benutzt werden, bis hin zu Dampfschiffen aller Größenordnungen. Im Hafen löschen sie ihre Fracht, nehmen neue auf und kohlen.
Die Zinnminen und Gummiplantagen auf dem gegenüberliegenden Festland haben Penang reich werden lassen. Zwar unterhalten tamilische Muslime aus Indien schon seit langer Zeit Handelsbeziehungen mit Penang, doch die mächtigste und einflussreichste Elite bilden die Chinesen mit ihren weitverzweigten Verflechtungen in der gesamten Region. Mit ihren Großfamilien wohnen sie in den prächtigsten Häusern der Insel. Sie sind stolz auf ihre Familientraditionen. Die Ehre der Familie geht ihnen über alles.
Die ursprünglichen Einwohner, die Malaien, hingegen sind vorwiegend Bauern und Fischer, die in den Dörfern über die Insel verstreut siedeln. Die Malaien machen einen sehr freundlichen, aber auch trägen Eindruck. Wahrscheinlich sind sie von der natürlichen Fruchtbarkeit der Tropeninsel und dem sie umgebendem Meer so verwöhnt, dass sie lieber darauf warten, dass ihnen eine Kokosnuss auf den Kopf fällt, als sie selber mühselig zu ernten. Nach Wilhelm Kurz erstem Eindruck kann er das voll und ganz bestätigen.
Die im Wasser liegenden Bojen, die den Weg in den Hafen weisen, sind auch des Nachts erleuchtet. Gerade nachts herrscht hier ein reges Treiben. Frachtschiffe aus allen Herren Länder, einheimische Boote beladen mit den tropischen Produkten der fruchtbaren Gegend und chinesische Sampans von der gegenüberliegenden malaiischen Halbinsel befahren den Hafen.
Kapitänleutnant Kurz militärisches Auge bemerkt sofort, dass der Hafen von Georgetown über keine Küstengeschütze zum Schutz verfügt, sondern im Ernstfall ausschließlich auf die Kriegsschiffe, die im Hafen ankern, angewiesen ist. Auch die Mauern, die Fort Cornwallis umgeben, sind äußerst niedrig. Im Kriegsfall bieten sie keinen wirklichen Schutz. Der Ankerplatz, der den Kriegsschiffen zugewiesen wird, befindet sich an der Hafenmündung, nicht weit von Fort Cornwallis entfernt. Diese Tatsachen registriert Wilhelm Kurz sehr aufmerksam.
Währenddessen passiert die Rikscha, die er nach dem Gespräch mit Kommandant Jenkins genommen hat, den Rotlichtdistrikt von Georgetown. Das Verhältnis von Mann und Frau in der chinesischen Gemeinde, so hat Kurz von Jenkins erfahren, beträgt ungefähr zwei zu eins. Penang ist voll von jüngeren, unverheirateten Chinesen, die hier ihr Heil suchen. Die meisten von ihnen stammen aus ärmeren Familien in China und hoffen in ihrer Verzweiflung, ihr Glück in Übersee zu finden. Andere werden aus schierer wirtschaftlicher Not von ihren Familien einfach verkauft, so auch Frauen. Kaum einer von ihnen schafft es, sich in höhere Schichten emporzuarbeiten. So sind die Campbell Street und die Cintra Street voll von Prostituierten. Alleine in der Campbell Street sollen an die achthundert von ihnen leben und arbeiten. Fürchterlich, denkt Kurz. Nein, das, obwohl unverheiratet, ist nichts für ihn. Alleine der Gedanke an diese dreckigen Spelunken und stinkenden Absteigen voller Unrat und Ratten und den damit verbundenen Gefahren lassen ihn erschaudern.
Als er das auf ihn wartende Beiboot besteigt, das ihn zu seinem Schiff bringt, redet sich Wilhelm Kurz gedanklich noch einmal kurz in Rage. Sein Gesicht verzieht sich ein Stück. Diese verdammten Engländer haben aber auch einfach alle strategisch wichtigen Gegenden schon lange besetzt. Und sein Vaterland steht mit leeren Händen dar. Das hat er erst jetzt wieder in den letzten Wochen erlebt. Aber vielleicht kann er zumindest etwas Abhilfe schaffen, beruhigt er sich selber.