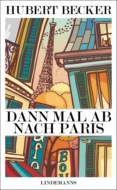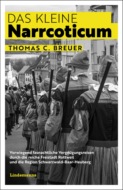Czytaj książkę: «Der Gestrandete»

Volker Kaminski, geboren 1958 in Karlsruhe, hat Germanistik und Philosophie studiert, lebt in Berlin. Neben Kurzgeschichten, Rezensionen und Glossen (Berliner Zeitung) hat er bisher sechs Romane veröffentlicht, zuletzt „Gesicht eines Mörders“ (2014), „Rot wie Schnee“ (2016) und „Auf Probe“ (2018). Seit 2014 ist er Lehrbeauftragter an der Alice Salomon Hochschule Berlin für das Modul Creative Writing/Romanwerkstatt.
Volker Kaminski
Der Gestrandete
Roman
1
Als das Handy in meiner Sakkotasche klingelte, zog Eveline die Augenbrauen hoch. „Keine Handys am Esstisch“, so lautete eigentlich unsere bewährte Familienregel. Das galt besonders bei meinen Schwiegereltern, sonntags beim Mittagessen. Daran hielt sich selbst Johanna, die immer geduldig bis zum Nachtisch wartete, bevor sie sich mit ihrem Handy in den Garten oder aufs Sofa zurückzog.
Heute war Johanna nicht dabei, sie hatte bei einer Freundin übernachtet. Von ihr kam der Anruf, wie ich jetzt sah, vielleicht war sie schon zu Hause und wollte sich zurückmelden. Ich hielt das Handy ans Ohr und verließ das Zimmer.
„Papa, stell dir vor, was passiert ist!“ Johanna klang ziemlich aufgeregt. „Ich bin gerade nach Hause gekommen und wollte mir aus dem Keller eine Flasche Mineralwasser holen. Da sehe ich, dass dort unten das Licht brennt, ich hab mich gewundert und bin leise runtergegangen – und dann sitzt dort ein Typ am Tisch!“
„Was für ein Typ?“
„Ich weiß nicht, ein Mann eben. Er sitzt da am Tisch, trinkt Wein und blättert in irgendeiner Zeitschrift ... Ich bin ganz schnell wieder hoch und habe die Kellertür abgeschlossen. Zweimal.“
Ich erklärte ihr ruhig, dass sie alles richtig gemacht habe und jetzt kein Grund mehr zur Panik bestehe.Wir würden sofort aufbrechen und spätestens in einer Viertelstunde zu Hause sein.
„Shit“, sagte ich, als ich an den Tisch zurückging, „zu Hause hat sich ein Malheur ereignet. Hanna hat beim Nachhausekommen festgestellt, dass unsere Waschmaschine ausgelaufen ist und jetzt der halbe Keller unter Wasser steht!“
Dabei blickte ich Eveline so intensiv an, dass sie ihren Widerspruch, der ihr auf der Zunge lag, unterdrückte.
„Ach Gott, das alte Ding“, sagte sie, „da sollten wir uns gleich mal um die Überschwemmung kümmern.“ Sie stand auf und begann ein paar Teller einzusammeln.
„Lass das doch, Kind“, sagte ihre Mutter, „das mach ich schon. Geht nur gleich nach Hause.“
„Wieder mal die Technik“, seufzte ihr Vater, „immer funkt sie einem dazwischen. Lasst uns aber heute Abend wenigstens noch mal telefonieren.“
Bereits auf dem Weg zum Auto klärte ich Eveline über den wahren Inhalt des Telefongesprächs auf.
„Wer kann das sein?“, fragte sie, als wir im Wagen saßen und starteten. „Was will der Mann in unserem Haus? Das ist doch Wahnsinn! Kannst du dir einen Reim darauf machen?“
Ich schwieg.
„Ein Einbrecher verhält sich doch nicht so, oder?“
„Glaub ich auch nicht. Hanna sagt, er sitzt hinter der verschlossenen Kellertür und rührt sich nicht. Wir werden es ja gleich erfahren.“
„Wir müssen die Polizei rufen.“
„Lass uns doch erst mal nach Hause fahren, die Lage sondieren. Vielleicht gibt es ja eine harmlose Erklärung.“
„Ich ruf Hanna noch mal an.“ Sie nahm ihr Handy heraus und drückte die Tasten. „Mäuschen, geht es dir gut? ... Okay ... ich weiß auch nicht ... ja, wir sind schon unterwegs. Wir überlegen dann erst mal ... Bleib bitte vom Keller weg ... Geh doch vors Haus und warte dort auf uns ... Bis gleich. – Also nichts Neues“, sagte sie zu mir gewandt.
Ich nickte.
„Ich verstehe nicht, wie du so ruhig bleiben kannst“, sagte sie ungeduldig.
„Ich bin überhaupt nicht ruhig. Ich denke nur, dass es nicht nötig ist, jetzt schon die Polizei zu rufen.“
„Wieso ... Das kann doch nicht dein Ernst sein!“ Ihre Stimme überschlug sich vor Aufregung.
Ich konzentrierte mich einen Moment lang auf den Verkehr. „Evi, ich weiß so wenig wie du, wer das ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es jemand ist, den ich kenne.“
„Den du kennst? – Wer würde so etwas tun? Einfach ins Haus spazieren? Wie ist er überhaupt hineingekommen?“
„Vielleicht über den Garten. Wahrscheinlich war das Tor nicht abgeschlossen und Hanna hat die Terrassentür aufgelassen. Jedenfalls hätte sie einen Einbrecher doch sicher gehört. Ich glaube, der wollte einfach nur zu uns.“
„Sascha, du machst mich verrückt! Von wem sprichst du? Wer sitzt da in unserem Keller?“
Ich wollte Eveline nicht noch nervöser machen.
„Hör zu, ich vermute, dass es ein alter Freund ist. Ich meine ... ein Schulkamerad aus Frankfurter Zeiten. Ja, pass auf, kürzlich ist er mir nämlich in der Galerie Weinbrenner über den Weg gelaufen. Er heißt Frank. Ich habe ihn seit Ewigkeiten nicht gesehen. Wir haben kurz miteinander gesprochen, er hat sich sehr gefreut und ich habe ihm meine Visitenkarte gegeben. Er erzählte etwas von Schauspielerei, und da dachte ich an deine Theatergruppe und wollte ihm behilflich sein. Ich meine, ich habe nicht angenommen, dass er gleich zu uns nach Hause kommt.“
„Und du meinst, der könnte das sein? Aber wie kommt er dazu in unser Haus einzudringen, wenn wir nicht da sind?“
Darauf wusste ich nichts zu sagen.
Wir bogen bereits in den Albring ein und fuhren die kleine Auffahrt hoch.
Beim Aussteigen wurde mir wieder bewusst, wie schön unser Haus war, wie gut erhalten die alte Villa aussah, die weiß gekalkten Wände, der grüne Baldachin über dem Eingang, die mit Backsteinen eingefassten Fenster. Evelines Eltern hatten dreißig Jahre darin gewohnt, bevor sie in eine altersgerechte Parterrewohnung in der Innenstadt umzogen und uns das Haus überließen. Von der nahen Alb wehte eine frische Brise herüber und das konstante Rauschen des Wehrs klang vertraut.
Johanna stand ungeduldig vor der Haustür und schaute uns entgegen.
„Alles klar?“, fragte ich, während ich die Eingangsstufen hoch hastete.
„Johanna-Schätzchen, Papa wird schon alles regeln“, hörte ich Eveline hinter mir sagen.
Johannas Blick war vorwurfsvoll, wie ich im Vorbeigehen feststellte. Ich ging direkt auf die Kellertür zu und drehte den Schlüssel um.
„Wartet hier, ich bin gleich zurück.“
„Aber Papa, das ist doch gefährlich!“
„Glaube ich nicht. Nicht, wenn es Frank ist.“
„Frank? Was denn für ein Frank? Heißt das, du kennst ihn?“
Ich blinzelte ihr aufmunternd zu, zog die schwere Holztür auf und trat auf die Treppe.
Frank war nur irgendein Schulfreund. Ich hatte zu keinem meiner früheren Kameraden noch Kontakt. In der Galerie hatte er mit einer älteren Frau zusammengestanden, Frau Hauser, die häufiger auf Vernissagen ging und mit der ich hin und wieder ein paar Worte wechselte. Als ich Frank neben ihr sah, fiel er mir zuerst gar nicht auf. Aber er sprach mich an und sagte, wir würden uns kennen.
Normalerweise passierten mir solche Zufallsbegegnungen nicht. Es war eher so, dass mir bei kulturellen Veranstaltungen die üblichen Verdächtigen über den Weg liefen. Ich hatte keinen alten Schulfreund in all den Jahren je wieder getroffen. Die meisten waren sowieso in Frankfurt geblieben.
Noch seltener allerdings setzte sich ein alter Klassenkamerad ungebeten in den Keller unseres Hauses und wartete auf mein Kommen.
Wir hatten den Keller nicht umgestaltet, seit Evelines Eltern ausgezogen waren, so dass nach wie vor ein Eichentisch in der Mitte stand, um den ein paar schwere Stühle aufgereiht waren. Hinten gab es eine Eckbank. Es hingen auch einige alte Ölbilder an den Wänden.
Frank saß an der vorderen Stirnseite, mit dem Rücken zum Weinkühler, aus dem er sich bereits bedient hatte. Er drehte sich zu mir um und lächelte, als rechne er mit meinem Wohlwollen.
„Was machst du hier?“, fragte ich.
Vor ihm stand ein Glas Wein, daneben lag der Korkenzieher. Er hatte sich einen Müller-Thurgau geöffnet.
„Hi“, sagte er. „Ich wollte zu dir. Aber jemand hat die Tür abgeschlossen.“
„Das war Johanna. Was glaubst du, sie hat dich für einen Einbrecher gehalten!“
„Das wollte ich nicht“, sagte er mit bekümmerter Miene.
„Ich habe mich übrigens ein wenig bedient, um die Wartezeit zu verkürzen. Ich hoffe, du bist mir nicht böse.“
Ich wartete einen Moment.
„Hör mal, das geht nicht. Du kannst nicht hier herein spazieren und einfach Platz nehmen ...“
„Ich weiß“, unterbrach er mich und stand auf. „Blöd von mir euch einen Schrecken einzujagen. Ich war so fasziniert von diesem schönen alten Haus und eurem herrlichen Garten. Ich war sicher, ihr wärt daheim. Ich habe ein paar Mal laut gerufen, aber keiner hat mir geantwortet, während ich zur Terrasse ging. Dann bin ich auf die Kellertür gestoßen. Die musste ich einfach öffnen und schauen, was es sonst noch Schönes gibt.“
Mir fiel ein, dass Frank schon früher nie um Ausreden verlegen gewesen war. Er konnte einen mit seiner angenehmen Stimme durchaus in Bann ziehen.
„Pass mal auf“, sagte ich und schüttelte den Kopf, „wir haben uns ewig nicht gesehen, treffen uns zufällig irgendwo in der Stadt, und dann kommst du her, ohne vorher anzurufen, und dringst einfach ins Haus ein. Ich fasse es nicht!“
„Sorry, Sascha“, murmelte er.
Ich ging an den Tisch, nahm den Korkenzieher, drehte den Korken heraus und steckte ihn auf die Weinflasche. Dann stellte ich die Flasche zurück in den Weinkühler.
Verlegen lächelnd stand er vor mir. Er trug ein dunkles Sakko, war schlank und sah immer noch recht jung aus. Sein locker gescheiteltes dichtes Haar war schwarz, ohne eine Spur von grau. Er hatte früher schon gut ausgesehen und hatte sich seine Ausstrahlung bis heute bewahrt. Allerdings fiel mir auf, dass er erschöpft wirkte. Seine Haut war blass. Alles in allem kam er mir ausgelaugt vor.
„Also wirklich, was hast du dir dabei gedacht?“
„Tut mir leid“, wiederholte er, seine Stimme verfiel in einen leiernden Singsang, „tut mir echt leid.“
Ich machte kehrt und ging nach oben; er folgte mir die Treppe hinauf, während er sich zum dritten Mal entschuldigte.
Irgendwie fühlte ich mich für sein Hiersein verantwortlich. Oben bog ich in die Diele ab, öffnete die Zwischentür und wartete, dass er kam. Aber er hatte Eveline und Johanna bemerkt, die im Wohnzimmer am Tisch saßen, und ich konnte nicht verhindern, dass er ins Zimmer ging, sich fast auf Eveline stürzte und ihr seine Hand hinstreckte.
„Frank Kalina“, sagte er, „Sie müssen entschuldigen, Frau Fehrmann, dass ich Sie – und Ihre Tochter – erschreckt habe.“ Dabei beugte er sich auch zu Johanna und wollte ihr ebenfalls die Hand geben, doch Johanna blieb mit verschränkten Armen sitzen.
„Moment mal, warum Kalina?“, sagte ich hinter ihm. „Du heißt doch Steiner.“
„Ist der Name meiner Ex-Frau“, sagte er halblaut in meine Richtung. „Es tut mir wirklich leid, dass ich Sie in Aufregung versetzt habe“, wandte er sich wieder an Eveline. „Ich wollte eigentlich mit Ihnen sprechen. Sascha hat mir gesagt, Sie leiten eine Theatergruppe?“
Eveline musterte ihn fragend.
Er erwiderte ihren Blick, offensichtlich beeindruckt von ihrem guten Aussehen, den kurzen blonden Haaren, ihrer schlanken Gestalt.
„Sie interessieren sich fürs Schauspielen?“
„Ich bin Schauspieler“, sagte er freudestrahlend, „aber leider habe ich lange, lange pausieren müssen ... Tja, und jetzt bin ich seit einem Monat in Karlsruhe und erfahre durch Sascha von Ihrer Theatergruppe. Die würde ich mir liebend gerne einmal anschauen.“
„Aha“, sagte Eveline und ließ einen Moment verstreichen. „Wenn Sie wollen, können Sie ja mal vorbeikommen.“
„Mama!“, protestierte Johanna.
Bevor ich etwas dazu sagen konnte, drehte er sich zu mir um und streckte mir die Hand hin.
„Nichts für ungut, Sascha!“
Er schien es auf einmal eilig zu haben und drängte mich aus dem Wohnzimmer. In der Diele unter dem Kronleuchter richtete er seinen durchdringenden Blick auf mich. „Sei mir nicht böse, dass ich heute diese Unordnung angerichtet habe. Das wollte ich wirklich nicht.“
„Schon gut.“
Ich öffnete die Wohnungstür und er ging an mir vorbei ins Freie.
„Ich melde mich wieder, Sascha.“
Ich sagte nichts dazu und schloss die Tür.
2
Natürlich nahm ich an, dass die Angelegenheit damit erledigt war. Ich hatte nicht die Absicht, Frank Kalina noch einmal wiederzusehen. Zwei Wochen lang sprachen wir kein Wort über ihn. Eines Freitagabends, als wir zu zweit beim Essen saßen, überraschte mich Eveline mit der Mitteilung, sie habe Frank probeweise in ihre Gruppe aufgenommen.
Ich war sprachlos. „Was? Er ist wirklich zu euch gekommen? Wie hat er euch denn gefunden? Woher hatte er die Adresse eures Proberaums?“
„Er hat hier angerufen und eine Nachricht auf Band hinterlassen. Wir finden ihn übrigens alle sehr überzeugend und begabt. Ein Glücksfall für unsere Gruppe.“
„Das ist doch ziemlich dreist von ihm, findest du nicht?“
„Warum denn?“
„Nach dem gespenstischen Auftritt, den er bei uns hingelegt hat!“
Sie antwortete nicht und widmete sich in aller Ruhe ihrem Salatteller.
Eveline leitete die Theatergruppe seit ihrer Gründung vor sieben Jahren. Sie hatte neben ihrem Beruf als Physiotherapeutin eine neue Herausforderung gesucht und sie in der Theaterarbeit gefunden. „Die Compagnie“ war eine unabhängige Theatergruppe, die sich in Karlsruhe bereits einen Namen gemacht hatte. Sie spielten überwiegend zeitgenössische Kriminalstücke und Eveline übernahm selbst Rollen und führte meist Regie.
Sie hatten einen Probe- und Aufführungsraum mit angeschlossener Bar; der Zugang führte über einen hübsch gepflasterten Hinterhof. Das Ganze befand sich in einem Altbauensemble in der Südstadt. Eveline hatte über ihre Eltern einen persönlichen Kontakt zum Vermieter hergestellt, dem die Kultur in Karlsruhe am Herzen lag. Für die Miete des Proberaums und die Kosten der Aufführung kam hauptsächlich Eveline auf.
Zu Evelines Theaterarbeit habe ich eine klare Meinung: Ich finde sie großartig. Wenn ich sie auf der Bühne sehe und miterlebe, wie sie mit ihrer Rolle verschmilzt, entdecke ich jedes Mal eine neue Facette ihrer Persönlichkeit. In letzter Zeit hatte es jedoch einen Engpass gegeben, weil ein wichtiges Mitglied weggezogen und das neueste Vorhaben im Sande verlaufen war. Eveline suchte händeringend nach begabten Laienschauspielern, hatte aber nicht die Zeit Annoncen aufzugeben. So war es für sie natürlich ein Lichtblick, dass Frank aufgetaucht war.
„Ich fand sein Verhalten jedenfalls merkwürdig“, sagte ich. „Man dringt nicht in fremde Häuser ein. Was wollte er überhaupt in unserem Keller?“
Sie schaute eine Weile vor sich hin.
„Er ist ein Minimalist.“
„Was meinst du?“
„Er bringt mit wenigen Mitteln sehr viel zum Ausdruck. Zum Beispiel einfach nur gucken. Das ist bekanntlich sehr schwer, und den meisten gelingt das nicht überzeugend. Gucken und dabei derselbe bleiben, der man ist. Frank ist authentisch durch und durch.“
„Woher weißt du das? Du hast ihn doch vermutlich noch nicht spielen sehen.“
„Es ist mir gleich aufgefallen, mir und auch den anderen. Chargieren ist leicht, Grimmassen schneiden, mit den Armen fuchteln. Aber einfach nur dastehen, blicken, ruhig sprechen, das erfordert mehr. Bei Frank passt alles zusammen, Körperbeherrschung, Stimme, Individualität.“
Bestimmt hatte niemand in der Gruppe etwas von seinem frechen „Besuch“ bei uns erfahren. Eveline schien den Vorfall vom vorletzten Sonntag vergessen zu haben und erwähnte ihn mit keinem Wort. Frank habe ihnen sogar versprochen, demnächst ein neues Stück mitzubringen, einen Roman aus der Weltliteratur, den er zurzeit fürs Theater umschreibe.
Mich berührten diese Neuigkeiten wenig. Mein Beruf machte mir zunehmend zu schaffen; als freier Journalist durchlebte ich gerade eine anstrengende, nervenaufreibende Zeit.
Ich arbeitete täglich sechs bis acht Stunden in meinem Büro, schrieb Reportagen, Glossen und kleine Essays und belieferte damit verschiedene Zeitungen, doch der Anteil der abgedruckten Beiträge wurde jedes Jahr geringer. Dabei hatte ich in den zurückliegenden Jahren so viel veröffentlicht, dass ich glaubte inzwischen gewisse Rechte bei den Redakteuren zu besitzen. Da ich die Zeitung weiterhin in Papierform las, weigerte ich mich für Online-Portale zu schreiben. Ich gehörte zu den Leuten, die das Papier knistern hören wollten, die beim Lesen etwas anfassen und riechen mussten.
Da war es für mich kein geringer Trost, dass ich nebenbei eine zweite Aufgabe hatte. Ich arbeitete als verantwortlicher Redakteur eines kleinen Magazins, das mir sehr am Herzen lag: ReFuge, Zeitschrift für Prosa. Es war ein Magazin aus den 1980er Jahren, das bis heute überlebt hatte. Ihr Erscheinen war unregelmäßig, abhängig von der finanziellen Situation des Herausgebers. Wenn Alexander Mill, der Grandseigneur der Zeitschrift, genügend Geld zusammen hatte, rief er mich an, und ich begann Material für eine neue Ausgabe zu sammeln, selbst Geschichten zu schreiben und Texte von befreundeten Autoren zu einem Thema anzufordern. Mill vertraute mir hundertprozentig und ließ mir freie Hand bei der Auswahl der Beiträge. In den fünf Jahren, in denen wir zusammenarbeiteten, war manche glanzvolle ReFuge-Nummer dabei gewesen.
Das neue Heft – die Jubiläumsausgabe Nr. 50 – befand sich gerade in der Planung. Nach längerer Bedenkzeit hatte ich beschlossen, eine der schlimmsten Naturkatastrophen der jüngeren Vergangenheit zum Thema zu nehmen: den Tsunami im Indischen Ozean im Januar 2004. Die Katastrophe jährte sich dieses Jahr zum zehnten Mal; die schrecklichen Bilder der verwüsteten Küstenstädte, die Nachrichten über die unfassbar hohe Zahl an Toten und Betroffenen waren unvergessen.
ReFuge war aber eine Literaturzeitschrift und so sollten die Autoren keine Reportagen liefern. Es ging eher darum, Geschichten zu erzählen, in denen vergleichbare Szenarien eine Rolle spielten. Keine leichte Aufgabe! Ich war sehr gespannt, wie die Ergebnisse sein würden und ob es meinen Autoren gelang, eine Prosa zu schreiben, in der die Schockwellen der Angst und der blanke Terror entfesselter Naturkräfte spürbar waren. Ich selbst mühte mich mit Versuchen dieser Art ab, und so kam es, dass ich fast in jeder freien Minute in die Tasten haute.
Eines Morgens hatte ich mich wieder zwei Stunden mit einer Prosaskizze beschäftigt. Gegen Mittag verließ ich das Büro, um einen Spaziergang zu machen. Ich ging ein Stück die Uhlandstraße hinunter und bog in die Sophienstraße ein, bis ich zum Gutenbergplatz kam.
Mein Blick wanderte zu den Zweigen der Kastanien hinauf, an denen schon die ersten Knospen trieben. Der Gutenbergplatz war wie immer an marktfreien Tagen mit parkenden Autos zugestellt. Ich ging auf den Brunnen zu, ein steinernes Monument mit Verzierungen und einer Kuppel in Form eines Kohlkopfes. Der Brunnen war zwar alt, aber noch immer floss Wasser üppig aus den Rohren. Ich war in den Anblick des schäumenden Wassers vertieft, als mir jemand die Hand auf die Schulter legte.
Ich mag es nicht, wenn sich jemand von hinten anschleicht. In diesem Fall kam hinzu, dass ich den anderen auch noch ungern traf.
„Frank! Mein Gott, du hast mich erschreckt. Was treibst du hier?“
Er überging meine schroffe Begrüßung. „Hi, Sascha. Schön, dich zu sehen. Machst du auch gerade Mittagspause?“
Er schien bester Laune zu sein, trug nur ein dünnes Leinensakko, obwohl an diesem Tag keine Sonne schien und es höchstens 12 Grad warm war.
Bestimmt war er mit dem Auto unterwegs. Hatte er irgendwo in der Nähe meines Büros auf mich gewartet?
„Ich mache einen kleinen Spaziergang. Muss aber gleich wieder zurück.“
„Ach komm, gehen wir einen Kaffee trinken“, sagte er und wies mit einer Handbewegung auf die Häuserreihe gegenüber, wo ein Bistro war. Er ging wie selbstverständlich darauf zu und mir blieb nichts anderes übrig als ihm zu folgen. Ich kannte das Café, war aber schon monatelang nicht mehr dort gewesen. Es war nichts Besonderes, eine schlichte Bäckerei mit einem kleinen Gastraum, bestückt mit Tischen und Stühlen. Im vorderen Teil gab es einen schmalen Lounge-Bereich.
Als wir uns an einem schwarz lackierten Tisch in den tiefen Kunstledersesseln gegenübersaßen, spürte ich, dass meine anfängliche Abneigung gegen ihn nachließ. Vielleicht wollte er mit mir über seine Aktivitäten in der Theatergruppe sprechen. Immerhin hatte ich ihm den Weg dorthin geebnet.
„Ich bin immer noch begeistert, dass wir uns nach so langer Zeit wieder begegnet sind“, sagte er. „Ein solcher Zufall ereignet sich nur einmal im Leben.“
Mir fiel auf, wie reglos sein Gesicht dabei blieb. Die Augen schienen darin das einzig Lebendige. Er lächelte zwar, aber um seinen Mund herum bildete sich kaum ein Fältchen. Vielleicht hatte sich Eveline durch diese Gesichtsstarre täuschen lassen, als sie von seiner Professionalität schwärmte.
„Weißt du, wie lange das her ist?“, fragte er. „Über zwanzig Jahre. Genauer gesagt dreiundzwanzig!“
„Nicht länger?“, fragte ich.
„Genau dreiundzwanzig. Vor dreiundzwanzig Jahren bin ich in die Staaten geflogen. Und danach war alles anders.“
Ich hatte nicht die geringste Ahnung, wie sein Leben verlaufen war. Wir waren zusammen in Frankfurt aufs Gymnasium gegangen und nach dem Abitur noch etwa zwei Jahre locker befreundet gewesen, so glaubte ich mich zu erinnern.
„Wolltest du in Amerika nicht Schauspieler werden?“
„Ja genau, ich träumte von der großen Karriere. Ich hatte schon ein paar kleine Videofilme gedreht und das Schauspielstudium langweilte mich. Dann kann dieser Donald und versprach mir das Blaue vom Himmel.“
„Ein Schauspielagent?“
Frank schien einen Moment in seiner Erinnerung zu suchen, dann schüttelte er den Kopf.
„Er war ein Immobilienmakler, ich habe ihn bei Ponten kennengelernt, eine Firma, bei der ich damals gejobbt habe. Donald irgendwas. Ich habe vergessen, wie er mit vollem Namen hieß. Er sagte, er könnte mich mit einem Produzenten in Hollywood zusammenbringen, er hätte hervorragende Kontakte in die Filmbranche. Er versprach mir jede Art von Unterstützung und kannte auch wirklich jemanden aus dem Business, aber der war schon ziemlich alt und längst aus dem Geschäft.“
„Und du hast geglaubt, du könntest so einfach Hollywoodschauspieler werden? War das nicht ziemlich naiv?“
Plötzlich änderte sich sein Blick. Die Augen wurden schmaler und dunkler, etwas Aggressives ging von ihnen aus.
„Ich war ein Idiot. Ich hätte bei Ponten bleiben und weiter Schauspiel studieren sollen. In Amerika hab ich dann den Faden verloren. Ich blieb dort über ein Jahr und habe nur noch für Donald geschuftet. Er hat mich überall herumgezeigt und mit dem attraktiven jungen Mann an seiner Seite angegeben. Ich war so dumm! Ein Jahr lang habe ich gebraucht, bis ich den Mann durchschaut habe und einsah, dass es leere Worte waren.“
„Aber danach warst du doch wieder hier?“
„Ja, aber zu spät. Ich bekam keinen Boden mehr unter den Füßen, wie man so sagt. Wenn ich weiterstudiert hätte und nicht diesen Blödsinn mit Donald gemacht hätte, dann wäre bestimmt alles anders gekommen, verstehst du? Es wäre einiges nicht passiert, was passiert ist.“
„Was denn zum Beispiel?“
Er kniff die Augen zusammen und sah aus dem Fenster. Wir schwiegen eine Weile. Im Hintergrund lief halblaute Jazzmusik, die das eher trostlose Bistro mit ein wenig Atmosphäre aufpeppen sollte.
„Ach, es ist so vieles falsch gelaufen“, sagte er. „Hast du dich schon mal gefragt, welche Rolle der eigene Wille im Leben spielt, der freie Wille? – Ich vermute, gar keine, er ist nur dazu da, um dir das Gefühl von Souveränität zu geben. Der Rest ist ein Sturm, der dich irgendwo hintreibt.“
Ich musste unwillkürlich an meinen Tsunami-Text denken, der angefangen im Büro lag.
„Und bei dir?“, fragte er. „Wie ist es bei dir gelaufen, bist du zufrieden mit dem Erreichten? Kannst du vom Schreiben leben?“
Ich fand seine Fragen unangebracht und zu direkt, aber er hatte eine Art sie zu stellen – mit dieser angenehm ruhigen Stimme –, dass sie beinahe harmlos klangen. Ich sagte, dass ich mich nicht beklagen könne, dass ich viel zu tun hätte und mit Eveline und Johanna glücklich sei.
„Du bist Journalist geworden, genau wie du es dir damals gewünscht hast. Beneidenswert. Dein Traum ging in Erfüllung.“
„Na ja, zum Träumen bleibt immer noch genug Raum. Der Journalismus hat viel an Reiz verloren, ist längst kein Traumberuf mehr. Weißt du, welchen Witz man sich heute erzählt? ‚Ach, Sie sind Journalist? Schönes Hobby!‘ Da siehst du, wohin es damit gekommen ist. – Aber sag mal, du hast doch erzählt, du wärst verheiratet und hättest den Namen deiner Frau angenommen? Wo ist sie? Auch in Karlsruhe?“
„Nein“, sagte er abwinkend, „das ist auch schon wieder vorbei ... Nicki und ich haben uns scheiden lassen. Wir blieben nur ein knappes Jahr zusammen. Es hat nicht funktioniert.“
„Warum hast du dann ihren Namen behalten?“
„Ich wollte wohl, dass irgendetwas von ihr bleibt. Ich habe mir so gewünscht, noch mal von vorne anzufangen. Nicki war eine Chance. Ich redete mir ein, das Glück sei endlich zu mir gekommen und ich hätte die Frau meines Lebens gefunden.“
Als wir wenig später aufstanden, um zu gehen, legte er plötzlich beide Arme um meine Schultern und drückte mich fest an sich. Ich wusste nicht, was das bedeutete und wie ich reagieren sollte.
„Danke, Sascha“, hauchte er mir ins Ohr, „das war sehr wichtig.“
Er wirkte gerührt; ich sah, wie es in seinen Augen glänzte. Dann öffnete er mir die Tür.
„Bis bald“, hörte ich ihn hinter mir herrufen.