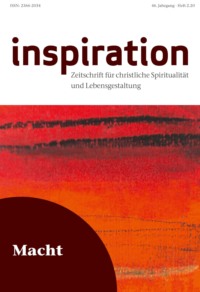Czytaj książkę: «inspiration 2/2020»

Abb. 1: Besuch des deutschen Bundespräsidenten 18.11.2006. © Bild: Stefano Spaziani

Abb. 2: https://www.nzz.ch/panorama/bild-strecke/die-kleider-des-papstes-1.18016235#lg=1&slide=4 © Bild: Keystone/AP
Inhalt
inspiration
Heft 2.20 · Macht
Editorial
Sr. M. Ancilla Röttger osc
Vertraut mit dem Fremden
Zuzanna Flisowska
Ermächtigung und Empowerment
Sr. Dr. Katharina Ganz OSF
Anders-Macht
Dr. Jennifer Wenner
Katharina von Siena – weibliche Zugänge zur Spiritualität in Zeiten der Krise
Ein Gespräch mit Marion Lammering
Seelsorge und Spiritualität in der spontanen Diaspora
Rudolf Hein
Ästhetik der Macht
Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Welt ist durcheinandergewürfelt worden, irgendwie befanden wir uns zu dem Zeitpunkt, als dieses Heft redigiert wurde, in einer Art Zwangspause vom Alltag. Und auch wieder nicht – denn das Leben muss ja irgendwie weitergehen. Und so sitze auch ich im Homeoffice und jongliere zwischen dem Beruf und dem neuen Alltag mit meinen Kindern, die von zu Hause aus Schule haben sollen.
Wie passend ist da das Thema dieses Heftes, das wir zugegebener Maßen schon letztes Jahr festgelegt hatten. Da sich aber Macht (wie auch Ohnmacht) in dieser Zeit nochmal ganz anders präsentiert, haben wir auch einen spontanen Zwischenruf eingefügt, der ein Schlaglicht auf die Spiritualität des Alltags in der Zeit der Coronapandemie wirft.
Die Autorinnen und Autoren dieser Ausgabe beziehen diese außergewöhnliche Zeit auf die ein oder andere Weise mit ein – das Fremde, dem wir momentan ausgesetzt sind, spielt ebenso eine Rolle in den Beiträgen dieses Heftes, wie auch die Möglichkeit zum Empowerment und Macht anders zu leben. Ein Blick in die Geschichte zeigt, wie Frauen als Nichtmächtige ihrer Zeit trotzdem öffentlichkeitswirksam Kirche und Leben gestaltet haben und ein kleiner Blick in die Gegenwart erlaubt die Faszination in der Krise zu finden.
Inspirierende Zeit mit dieser Ausgabe wünscht Ihnen,

Clarissa Vilain
Sr. M. Ancilla Röttger osc
Vertraut mit dem Fremden
Geistliche Begleitung
Fremdheit stürzt uns schnell in Ohnmacht, Vertrautheit gibt uns Macht über die Dinge. Die Coronapandemie, die in den Tagen der Entstehung dieses Hefts die Welt bzw. deren Alltag verändert, zeigt uns dies auf völlig neue Weise: Schwester Ancilla Röttger wirft deshalb einen Blick auf ein scheinbares Paradoxon des Christlichen, der Vertrautheit mit dem Fremden. Denn egal, ob wir fremd in einer Gegend oder mit einer Situation sind – wenn wir uns mit dem Fremden vertraut fühlen, erhalten wir Macht über das eigene Leben. Und dies ist die beste Voraussetzung, um den manchmal auftauchenden Widrigkeiten zu trotzen.
Vertraut mit dem Fremden – das könnte eine Charakterisierung des Christlichen sein. Die Osterevangelien erzählen in vielen Variationen, wie der Auferstandene in den Begegnungen mit seinen Jüngern für sie fremd und doch vertraut ist. Da ist zum Beispiel Maria von Magdala (Johannes 20,14–16), die Jesus sieht und denkt, es sei der Gärtner, bis er ihren Namen nennt – fremd, bis Jesus selbst die Fremde durchbricht durch das Vertrautsein im Namen. Oder am See von Tiberias (Johannes 21,4–12): Nachdem die Jünger die ganze Nacht erfolglos gefischt hatten, sahen sie Jesus am Ufer stehen, wussten aber nicht, dass es Jesus war. In dieser Begegnung greift Jesus zu den vertrauten Zeichen des reichen Fischfangs und des anschließenden gemeinsamen Essens, und der Text endet in der kryptischen Äußerung: »Keiner von den Jüngern wagte ihn zu befragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war«. Oder die Geschichte der Emmaus-Jünger (Lukas 24,13–32): Jesus geht mit ihnen und lässt sich in ihr Gespräch ein, »doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten.« Erst als er mit ihnen das Brot brach, gingen ihnen Augen und Herz auf. Und noch viele andere Szenen, die alle gemeinsam haben: Durch den Tod hindurchgegangen ist Jesus fremd geworden, bis er in der Kontinuität von Vertrautem sich erkennbar macht.
Rituale, die in sich die Kontinuität des Vertrauten festhalten, helfen, das Fremde anzuschauen und auszuhalten.
Und ist es nicht eine Aufgabe in der geistlichen Begleitung, Menschen zu helfen, mit diesem fremden Gott im Alltag des Glaubens vertraut zu werden und zugleich das allzu Vertraute immer wieder aufzubrechen ins Fremde hinein, damit dieser Gott nicht harmlos wird? Rituale, die in sich die Kontinuität des Vertrauten festhalten, helfen, das Fremde anzuschauen und auszuhalten.
Der ehemalige Internatsleiter von Schloss Salem Bernhard Bueb macht in seinem Buch »Lob der Disziplin« darauf aufmerksam, wie Rituale helfen können, den ersten Schritt auf das Fremde zu wagen. Indem Kinder früh lernen, Begrüßungsrituale wie selbstverständlich zu praktizieren, hilft es ihnen, mit diesem Vertrauten dem Fremden zunächst standzuhalten. Der zweite Schritt ist dann eine Herausforderung an die persönliche Reifung.
Der 2015 verstorbene Philosoph Odo Marquardt zeigte auf, dass im achtzehnten Jahrhundert gleichzeitig mit dem modernen Fortschritt die ersten Museen entstanden. Und – so sagt er nicht unironisch – wie ein Kind seinen Teddybären fest im Arm hält und überall mit hinnimmt, so schleppt der erwachsene Mensch seine eiserne Ration des Vertrauten mit sich. »Die Teddybären der Erwachsenen sind zum Beispiel auch ihre Klassiker, mit Goethe durchs Jahr, mit Habermas durchs Studium, mit Reich-Ranicki durch die Gegenwartsliteratur.«1 Es wird erst dann problematisch, wenn der Teddybär in meinem Arm mich daran hindert, die Gegenwart wahrzunehmen, weil sie vielleicht nicht ganz so »kuschelig« ist. Im Laufe einer Beziehungsgeschichte ändert sich vieles – in mir, im anderen, in meiner Gotteserfahrung. Veränderung bedeutet nicht, dass es nicht mehr den Dichtegrad des Anfangs gewinnt, sondern Nähe und Liebe auf einer anderen Ebene geschenkt und empfangen wird. Die schöne Erinnerung kann jedoch eine Fessel werden, die meine Erwartung an »damals« misst, und ich versäume dabei, mich der Dichte des gegenwärtigen Augenblicks zu stellen.
Wenn wir miteinander, wenn wir mit Gott auf einem Weg bleiben, sind wir nach ein paar Wegbiegungen, nach ein paar Steilabhängen und Gipfelpunkten, nach langen Trockenstrecken nicht mehr dieselben wie beim Losgehen. Mein Leben mit anderen, mein Beten muss sich danach ausrichten und sich immer wieder dem Fremden, der Veränderung öffnen.
Das Fremde macht uns Angst, weil wir es nicht verstehen; denn würden wir es verstehen, wäre es nicht mehr fremd. Und mir scheint, das eigentlich Fremde für uns ist der Tod, den wir, ohne ihn klar im Blick zu haben, im Fremden fürchten.
Das Fremde macht uns Angst, weil wir es nicht verstehen; denn würden wir es verstehen, wäre es nicht mehr fremd. Und mir scheint, das eigentlich Fremde für uns ist der Tod, den wir, ohne ihn klar im Blick zu haben, im Fremden fürchten.
Seit einiger Zeit geht ein Gedicht von Paul Celan mit mir: »Das Fremde«. Erich Fried2 hat eine Deutung gefunden, mit der ich mich zunächst etwas annähern konnte. Gleich zu Beginn macht er darauf aufmerksam, dass oft behauptet würde, Paul Celans Gedichte seien unverständlich und er würde lediglich mit Klang und Dunkelheit der Verse spielen. Doch nachdem ich tagelang immer wieder diese Zeilen von Paul Celan angeschaut hatte, wurden in mir viele Bilder wach, die ich hier als Leitfaden nehmen möchte, um unseren Umgang mit dem Fremden zu erlernen.
Paul Celan (1920–1970) schreibt – und dieses Gedicht stammt aus seinem Nachlassband Zeitgehöft –
DAS FREMDE
hat uns im Netz,
die Vergänglichkeit greift
ratlos durch uns hindurch,
zähl meinen Puls, auch ihn,
in dich hinein,
dann kommen wir auf,
gegen dich, gegen mich,
etwas kleidet uns ein,
in Taghaut, in Nachthaut,
fürs Spiel mit dem obersten, fallsüchtigen Ernst.
Das Fremde/hat uns im Netz – Da ist etwas, was wir nicht kennen und nicht aufschlüsseln können, das uns gefangen hält wie in einem Netz. Es wird zur Frage. Oft ist dieses Fragezeichen an das Fremde – egal ob aus Angst vor einer geheimen Bedrohung oder aus Lust, es zu verstehen – der Beginn einer geistlichen Begleitung. Da sucht jemand nach einem Menschen, der ihm hilft zu verstehen und dadurch das Netz des Gefangenseins aufzulösen. Und dann Gott in den Blick zu nehmen, von dem der Beter in Psalm 124 sagt: »Unsere Seele ist wie ein Vogel dem Netz […] entkommen; das Netz ist zerrissen und wir sind frei« (Psalm 124,7).
Es ist eine Grundbefindlichkeit, dass das Fremde uns im Netz hat, in dem wir uns einfach erstmal vorfinden. Jedes Lernen, jeder Schritt, den wir tun, konfrontiert uns mit Fremdem und indem wir das Fremde aufmerksam anschauen, zerreißt das Netz und wir sind frei.
die Vergänglichkeit greift/ratlos durch uns hindurch – wir wissen, dass wir vergänglich sind, dass es ein Ende unseres Lebens hier auf der Erde gibt. Und es gibt Situationen, in denen sich dieses Wissen der eigenen Vergänglichkeit unausweichlich aufdrängt. Doch wir neigen dazu, es anschließend wieder in den Hintergrund zu drängen und es versuchen zu vergessen. Wie ein Geist greift die Vergänglichkeit gespenstisch durch uns hindurch – ratlos, da wir sie nicht wirklich konkret werden lassen in unserem Bewusstsein. Geistliche Begleitung wird auch das immer wieder im Blick haben, dass die Konfrontation mit der eigenen Vergänglichkeit nicht gespenstisch und rein theoretisch geschieht, sondern in unserem Alltag konkrete Ansätze hat.
Es geht nicht darum, über Verletzungen einfach hinwegzugehen oder Negatives in rosa Licht zu tauchen oder einfach alles auf mich zu nehmen. Sondern es geht um die Entscheidung, in dem, was da wehtut, zu bleiben und damit zu arbeiten.
Wie auch immer man über die fünf Sterbephasen denkt, die Elisabeth Kübler-Ross für den Sterbeprozess formulierte, so sind sie mir doch mal in meinem Alltag sehr konkret geworden: das Nicht-wahrhaben-wollen, das Abstreiten. Dann Zorn und Ärger, worauf eine Phase des Verhandelns folgt. Dann eine depressive Phase und schließlich die Zustimmung. Und ich habe im Rückblick erfahren, dass das Einüben dieser Phasen nicht erst im Sterben beginnt, sondern im Lebensalltag. Jemandem vergeben, der mich verletzt hat, gleicht dem Sterbeprozess. Es geht nicht darum, über Verletzungen einfach hinwegzugehen oder Negatives in rosa Licht zu tauchen oder einfach alles auf mich zu nehmen. Sondern es geht um die Entscheidung, in dem, was da wehtut, zu bleiben und damit zu arbeiten.
Nach einer Auseinandersetzung, die in mir viele wunde Stellen zurückließ, nahm ich rückblickend zunächst in mir das Abstreiten wahr. Ich wollte nicht wahrhaben, dass die schwierige Situation wirklich mit mir zu tun hatte. Daraus kam der Ärger auf den anderen und ich richtete meine Aggression nach außen. Dann folgte die Phase des Verhandelns, in der ich zu Kompromissen bereit, aber innerlich noch nicht bei mir angekommen war. Schließlich kam ich nicht umhin, die Realität anzuerkennen und richtete meine Aggression gegen mich selbst, fiel in eine depressive Stimmung. Die ging dann über in die Zustimmung zur Wirklichkeit, wie sie sich mir in diesem ganzen Prozess erschlossen hatte. Ich konnte aufrichtig anschauen, was mein Anteil an dieser schwierigen Situation war, auch mir selbst verzeihen und war im Frieden mit mir und dem anderen. Ein neuer Anfang war möglich, der nicht darin bestand, einfach zu vergessen, was war, sondern der aus dem Frieden mit mir selbst erwuchs. Vielleicht könnte es dem Tod als dem Fremden schlechthin den Schrecken nehmen, wenn wir in kleinen Alltagsschritten unserem eigenen Sterben ein wenig nachspüren, damit die Vergänglichkeit und meine Endlichkeit die gespenstischen Konturen verliert.
zähl meinen Puls, auch ihn,/in dich hinein – Auch wenn es gefangen im Netz offensichtlich ein »uns« gibt, geht es doch immer wieder um jeden Einzelnen. Damit ich nicht im Netz der Fremdheit mit dem anderen hängen bleibe, braucht es gegenseitige Wahrnehmung. »Zähl meinen Puls, auch ihn, in dich hinein« weckt in mir das Bild von einer achtsamen Zuwendung zum anderen, der mir fremd ist. Seinen Puls in mich hineinzählen, könnte bedeuten, dass ich seinen Lebensrhythmus, seinen Herzschlag in mir zulasse und ihm in meinem Herzen einen Echoraum öffne. Wenn das Herz des anderen wie ein Echo in meinem Herzen schlägt, ist das Netz des Fremdseins zerrissen und wir sind frei miteinander und voreinander.
dann kommen wir auf,/gegen dich, gegen mich, – das klingt auf den ersten Blick etwas kriegerisch oder zumindest trennend. Aber so ist das tatsächlich oft: auch wenn wir einander so nah sind, dass wir den Herzschlag des anderen in uns zählen, bleibt ein Raum persönlicher Einsamkeit, der in großer menschlicher Nähe umso schmerzlicher ist. Manchmal gilt es, das eigene Fremdsein und das des anderen zu ertragen und damit auch die Einsamkeit auszuhalten, die das mit sich bringt. Einsamkeit, die durch eine schwere Krankheitsdiagnose hervorgerufen wird; oder durch den Tod eines geliebten Menschen; einsam ist derjenige, der seinen Partner in dessen Demenz annehmen muss und darin den verliert, der für ihn vielleicht ein halbes Leben lang Gesprächs- und Lebenspartner war. Der Schriftsteller und Psychologe Manès Sperper beschreibt die Einsamkeit als einen »Zustand, der dem Gesicht eines Fremden einen Ausdruck verleiht, der wie ein Hilferuf aus einem Kerker ohne Mauern dringt, in dem gefangen sitzt, wer fortwährend allein ist.«3 Es geht um eine Einsamkeit, die das ganze Leben durcheinanderbringt und in seinen Grundfesten erschüttert, wenn ich mir selbst fremd geworden bin. Was trägt noch?
etwas kleidet uns ein,/in Taghaut, in Nachthaut,
fürs Spiel mit dem obersten, fall-/süchtigen Ernst.
Da steigt in mir Psalm 22 auf, das Gebet eines einsamen Menschen:
2Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, * bleibst fern meiner Rettung, den Worten meines Schreiens?
3Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort; * und bei Nacht, doch ich finde keine Ruhe.
Tag und Nacht rufe ich zu Ihm, der doch mein Gott war, und bekomme keine Antwort, finde keine Ruhe in meinem Suchen nach Ihm. Dunkel, verlassen, wortlos. Es geht da nicht weiter, wo es bisher immer weiter ging. Ist da schon Stillstand? Ende? Habe ich mich vertan, als ich Ihm vertraute? Stimmt das alles gar nicht, was ich mein Leben lang geglaubt habe?
Eingekleidet in Taghaut, in Nachthaut – die Haut ist der Schutzmantel unseres Körpers und zugleich die Berührungsstelle im Kontakt mit anderen. Die Taghaut ist anders als die Nachthaut: tagsüber bin ich wach, achte auf das, was mich umgibt, was mich berührt; nachts habe ich darüber keine Kontrolle, wenn die Träume unter die Haut gehen und die Dunkelheit die Nachthaut dünn schleift.
Der Psalmist betet weiter:
7Ich … bin ein Wurm und kein Mensch, * der Leute Spott, vom Volk verachtet.
8Alle, die mich sehen, verlachen mich, * verziehen die Lippen, schütteln den Kopf:
9Wälze die Last auf den HERRN! Er soll ihn befreien, * er reiße ihn heraus, wenn er an ihm Gefallen hat!
Ja, manchmal ist das so: da bin ich eingekleidet für das Spiel mit dem obersten Ernst, der immer zum Fall drängt, während das Spiel in einer Leichtigkeit nach oben strebt. Und es passiert, dass ich Lächerlichkeit erfahre. Das macht einsam. Dorothee Sölle erzählt, wie sie in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg die Wiederbewaffnung Deutschlands erlebt und sehr empört darauf reagiert. Doch mit ihrer Wut und ihrer Empörung gegen diese Politik war sie plötzlich sehr allein. Nur kleine Gruppen fanden sich zu diesen Demonstrationen ein, die wenig bis nichts bewirken konnten, da sie auch noch lächerlich gemacht wurden. Sie sagt über diese Zeit: »Einsamkeit ist seither für mich verbunden mit einem Merkmal, das ich am schwersten ertrage: Sie ist lächerlich. Sie macht lächerlich. […] Vereinsamung isoliert uns von anderen, sie schwächt uns, sie zerstört unsere Möglichkeit des Selbstausdrucks, das Alleinsein nimmt Mut und Kraft weg; aber der Bodensatz von allem ist die Lächerlichkeit, der man sich unweigerlich aussetzt.«4 Das ist eine Form der Einsamkeit, die auch viele von uns kennen: wenn die, mit denen ich lebe, mich nicht mehr verstehen, sondern über meine Einstellung lachen. Das sagt auch der Psalm, dass der Alleingelassene im Unglück zum Gespött der anderen wird. Aber Dorothee Sölle spricht auch von der anderen Einsamkeit und sie schreibt: »So habe ich zweierlei Arten von Einsamkeit kennengelernt: die schlimme, in der man lächerlich wird, und die gute, in der man leicht wird. Lächerlich, isoliert, beschädigt, links liegen gelassen, unverständlich, spinnig – das ist eine Art Einsamkeit; abgelöst, locker, ungezwungen, in einem neuen Kontakt zur Natur – das ist die andere.«5
Darmowy fragment się skończył.