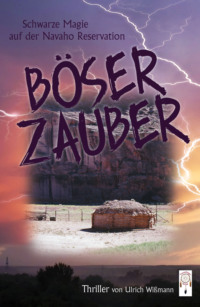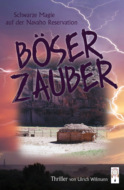Czytaj książkę: «Böser Zauber»
Ulrich Wißmann
Böser Zauber
Schwarze Magie auf der Navaho Reservation
nach einer Idee meines Sohnes Merlin
Böser Zauber
Schwarze Magie auf der Navaho Reservation
Ethno-Thriller
von
Ulrich Wißmann

Impressum
Böser Zauber, Ulrich Wißmann
TraumFänger Verlag Hohenthann, 2015
eBook ISBN 978-3-941485-38-9
Lektorat: Ilona Rehfeldt
Satz und Layout: Janis Sonnberger, merkMal Verlag
Datenkonvertierung: readbox, Dortmund
Titelbild: Astrid Gavini
Copyright by TraumFänger Verlag GmbH & Co. Buchhandels KG,
Hohenthann
Produced in Germany
INHALT
OSTEN/WEISS
Frühling/Morgenröte/Kindheit
SÜDEN/BLAU
Sommer/Tag/Jugend
WESTEN/GELB
Herbst/Sonnenuntergang/Erwachsensein
NORDEN/SCHWARZ
Winter/Nacht/Alter
In Schönheit wandele ich
Mit Schönheit vor mir wandele ich
Mit Schönheit hinter mir wandele ich
Mit Schönheit unter mir wandele ich
Mit Schönheit über mir wandele ich
Mit Schönheit um mich herum wandele ich
In Schönheit ist es vollendet
Navaho-Gesang

Die Handlung ist frei erfunden und jegliche Ähnlichkeit mit tatsächlichen Ereignissen und Personen wäre rein zufällig.
Vorwort
Wie auch in meinen vorangegangenen Romanen um den Navaho-Polizisten Frank Begay ist die Geschichte dieses Buches frei erfunden.
Die beschriebenen historischen, politischen und ethnologischen Fakten aber entsprechen der Wahrheit. Die Aufteilung des Big Mountain-Gebietes, die Zwangsumsiedlung der dort lebenden Bevölkerung und ihr Widerstand dagegen entspricht den Tatsachen. Bis heute haben sich einige wenige Navaho-Familien der Umsiedlung entziehen können.
OSTEN/WEISS
Frühling/Morgenröte/Kindheit
I
Die Sonne stand hoch am Himmel über einer weiten, sandigen Hügellandschaft, die von einzelnen bizarren Felsformationen unterbrochen wurde. Wenige braune Büsche und Sträucher und Büschel trockenen Grases klammerten sich an den kargen Grund. Die Luft über der Halbwüste flimmerte und doch war schon eine Ahnung von Herbst im tiefen Blau des Himmels, in den Wolken und im Geruch des Windes zu erkennen.
Ein Rotschwanzbussard ließ sich von dem lauen, von Südwest kommenden Wind fast ohne eine Bewegung über die Landschaft tragen und beobachtete mit seinen scharfen Augen das Netz aus Urinspuren, das Kängururatten, Mäuse und andere kleine Nager hinterlassen hatten.
Zwei Navaho-Hirten, die auf erhöhtem Posten auf einem Felsvorsprung auf ihren scheckigen Ponys saßen, von wo aus sie ihre Schafe und Ziegen beobachteten, veranlassten den Greifvogel, etwas höher zu steigen. Gleich darauf, als er über die Kante gesegelt war, auf der die Menschen standen, legte er seine Flügel etwas näher an den Körper an und verlor sofort wieder an Höhe. Er beobachtete eine Klapperschlange, die sich, aufgeschreckt von einem grasenden Schaf, mit erhobenem Schwanz und laut rasselnder Klapper zusammenrollte und dabei aufmerksam den züngelnden Kopf über ihren Körper hob.
Das Schaf, das auf diese Warnung hin seinen Weg änderte, erschreckte eine bunt schillernde Eidechse, die sich auf einem Felsen sonnte. Das Reptil legte den Kopf schief und beobachtete das viel größere Tier aus starren Augen, bevor es davonhuschte und sich in einer Felsspalte in Sicherheit brachte. Als die potentielle Beute verschwunden war, legte der Bussard sich in den Wind und stieg wieder höher. Im Norden, über den endlosen steinernen Wüsten am Glen Canyon, schossen riesige Berge von Cummulus-wolken in die Höhe. Im Westen, in Richtung des Grand Canyon, und auch im Süden war das Firmament wolkenlos, während sich im Osten, über der gezackten Linie der Chuska Mountains, ebenfalls ungeheure Wolkengebirge auftürmten, deren tief dunkle Unterseite ein Versprechen auf Regen zu geben schien, das sich dann aber meist in dieser Jahreszeit noch vor dem Erdboden in Luft auflöste.
Der schwarze Cadillac suchte sich stockend seinen Weg durch ein ausgetrocknetes Bachbett. Der Fahrer lenkte den Wagen von einer Seite zur anderen, bei dem Versuch, Felsbrocken, großen Steinen oder Löchern in dem „Wash“ auszuweichen. Auch sandige Stellen versuchte er zu meiden, da er befürchtete, das Auto sonst festzufahren.
Die beiden Navaho-Hirten blickten sich verwundert an. Wenn man in dieser entlegenen Gegend des Navaho-Hopi-Reservates überhaupt einmal ein Auto sah, dann höchstens einen Pickup-Truck oder ein rostiges altes „Indian Car“. Dieser Wagen hatte hier definitiv nichts zu suchen. Wahrscheinlich würde er diese Fahrt auch nicht überstehen. Die Bewohner dieses Gebietes fuhren nicht solche Autos und Touristen wagten sich normalerweise nicht so weit von den befestigten Straßen fort. Die beiden Hirten sahen dem Wagen zu, wie er langsam in einer Staubwolke am Horizont verschwand. Sie sahen sich noch einmal verwundert an, lachten und wandten ihre Aufmerksamkeit dann wieder den Tieren zu, die unter ihnen im Tal die vereinzelten Grasbüschel und Sträucher abweideten.
II
Officer Frank Begay hatte das Wochenende frei. Es war samstagmorgens, er hatte gefrühstückt und wollte sich gerade mit einer Tasse Kaffee und der gestrigen Ausgabe der „Navaho Times“ in den Schatten vor dem Haus setzen.
Seine Frau Kathy und sein Sohn Daniel schliefen noch. Kathy arbeitete in der Außenstelle des Medical Care in Chinle und kam oft erst spätabends nach Hause. So genoss sie es, am Wochenende einmal richtig ausschlafen zu können. Daniel ging in die Abschlussklasse der Chinle High School und war auch meist erst spät zu Hause. Ob das dem umfangreichen Schulprogramm oder anderen Aktivitäten geschuldet war, war für Begay nicht unbedingt ersichtlich. Auch Daniel nutzte das Wochenende gern, um Schlaf nachzuholen.
Begay war aber nicht unglücklich, Zeit für sich zu haben. Er und sein Frau sahen sich oft tagelang kaum oder gar nicht. Sie hatten sich in den vergangenen Jahren auseinandergelebt. Jeder ging seiner Wege. Aber sie waren traditionsverbundene Dineh. Bei dem Volk ging die Familie über alles. Man trennte sich nicht so leichtfertig wie bei den Weißen. Auch wenn Begay immer mal wieder darüber nachdachte, eine Trennung zu vollziehen, erhielten sie ihre Familie doch über die Jahre. Hier schien es in ihrer langjährigen Vertrautheit eine Art stillschweigendes Abkommen zu geben. Begay hoffte, dass es zumindest für Daniel und für die sie umgebende Familie so das Beste war.
Das Telefon läutete.
„Hallo Frank, hier Blackhat“, hörte er vom anderen Ende der Leitung.
Begay hatte sofort ein ungutes Gefühl. Wenn Captain Blackhat, sein Vorgesetzter bei der Navaho Nation Tribal Police ihn am Samstag zu Hause anrief, bedeutete das nichts Gutes für sein freies Wochenende.
„Es tut mir leid, dass ich Sie heute stören muss“, sagte Blackhat dann auch, „ aber wir haben einen mehrfachen Mord.“
Begay erschrak. „Was, hier auf der Reservation?“, fragte er.
„Ja, in der Gegend am Big Mountain“, antwortete Blackhat.
„Dann ist das doch im Hopi-Gebiet, oder?“
„Ja, aber es handelt sich um eine Navaho-Familie. Die Hopi-Polizei will nichts damit zu tun haben!“
„Und es sind mehrere Tote?“
„Ja, offenbar die gesamte Familie“, meinte Blackhat. „Ein Hirte hat sie entdeckt, als er seine Schafe dort vorbeitrieb und der Familie einen Besuch abstatten wollte.“
Begay verschlug es für kurze Zeit die Sprache. So etwas hatte er auf der Big Res noch nie erlebt.
„Deshalb brauche ich Sie sofort, Frank! Ist das möglich?“
„Natürlich“, antwortete Begay.
„Sie wissen ja“, fuhr Blackhat fort, „dass ich das FBI informieren muss.“
Begay wusste das. Die Indianerreservationen hatten zwar den Status von halbautonomen Gebieten mit eigener Rechtsprechung und Polizei, aber bei Kapitalverbrechen schalteten sich automatisch die Bundesbehörden ein.
„Und wenn erstmal ein Tross FBI-Beamter und die sogenannte Spurensuche am Tatort war, gibt es dort nicht mehr viele Spuren zu entdecken“, führte Blackhat weiter aus. Begay verstand das Problem. Der Captain wollte von ihm, dass er vor dem FBI am Ort des Verbrechens war.
„Können Sie die Nachricht noch zurückhalten?“, fragte Begay.
„Wenn das FBI aus Flagstaff kommt, sind sie wahrscheinlich noch vor mir am Tatort!“
„Ich habe schon mit Agent Caldwalder aus Flagstaff gesprochen“, antwortete Blackhat. „Er kommt mit Ihnen allein zum Tatort und bestellt den FBI-Trupp erst von unterwegs, so dass Sie zumindest eine Stunde vorher da sind und sich umsehen können, okay?“
„Das müsste reichen“, meinte Begay.
Blackhat gab ihm eine genaue Wegbeschreibung durch, wie er zum Ort des Mordes kommen konnte und sie verabschiedeten sich.
Begay schrieb einen Zettel für seine Frau und seinen Sohn, dass er unvorhergesehen zum Dienst gerufen worden war und machte sich auf den Weg zum Gebiet am Big Mountain.
III
Als Begay am Tatort eintraf, war der Agent schon da. Caldwalder hatte aus Flagstaff einen weiteren Weg gehabt als Begay von seinem Haus bei Chinle, wenn er auch von dort aus die bessere Straßenanbindung gehabt hatte. Aber der Weg hierher war für einen Ortsunkundigen nicht leicht zu finden. Die einzige Möglichkeit, hierher zu kommen, bestand darin, circa vierzig Meilen weit die Bundesstraße 160 in Richtung Kayenta zu fahren, dann auf eine „Gravel Road“ abzubiegen und schließlich eine Staubpiste zu nehmen, die oft kaum auszumachen war oder durch „Arroyos“ oder „Dry Washs“, also ausgetrocknete Bachbetten führte, die man schwer und nur zu bestimmten Jahreszeiten befahren konnte. Zum Glück lagen sie jetzt im Spätsommer tatsächlich trocken, sonst hätte man die letzten zehn Meilen zu Fuß zurücklegen müssen, wenn man für den Rest der Strecke kein Reittier mitführte. Agent Caldwalder fuhr einen Geländewagen und hatte offensichtlich auch keine Probleme bei der Orientierung gehabt. Er stand neben seinem Auto und wartete offenbar schon auf Begay. Caldwalder war mittelgroß und wirkte relativ durchtrainiert, obwohl er auch nicht mehr der Jüngste war. Begay schätzte ihn auf fünfzig, also wären sie etwa gleich alt. Er hatte dunkelblondes, an manchen Stellen ergrautes und nicht mehr ganz dichtes Haar und machte mit seinem einnehmenden Lächeln einen sympathischen Eindruck auf Begay.
Offenbar machte der Navaho, der Caldwalder entgegentrat und ungefähr gleich groß war wie der Agent, mit seinem halblangen Haar, dem indianischen Gesichtsschnitt und dem etwas untersetzten, kräftigen Körperbau ebenfalls einen positiven Eindruck auf ihn.
Er streckte ihm die Hand hin. „Hallo! Ich bin Agent Jackson Caldwalder vom FBI. Meine Freunde nennen mich Jack!“, sagte er verbindlich.
„Frank Begay, Navaho Nation Tribal Police.“ Unter Indianern hätte er sich an dieser Stelle mit der Nennung seiner Eltern und seiner Clanzugehörigkeit vorgestellt, aber er wusste, dass unter Weißen etwas anderes Vorrang hatte. Er gab dem Agent die Hand.
„Darf ich Sie Frank nennen, oder muss es ‚Häuptling‘ sein?“, fragte Caldwalder in Anspielung auf die Unsitte vieler Anglo-Amerikaner, die Ureinwohner anzusprechen und lachte.
„Frank wäre mir lieber. Wir Navaho haben überhaupt keine Häuptlinge“, antwortete Begay.
„Ach so“, meinte Caldwalder und klopfte Begay auf die Schulter. Nachdem sie sich vorgestellt hatten, gingen sie zusammen zum Haus der Ermordeten.
Margret und Bernhard Tsosie und ihre Kinder hatten, wie auch immer, ein Mobil Home als Behausung hierher transportiert. In circa zwanzig Metern Abstand davon stand aber auch der traditionelle Hogan der Dineh, eine Erdhütte, die, auf einem achteckigen Gerüst aus Kiefernstämmen aufbauend und mit Lehm bedeckt, eine kuppelförmige Wohnung ergab.
Die Tür des Mobil Homes war offensichtlich aufgebrochen worden und klappte im lauen Wind gespenstisch auf und zu. Caldwalder und Begay zogen ihre Waffen und während Caldwalder sicherte, trat Begay schnell ins Innere des Hauses. Ihm gefror das Blut in den Adern. Vor ihm, in der Tür, die vom Eingangsbereich in das nächste Zimmer führte, sah er das Bein eines Toten, wahrscheinlich eines Jugendlichen, in Jeans und Turnschuhen. Er stieß die Tür zu dem Raum auf und sah auf die blutüberströmte Leiche eines vielleicht zwölfjährigen Jungen herab. Caldwalder war ihm gefolgt und zusammen betraten sie den nächsten Raum. Auch hier lag, in einer großen Lache getrockneten Blutes, ein Jugendlicher, vielleicht ein oder zwei Jahre älter als der andere Tote. Wie dieser war er offensichtlich von mehreren Geschossen getroffen worden. Er hatte noch versucht, wegzukriechen, da eine braunrote Spur quer durch das Zimmer bis zu dem Platz führte, wo er gestorben war. Begay würgte und hielt sich die Hand vor den Mund, worauf Caldwalder, der vielleicht wusste, was der Kontakt mit Toten für einen Navaho bedeutete, ihm eine Hand auf die Schulter legte. Sie steckten ihre Waffen weg und sahen sich im Haus um. Auch in der Küche war überall Blut. Wahrscheinlich hatte der jüngere der beiden Brüder, nachdem er angeschossen worden war, noch durch den Eingangsbereich bis zum Zimmer seines Bruders kommen können, um ihn zu warnen. Nachdem sie alles gesehen hatten, gingen Caldwalder und Begay vom Mobil Home zum Hogan der Familie, jetzt wieder mit erhobenen Waffen, und traten durch die offenstehende Brettertür in den tief liegenden Eingang der Hütte. Ein Bild des Grauens erwartete sie auch hier. Margret Tsosie lag an der Rückwand des Hogans mit einem großen, roten Loch an der Stelle, wo einmal ihr linkes Auge gewesen war. Von der Wunde ausgehend war ihr ein Schwall Blut über Gesicht und Oberkörper gelaufen.
Ihr Mann lag in seinem Blut in der Mitte des Raumes. In der Hand hielt er noch ein altes Jagdgewehr. Er hatte offensichtlich versucht, seine Familie zu beschützen, hatte aber wohl keine Chance gegen die Angreifer gehabt. Begay und Caldwalder ließen abermals ihre Waffen sinken und warfen sich einen vielsagenden Blick zu. Nachdem sie sich eine Weile im Hogan umgesehen hatten, ging Begay mit gesenktem Kopf wieder hinaus und begann, die Umgebung zu untersuchen.
Die Pferde der Tsosies standen in einer Koppel. Begay überprüfte, ob sie genügend zu fressen und Wasser hatten, und sah sich, nachdem er beides bestätigt gefunden hatte, weiter um. Die Schafe und Ziegen der Familie, von denen er Spuren gefunden hatte, liefen offenbar frei herum, so dass man sich um sie auch keine Sorgen machen musste. Begay entdeckte einen Hund, der auch erschossen worden war und zusammengekrümmt neben dem Hogan lag. Überall waren Spuren von Menschen zu sehen, Spuren von weichen Mokassins, die kein Profil aufwiesen, Straßenschuhen, Cowboystiefeln und Boots. Begay bat Caldwalder, am Hogan zu bleiben, um nicht noch mehr Fußspuren zu verursachen und ging noch einmal zu dem Mobil Home. Die alten Tsosies hatten beide Mokassins getragen, der jüngere der Brüder Turnschuhe. Begay sah nach den Schuhen des älteren Bruders, der Boots getragen hatte, und ging dann wieder aus dem Haus, um sich den Boden in der Umgebung genauer anzusehen.
Außer den Spuren von Caldwalder und ihm konnte er die Fußabdrücke der Tsosies und ihrer Söhne ausmachen. Nach einiger Zeit hatte er darüber hinaus die Abdrücke von sechs verschiedenen Schuhpaaren entdecken können. Es gab noch zwei Paare Boots, die sich durch Größe und Profil von denen des Tsosie-Jungen unterschieden, die Cowboystiefel und drei Paar Straßenschuhe. Es war gut, dass das FBI noch nicht eingetroffen war, so dass man all das noch klar erkennen konnte.
Begay ging davon aus, dass es sechs Männer gewesen waren, die sich aufgeteilt hatten, um die Tsosies im Mobil Home und im Hogan gleichzeitig zu überfallen, damit niemand die Möglichkeit zur Flucht hatte. Da sich an den Gebäuden die Spuren vieler Menschen überlagerten, ging er jetzt im weiteren Umkreis auf die Suche, interessiert beobachtet von Caldwalder. Von Zeit zu Zeit ging er in die Hocke, um sich einen Abdruck genauer anzusehen oder fühlte mit der Hand das Profil. Erstaunlich war, dass zwei der Spuren offenbar schon einen Tag älter als die anderen waren. Gegen Morgen schlug sich Tau ab und wenn die Wärme des Tages die Feuchtigkeit trocknete, veränderte der Sand seine Struktur, es entstanden Brüche im Profil der Abdrücke und kleine Teile des Sandes, aus dem sie geformt waren, rutschten ab. Daran konnte Begay sehen, dass die Spuren der Straßenschuhe und eines Boots-Paares vom gestrigen Tag waren, die des anderen Boots-Trägers und des Mannes mit den Cowboystiefeln aber teilweise schon vom Tag davor.
Hatten diese beiden am Tag vor dem Mord schon einmal die Lage sondiert? Außerdem fand Begay auch einige Abdrücke, die darauf schließen ließen, dass diese beiden auch heute, am Tag nach der Tat, noch einmal hier gewesen waren. Er konnte sich darauf keinen Reim machen. Er ging zu Caldwalder, um sein Wissen mit ihm zu teilen, der aber mit dieser Information auch nichts anzufangen wusste.
„Das Auto der Täter ist ein größerer, amerikanischer Wagen“, erklärte Begay, „Ford, Cadillac, Chevy, so was in der Art. Nicht sehr geländetauglich. Ist ein Wunder, dass die damit überhaupt hierher und wieder weg gekommen sind!“
„Das lässt darauf schließen, dass sie sich hier nicht besonders auskannten. Kommen sicher eher aus der Stadt. Dafür spricht ja auch die Art ihres Schuhwerks. Also keine Leute von hier“, meinte Caldwalder.
„Nein“, antwortete Begay, „das hätte ich Ihnen gleich sagen können. Navahos töten nicht. Nur im Affekt, in Notwehr oder unter Alkoholeinfluss. So eine kaltblütig geplante Aktion ist da ziemlich ausgeschlossen.“
„Ach, keine blutrünstigen Wilden wie im Fernsehen, was?“, fragte Caldwalder.
„Sie gucken wohl immer noch die John-Ford-Filme?“, stichelte Begay. „Wir Navaho haben traditionell Angst vor Toten und dem Umgang mit ihnen“, erläuterte er. „Da ist so ein Verbrechen äußerst unwahrscheinlich! Sieht ja auch aus wie das Werk von Profis.“
Caldwalder nickte: „Ja, Killer, oder Leute, die so was schon mal gemacht haben. Wir werden Abdrücke aller Fußabdrücke nehmen und natürlich von den Wagenspuren. Vielleicht kriegen wir das genaue Model raus. Wenn Sie hier fertig sind, sehe ich mich noch mal in den Gebäuden um, okay?“
„Ja, ich bin hier fertig! Ich sehe mich dann mal in der weiteren Umgebung nach Spuren um.“
Begay lief kreisförmig von dem Wohnbereich der Tsosies ausgehend ins umliegende Gelände. Er fand überall die Spuren der Familie, aber auch die der anderen sechs Personen, die offenbar auch die weitere Umgebung abgesucht hatten. Etwas weiter entfernt fand er außer Spuren der Tsosies nur noch die des Cowboystiefelträgers und auch wieder die Bootsspur, also die Spuren der beiden Männer, die offenbar vor und nach den anderen Tätern hier gewesen waren. Sie zogen sich weit vom Anwesen fort direkt auf den Rand eines Canyons zu. Begay stutzte, ging immer wieder in die Knie, fühlte den Boden mit den Fingern und folgte der Spur bis zur Abbruchkante der Schlucht, in der die Spuren sich verloren. Dann ging er zurück. Am Horizont war jetzt eine Staubwolke zu sehen. Aber Blackhats Plan war aufgegangen, er hatte in Ruhe alles untersuchen können, bevor die FBI-Mannschaft eintraf.
Er traf Caldwalder am Hogan.
„Noch was rausgefunden?“, fragte Begay.
„Eigentlich nicht“, gab Caldwalder zu. „Bin ja kein Indianer! Und Sie?“
„Ja, ich habe noch mehr Spuren der beiden, die am Tag vor dem Verbrechen und heute hier gewesen sind, gefunden. Da ist mir einiges Interessantes aufgefallen! Die beiden sind noch ziemlich jung, so um die zwanzig, während die anderen Männer alle älter sind.“
Inzwischen war der Tross von Staatsfahrzeugen angekommen. Caldwalder hatte den Männern kurz zugewinkt, die jetzt in alle Richtungen ausschwärmten, um Spuren sicherzustellen, oder, wie Begay bei sich dachte, zu verwischen.
Caldwalder sah Begay fragend an.
„Kann man an der Art, wie sie laufen, sehen“, erläuterte der. „Der Mann mit den Boots ist groß und schlank. Der eine mit den Straßenschuhen ist untersetzt, vielleicht sogar etwas dick und einer hinkt ein bisschen. Und die sind alle so dreißig bis vierzig Jahre alt.“
Caldwalder stand der Mund offen. „Jetzt sagen Sie mir nur noch, wie viel Bargeld sie alle in der Tasche hatten!“
„Der Untersetzte hatte nur ‘ne Kreditkarte dabei, der Große hatte …“
„Ja, ja, den Film hab‘ ich auch gesehen“, grinste Caldwalder,
„Halbblut, mit Val Kilmer und Graham Greene.“
„Mist“, meinte Begay, „das wollte ich immer schon mal machen!“
„Ist auch zu schön, wie Graham Greene dem weißen Bullen an Hand der Fußspuren auftischt, der Mörder hätte einen Dollar fünfundsechzig oder so in der Tasche gehabt“, lachte Caldwalder.
„Aber was ich noch sehen konnte, ist, dass die beiden jungen
Männer in Richtung des Canyons da hinten“, er zeigte in die Richtung, in der er die Spuren gefunden hatte, „gelaufen sind.
Also wirklich gerannt, hatten es sehr eilig!“
„Vielleicht sind sie vor den anderen geflohen“, dachte Caldwalder laut nach.
„Kann sein. Möglicherweise war der Mord gar nicht geplant oder sie wussten nichts davon und haben kalte Füße gekriegt“, mutmaßte Begay.
„Tja, oder sie gehörten gar nicht zu der Bande. Kann es sein, dass die Tsosies noch zwei erwachsene Söhne hatten?“, fragte der Agent.
„Keine Ahnung. Oder Bekannte, die zu Besuch waren“, ergänzte Begay. „Das werden wir herausbekommen. Jedenfalls würde das erklären, warum diese beiden schon vorher und hinterher hier waren. Dann hätten wir zwei Augenzeugen für die Tat!“
„Die wir nur noch finden müssen! Und die jetzt auf der Flucht sind“, meinte Caldwalder nachdenklich.
IV
Von unterwegs hatte Begay Blackhat angerufen, ihm Bericht erstattet und ihn gebeten, herauszufinden, wie viele Personen zur Familie Tsosie gehört hatten.
„Das wird nicht einfach“, hatte Blackhat geantwortet, „sie haben ja offiziell im Hopi-Gebiet gelebt und illegal dort gesiedelt. Insofern ist kein Bezirk für sie zuständig! Aber ich werde sehen, was sich machen lässt.“
Die Navaho-Reservation war in Bezirke aufgeteilt, von denen Repräsentanten in den Stammesrat entsandt wurden, und die Einwohnerdaten verwalteten diese einzelnen Bezirke. Die Tsosies fielen aus diesem Muster heraus, da sie auf Land gelebt hatten, dass offiziell nicht zur Navaho-Reservation und seinen Bezirken gehörte.
Als Begay zu Hause ankam, lag schon eine Nachricht von Blackhat für ihn vor. Da er den ganzen Tag nichts gegessen hatte, machte er sich schnell einen „Indian Taco“ mit Hammelfleisch und Bohnen und rief ihn zurück. „Also, Frank, Sie hatten recht“, hörte er Blackhat sagen, während er das Mikrofon seines Hörers weit weg von seinem Mund hielt und versuchte, möglichst lautlos sein Taco zu essen, „die Tsosies hatten drei Söhne, James, William und Edward. James und William waren dreizehn und vierzehn und lebten noch bei den Eltern. Edward ist sechzehn und geht auf ein Internat bei Flagstaff. Jenny Mead vom Bezirk Kayenta wusste das. Die haben früher das Big Mountain-Gebiet mitverwaltet.“ „Aha“, machte Begay und versuchte, schnell hinunterzuschlucken, „dann war Edward wohl gerade zu Besuch. Irgendeine Ahnung, wer der andere junge Mann sein könnte?“
„Nein, überhaupt nicht“, antwortete Blackhat.
Sie beendeten das Telefongespräch und Begay blieb nachdenklich am Küchentisch sitzen. Einer der beiden Jungen war also ein Sohn der Tsosies, der gerade zu Besuch gewesen war. Das erklärte einiges. Die beiden hatten offensichtlich den Mord mitangesehen und waren deshalb in den Canyon geflüchtet. Warum hatten sie nicht versucht, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen, sondern waren in die Wildnis geflohen? Offensichtlich hatten sie Grund zu der Annahme, dass die Mörder auf sie warten würden, wenn sie das Heim der Tsosies auf dem normalen Wege verlassen würden. Die Männer mussten sie aus dem Weg schaffen und so sahen sie ihre einzige Chance darin, in das unwegsame Canyonland zu fliehen. Nachdem Begay aufgegessen hatte, setzte er sich mit Caldwalder in Verbindung. Sie verabredeten, am nächsten Tag gemeinsam das Internat aufzusuchen, um dort vielleicht mehr herauszufinden.
V
Caldwalder und Begay trafen sich am Internat. Mrs. Waldon, die Klassenlehrerin von Edward Tsosie, war bereit gewesen, sie dort auch am Sonntag zu treffen. Da die beiden jüngeren Männer offensichtlich auf der Flucht waren und als Augenzeugen der Tat womöglich verfolgt wurden, duldete die Angelegenheit keinen Aufschub. Die Lehrerin, eine attraktive Mittvierzigerin, hatte die Polizisten in ihren Raum geführt.
„Mrs. Waldon, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben“, eröffnete Caldwalder das Gespräch. „Edward Tsosie ist ihr Schüler?“
„Ja“, antwortete Waldon, „und ein sehr guter Schüler, wie ich anmerken möchte.“ Sie lächelte dabei Begay an, der annahm, dass sie ihm wohl zeigen wollte, dass sie keine Ressentiments gegen Ureinwohner hatte.
„War Edward dieses Wochenende denn zu Besuch bei seiner Familie?“, fragte Begay.
„Ja, das hatte er vor“, antwortete Waldon. „Er ist schon am Donnerstag nach dem Unterricht losgefahren. Wir hatten ja ein verlängertes Wochenende. Darf ich fragen, was überhaupt passiert ist?“
Begay und Caldwalder wechselten einen Blick.
„Mrs. Waldon, die gesamte Familie von Edward Tsosie wurde ermordet. Wir haben Grund zu der Annahme, dass Edward die Tat womöglich beobachtet hat und jetzt in größter Gefahr ist“, führte Caldwalder aus.
„Oh, Gott“, entfuhr es Waldon und sie hielt sich schnell eine Hand vor den Mund.
„Es waren aber offensichtlich zwei junge Männer dort. Haben Sie irgendeine Ahnung, wer der zweite gewesen sein könnte? Ein Bekannter von Edward vielleicht?“
„Ja, natürlich“, meinte Waldon, „Edward ist mit seinem Freund Adam Nicks nach Hause gefahren. Die beiden sind die besten Freunde. Edward hat Adam öfter mitgenommen. Er hat niemanden, wo er hinkann“, fügte sie erläuternd hinzu.
„Haben Sie vielleicht Fotos von den beiden?“, fragte Caldwalder.
„Ja, sicher“, antwortete Waldon und ging zu einem Schrank, aus dem sie ein Buch hervorholte.
„Hier, das ist Edward!“ Sie deutete auf einen etwas verlegen in die Kamera schauenden jungen Mann mit indianischen Zügen auf einem Klassenfoto. „Und gleich daneben, das ist Adam.“ Der Junge, auf den sie zeigte, hatte dunkle Haare, eine schmale Statur und einen südeuropäisch wirkenden Gesichtsschnitt.
„Sehen Sie mal“, sagte Begay zu Caldwalder, „Tsosie trägt Cowboystiefel!“
„Oh, ja“, warf Waldon ein, „er hat ein Faible für Cowboy-Boots! Er ist ja sehr stolz auf seine Herkunft und betont immer seine Navaho-Tradition, aber seine Cowboystiefel müssen sein!“ Sie lachte und schüttelte gleich darauf mit trauriger Miene den Kopf.
„Dann wissen wir ja, welche Spur zu wem gehört“, sagte Begay.
„Das könnte uns helfen.“
„Sind denn die beiden jetzt auf der Flucht?“, fragte Waldon sichtlich betroffen.
„Ja, das müssen wir annehmen“, antwortete Caldwalder.
„Ob Adam das durchhält?“, fragte Waldon besorgt. „Er war immer sehr kränklich, müssen Sie wissen.“
„Wieso?“, fragte Caldwalder. „Was hatte er denn?“
„Ach, allgemein war er nicht so leistungsfähig und oft krank.“
„Wir müssen dann mit den Eltern von Adam reden“, sagte Begay.
„Adam hat keine Eltern. Er ist Waise.“
„Wer hat ihn denn hierher gebracht“, fragte Begay.
„Das war eine Sozialorganisation. Die haben sich auch weiter um ihn gekümmert. Ab und zu kam jemand von denen vorbei und hat ihn besucht. Ein Doktor Robbin.“
„Wieso haben die sich um ihn gekümmert?“
„Er wurde wohl als Kleinkind aufgefunden. Und in dem Ort, Woodville, gab es eine Organisation, die sich um sozial Schwache und ähnliches kümmert.“
„Was für eine Organisation war das denn“, hakte Caldwalder nach.
„Von einer Firma. Der Name fällt mir jetzt nicht ein. Irgendwas mit Biologie“, meinte Waldon.
„Können Sie das bitte nachsehen?“, fragte Begay.
Waldon kramte in ihren Akten und stutzte, dann sagte sie: „Hier! BioTech Woodville. Das ist sie!“
„Wo finden wir die?“
Waldon las die Adresse vor und Caldwalder schrieb mit.
„Dass Adam Nicks als Waisenkind auf ein Internat ging, leuchtet mir ein“, sagte er, „aber warum war Tsosie hier?“
Begay antwortete für Waldon: „Die Stammesschulen sind alle zu weit weg, wenn man im Big Mountain-Gebiet lebt. Gehört ja nicht mehr zur Navaho-Reservation. Und auch die Hopi-Schulen sind unerreichbar. Wenn man in der Gegend wohnt und eine gute Schulausbildung haben will, muss man auf ein Internat gehen.“
„Seine Brüder sind wohl nur auf die Grundschule gegangen. Edward hat mir erzählt, dass viele Kinder dort bis heute gar nicht zur Schule gehen“, ergänzte Mrs. Waldon.
„Ach so“, machte Caldwalder. „Wir müssten Sie dann um Fotos der beiden Jungen bitten.“
„Ja, natürlich, die gebe ich Ihnen mit.“
„Wir haben Sie dann lange genug belästigt“, fuhr Caldwalder, nachdem er sich mit Begay mit einem Blick verständigt hatte, fort. „Wir danken Ihnen sehr für Ihre Hilfe.“
VI
Begay und Caldwalder saßen zusammen bei einer Tasse Kaffee in einem kleinen Lokal in Flagstaff.
„Dass Navahos die Tat begangen haben könnten, können wir also ausschließen?“, fragte Caldwalder.
„Ich denke ja. Navahos töten, wie gesagt, nur aus Notwehr, im Affekt oder unter Alkoholeinfluss. Ein solches Verbrechen passt dazu einfach nicht“, antwortete Begay.
„Und was ist mit den Hopi?“
Begay lachte. „Wissen Sie, was Hopi bedeutet?“, fragte er.
Caldwalder verneinte und Begay fuhr fort: „Hopi heißt ‚Frieden‘ oder ‚die in Frieden leben‘, führte er aus und fügte hinzu: „Gegen die sind wir Dineh geradezu kriegerisch.“
„Aber haben denn nicht auch die Pueblo-Indianer und die Navaho Kriege geführt?“, fragte Caldwalder verwundert.