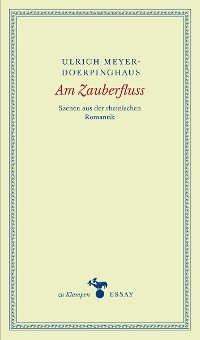Czytaj książkę: «Am Zauberfluss»
Reihe zu Klampen Essay
Herausgegeben von
Anne Hamilton
Ulrich Meyer-Doerpinghaus,
geboren 1967, lebt in Remagen-Oberwinter und ist Kommunikationsleiter der Hochschulrektorenkonferenz in Bonn. Nach dem Studium der Geschichte, Katholischen Theologie und Sozialwissenschaften in Münster und Louvain-la-Neuve (Belgien) war er Doktorand am Max-Planck-Institut für Geschichte in Göttingen und wurde 1996 promoviert. Für die Dissertation »Soziales Handeln im Zeichen des Hauses. Zur Ökonomik in der Spätantike und im früheren Mittelalter« wurde er mit der Otto-Hahn-Medaille der Max-Planck-Gesellschaft ausgezeichnet. Er war Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Visiting Scholar an der Harvard University und Projektmanager bei der Westdeutschen Landesbank.
ULRICH MEYER-DOERPINGHAUS
Am Zauberfluss
Szenen aus der rheinischen Romantik

Inhalt
Cover
Reihe zu Klampen Essay
Titel
Widmung
Zitat
Einleitung
Ich wähle dich!
Friedrich Schlegel und die Erfindung der Rheinromantik
Schimmel und Rappe
Annette von Droste-Hülshoff und die »Rheingräfin« Sibylle Mertens-Schaaffhausen
Zweierlei Mission
Ferdinand Freiligrath in Unkel
Ein schmerzhaftes Geheimnis
Franz Liszt und Marie d’Agoult auf Nonnenwerth
Bis in die Fremde
Johanna und Gottfried Kinkel, der Bonner Maikäferbund und die deutsche Revolution
In den Sternen
Die letzten Jahre von Clara und Robert Schumann
Quellen und Literatur
Danksagung
Impressum
Fußnoten
Für Johann und Anna
Den Rhein hat die Romantik eigentlich entdeckt, ja man kann sagen, geschaffen. Es gibt kaum ein besseres Beispiel für die Übermacht der Phantasie.
Ricarda Huch
Einleitung
IM Frühjahr 1790 brach der deutsche Naturforscher und Publizist Georg Forster auf zu einer Reise, die ihn durch das Rheintal zwischen Bingen und Koblenz führen sollte. Als sein Schiff zuvor die sanften Hänge des Rheingaus passierte, griff er nach einem Buch und las darin. Es trug den Titel »Reise nach Borneo« und stammte aus der Feder des holländischen Seefahrers Jacob Janson de Roy. Forster wollte sich mit der Lektüre in frühere Tage zurückversetzen: Zwischen 1772 und 1775 hatte er den britischen Seefahrer James Cook auf dessen zweiter Weltumseglung begleitet. Die kostbarsten Bilder, die Forster sich von jener Reise bewahrt hatte, wurden von dem Buch, in dem er jetzt las, hervorgelockt: das Licht des Südens, die angenehme Wärme, die exotischen Gerüche und die Faszination fremdartiger Menschen. Mit der Lektüre hatte es aber noch eine andere Bewandtnis: Forster wollte mit Hilfe der »Reise nach Borneo« die Eindrücke vertreiben, denen er hier, am Rheingau, ausgesetzt war. Er habe nämlich, so heißt es in seinem Tagebuch, seine »Phantasie an jenen glühenden Farben und jenem gewaltigen Pflanzenwuchs des heißen Erdstrichs, wovon die winterliche Gegend hier nichts hatte, gewärmt und gelabt«.
Als das Schiff am Binger Loch in das Rheintal einbog, sollte es für den Naturforscher noch schlimmer kommen: »Für die Nacktheit des verengten Rheinufers unterhalb Bingen erhält der Landschaftskenner keine Entschädigung. Die Hügel zu beiden Seiten haben nicht jene stolze, imposante Höhe, die den Beobachter mit einem mächtigen Eindruck verstummen heißt; ihre Einförmigkeit ermüdet endlich, und wenn gleich die Spuren von künstlichem Anbau an ihrem jähen Gehänge zuweilen einen verwegenen Fleiß verraten, so erwecken sie doch immer auch die Vorstellung kindischer Kleinfügigkeit.« Als Forster dann zu den Ritterburgen hinaufsah, geriet sein Urteil nicht milder: »Das Gemäuer verfallener Ritterfesten ist eine prachtvolle Verzierung dieser Szene; allein es liegt im Geschmack ihrer Bauart eine gewisse Ähnlichkeit mit den verwitterten Felsspitzen, wobei man den so unentbehrlichen Kontrast der Formen sehr vermißt.« Die Ruinen dort oben erschienen ihm »ängstlich«, die Städtchen unten am Fluss »melancholisch und schauderhaft«.1
Forster stand mit seiner Sichtweise in Deutschland nicht allein. Während die Engländer bereits Jahrzehnte vorher den Rhein zu ihrem Sehnsuchtsort erklärt hatten, betrachteten die Deutschen die Landschaft noch mit einiger Reserve. Das zerklüftete, geschichtsbeladene Rheintal passte nicht recht zum Geschmack der Aufklärung, die den klaren Formen, geraden Linien und einem vernunftgesättigten Glauben an die Gegenwart den Vorzug gab. Die steilen Hänge am Ufer des Rheins bereiteten den Deutschen dagegen einiges Unbehagen: Das alles war ihnen zu wirr und unübersichtlich, manchen erschien es sogar bedrohlich.
Diese Ressentiments hielten jedoch bekanntlich nicht lange vor. Mit Beginn des 19. Jahrhunderts erklärten die Deutschen den Rhein zum Inbegriff der Romantik: Der Philosoph Friedrich Schlegel entwarf kurz nach 1800 das neue Bild vom Rhein und erfand damit die deutsche Spielart der Rheinromantik. Fast zur gleichen Zeit fuhren die Freunde Clemens Brentano und Achim von Arnim auf dem Schiff durch das Rheintal und ließen sich zu vielen der Texte inspirieren, die in die Liedersammlung »Des Knaben Wunderhorn« eingegangen sind. Brentano erfand auch die Figur der Loreley, vor der später Heinrich Heine mit seinen Versen »Ich weiß nicht, was soll es bedeuten« eindrücklich warnen sollte. Spätestens als der Koblenzer Verleger Karl Baedeker im Jahr 1828 die »Rheinreise von Mainz bis Cöln. Handbuch für Schnellreisende« publizierte und damit die Reihe seiner Reiseführer eröffnete, war Forster widerlegt. Deutsche reisten von überall her an den Strom und ließen sich von der Landschaft begeistern. Die rheinromantischen Gedichte Kinkels, Freiligraths, Müllers von Königswinter, Simrocks und der Adelheid von Stolterfoht waren bald in aller Munde. Nicht weniger festigten die Gemälde Bleulers, Dietzlers oder Schirmers den Ruf der Landschaft. Um 1840 schien die Zeit der Rheinromantik eigentlich vorüber zu sein, doch da hatten es die Franzosen auf das linke Ufer des Flusses abgesehen, und der Rhein wurde zum Symbol der deutschen Nation erklärt. Heine mochte in »Deutschland. Ein Wintermärchen« den »armen Vater Rhein«, der »politisch kompromittiret« werde,2 noch so bemitleiden – lieber erinnerte man sich an Ernst Moritz Arndts alte, aus der Zeit der Freiheitskriege stammende Parole vom »Rhein, Teutschlands Strom, nicht Teutschlands Grenze«, und es wurde mit Vorliebe Nikolaus Beckers »Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein« oder Max Schneckenburgers »Wacht vom Rhein« gesungen.
Den Worten folgten indes bald Steine: Burgen und Schlösser bewehrten bald das Rheintal. Immer mehr Gäste strömten heran, der Rummel kannte keine Grenzen. Der Dichter Karl Simrock bemerkte in der Einleitung zu seinem »Malerischen und Romantischen Rheinland«: »Reisebücher, Karten, Panoramen, malerische und plastische Darstellungen einzelner Gegenden wie grösserer Strecken, Sagensammlungen in Versen und Prosa, und tausend andere Reisebehelfe sind in allen Kunst- und Buchläden in solcher Fülle zu Kauf, dass zwischen Mainz und Köln kaum ein Haus, kaum ein Baum gefunden wird, der nicht schon eine Feder oder einen Grabstichel in Bewegung gesetzt hätte. Diese Gegend ist so vielfältig beschrieben, abgebildet und dargestellt, dass man zuletzt das Postgeld schonen und sie mit gleichem Genuss in seinen vier Wänden bereisen kann.«3
Wie ist es heute um die Rheinromantik bestellt? Sie ist en vogue, keine Frage: Viele Ausstellungen, immer neue Bücher und zahlreiche Gäste, die an den Rhein kommen, belegen es. Und dennoch, die Rheinromantik scheint inzwischen etwas von ihrem Kern verloren zu haben. Es ist, als sei sie zu einer kulturellen Ikone geronnen, zum Opfer des Klischees geworden, das sie selbst erschaffen hat: efeubewachsene Gemäuer, weinselige Geselligkeit und Wehmut – die Bilder und Vorstellungen, die sich heute mit der Rheinromantik verbinden, sind unbestritten schön und pittoresk, aber eben nur das. Macht die Rheinromantik noch betroffen? Wollte heute noch einer an den Rhein ziehen, um sich vom Fluss berücken zu lassen und dabei die eigenen Schaffenskräfte entfesselt zu sehen? Gern genießt man die Landschaft bei Rotwein und Kerzenlicht – damit soll es dann aber sein Bewenden haben.
Dieses Missverständnis gilt für die Romantik überhaupt. Man hält die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts gerne für eine Zeit, die vor allem von Melancholie geprägt war. Der Schein trügt jedoch: Nie wurde mehr gesucht und gesehnt, mehr gespielt und gewagt als in der Romantik. Thomas Mann, der von seinen Kindern »der Zauberer« genannt wurde, schrieb über die romantische Seele, dass sie sich den »irrationalen und dämonischen Kräften des Lebens, das will sagen: den eigentlichen Quellen des Lebens nahe fühlt und einer nur vernünftigen Weltbetrachtung und Weltbehandlung die Widersetzlichkeit tieferen Wissens, tieferer Verbundenheit mit dem Heiligen bietet«.4
Oder vor einigen Jahren Rüdiger Safranski: »Der romantische Geist ist vielgestaltig, musikalisch, versuchend und verführerisch, er liebt die Ferne der Zukunft und der Vergangenheit, die Überraschungen im Alltäglichen, die Extreme, das Unbewußte, den Traum, den Wahnsinn, die Labyrinthe der Reflexion. Der romantische Geist bleibt sich nicht gleich, ist verwandelnd und widersprüchlich, sehnsüchtig und zynisch, ins Unverständliche vernarrt und volkstümlich, ironisch und schwärmerisch, selbstverliebt und gesellig, formbewußt und formauflösend.«5
Alles das kann man auch von den Rheinromantikern sagen. Sie haben das Rheintal zu ihrer Landschaft gemacht, weil es ihnen so unübersichtlich, widersprüchlich und zerklüftet erschien wie die menschliche Seele. Wo hätte man besser auf Erweckung und Glück spekulieren können als hier! Der Rhein: ein Zauberfluss! Ihm dürften die Rheinromantiker wohl ähnliche Wirkungen zugeschrieben haben wie Eichendorff dem berühmten »Zauberwort«:
»Schläft ein Lied in allen Dingen,
Die da träumen fort und fort,
Und die Welt hebt an zu singen,
triffst du nur das Zauberwort.« 6
Ich wähle dich!
Friedrich Schlegel und die Erfindung der Rheinromantik
PARIS, im Herbst 1803. Die Luft steht still, ein spätes Licht liegt über der Stadt. Die ersten Kastanienblätter fallen auf die Kieswege des Jardin des Tuileries. Sie sind bereits so welk geworden wie die Ideale, die nur ein Jahrzehnt zuvor hier, im Herzen Frankreichs, das Blut der Menschen erhitzt hatten. Noch stehen die Parolen der Revolution in schwarzen Lettern auf den Hauswänden: »Liberté, Égalité ou la Mort!«7 Der Sturm auf die Bastille ist aber längst Geschichte. Was ihm folgte, lässt sich in der Erinnerung kaum noch voneinander trennen: die Hinrichtung des Königspaares, die Errichtung der Republik, die Schreckensherrschaft der Jakobiner, die Greueltaten der Sansculotten. Dass man seit kurzem wieder im Krieg mit England liegt, interessiert kaum jemanden. Alltag zieht ins kriegsmüde Paris ein. Napoleon Bonaparte, der Erste Konsul, hat mit dem Staatsstreich vom 18. Brumaire 1799 die Alleinherrschaft an sich gerissen. Er schickt sich an, die Monarchie zu restaurieren. Argwöhnisch lässt er die eigene Bevölkerung bespitzeln, drückt Presse und Theater in die Zensur. Die Schriftstellerin Germaine de Staël, die den gesellschaftlichen Rückschritt in ihrem Roman »Delphine« kritisierte, wird des Landes verwiesen und muss ihren literarischen Salon aufgeben. Den Bürgern von Paris ist es einerlei. Sie wollen nur Ruhe – und die gibt Napoleon ihnen.
Wer jedoch die Stadt in Richtung Norden verließ, der konnte in einem stattlichen Haus an den Hängen des Montmartre eine kleine Wohngemeinschaft antreffen, die entschlossen schien, der Stimmung in der Stadt zu trotzen. Wo die Pariser Aristokraten die Sommerfrische in ihren Landhäusern zu verbringen pflegten, stand an der langen, schnurgerade aufsteigenden Rue de Clichy ein Haus mit Innenhof und einem großem Garten, der von hohen, alten Bäumen überragt wurde. Ein halbes Jahrhundert zuvor hatte hier der damalige Hausherr, der Baron d’Holbach, zusammen mit Rousseau und Diderot die »Encyclopédie«, das größte literarische Vorhaben der französischen Aufklärung, in Angriff genommen. Jetzt wohnte in dem Haus der deutsche Philosoph und Schriftsteller Friedrich Schlegel. Er strebte danach, in Paris das Ideal der romantischen Geselligkeit ins Werk zu setzen. Dazu sammelte er einen Kreis Gleichgesinnter um sich. Man las gemeinsam Texte, diskutierte oder trieb – wie es der Hausherr nannte – »Symphilosophie«.8
Der 1772 in Hannover als Sohn eines Pfarrers geborene Schlegel machte auf den ersten Blick den Eindruck eines eher ruhigen Zeitgenossen: Er war klein und untersetzt, hatte ein rundes, wie mit dem Zirkel gezogenes Gesicht, sein Kopf ruhte halslos auf dem Rumpf. Der zweite Blick belehrte den Beobachter jedoch eines Besseren: Schlegels wachen Augen entging nichts. Sein heller Verstand griff stets aus nach Neuem. Er war ein Frühaufsteher und Tausendsassa, ein funkensprühender Feuerkopf. Seit der frühen Kindheit hatte er unzählige Bücher gelesen. Die Zeitgenossen staunten über seine stupende Gelehrsamkeit. Ein jeder in Deutschland wusste es: Schlegel war Vordenker und Stichwortgeber der romantischen Bewegung. Drei Jahre zuvor, im Sommer 1799, hatte er in seiner Wohngemeinschaft in der Jenaer Leutragasse an heißen Tagen und in kurzen Nächten das Projekt der Romantik ersonnen, zusammen mit seiner acht Jahre älteren Lebensgefährtin Dorothea Veit, seinem Bruder August Wilhelm und dessen Frau Caroline, mit dem Philosophen Friedrich Schelling, dem Schriftsteller Ludwig Tieck und seinem engsten Freund Friedrich von Hardenberg, der sich Novalis nannte. Friedrich Schlegel besaß zwar nicht die poetischen Fähigkeiten der anderen, wusste aber am besten auf den Begriff zu bringen, worauf es der Romantik ankam: Skepsis gegenüber dem gleißenden Licht der Vernunft und Suche nach der – wie er es nannte – »schönen Verwirrung der Fantasie, […] dem ursprünglichen Chaos der menschlichen Natur«,9 ein nahezu grenzenloses Vertrauen in das schöpferisch tätige Subjekt, unbändige Neugierde für alles Unverständliche und Unendliche. Für Schlegel war all dies keine graue Theorie, sondern bot ihm einen praktischen Schlüssel zum menschlichen Glück, denn, so schrieb er, »die innere Zufriedenheit« hänge »irgendwo zuletzt an einem solchen Punkte, der im Dunkeln gelassen werden muß, dafür aber auch das Ganze trägt und hält, und diese Kraft in demselben Augenblicke verlieren würde, wo man ihn in Verstand auflösen wollte«.10
Berühmt wurde Schlegel, als er sich mit einem der größten Vernunftsoptimisten seiner Zeit öffentlich anlegte: mit Friedrich Schiller. Die gelehrten Beiträge, die dieser in den »Horen« und im »Musenalmanach« veröffentlicht hatte, verriss Schlegel mit zähem Fleiß. Als in der Jenaer Wohngemeinschaft aus Schillers »Glocke« vorgelesen wurde, fiel man vor Lachen fast vom Stuhl, belustigt von den Versen über die tugendhafte Hausfrau. Die Sache mit den Frauen sah Schlegel ganz anders als Schiller: Er zog es vor, ihnen eine starke Rolle zuzuschreiben. In dem Romanfragment »Lucinde« verbreitete Schlegel die für seine Zeit ungewöhnliche Erkenntnis, dass eine Ehe nur dann sinnvoll sei, wenn sie auf gegenseitiger Liebe beruhe. Mehr noch, er beeilte sich hinzuzufügen, die Befriedigung der körperlichen Lust sei in einer solchen Ehe durchaus möglich, sowohl für den Mann und – das war eine Provokation – auch für die Frau. Diese Feststellung versuchte er mit intimen Details aus der eigenen Verbindung mit Dorothea Veit zu belegen. So schrieb er vom »Blitz der Liebe«, der »in ihrem zarten Schoß gezündet«.11 Das war zu viel – nicht nur für Dorothea, sondern auch für ein Publikum, das sich zwar aufklärerisch, nicht aber aufgeklärt gab: Das Buch wurde zum Skandal.
Schlegel war, nachdem sich die Jenaer Wohngemeinschaft wegen verschiedener Spannungen und Eifersüchteleien aufgelöst hatte, mit Dorothea und Philipp, ihrem neunjährigen Sohn aus erster Ehe, nach Paris gezogen, um sich hier eine berufliche Existenz aufzubauen. In dem Haus an der Rue de Clichy wollte man den Geist von Jena zu neuem Leben erwecken. Die beiden gründeten eine Pension, in der bald zwei Sanskritexperten zur Miete wohnten, von denen einer, der Schotte Alexander Hamilton, seinem Pensionsvorsteher jeden Nachmittag von zwei bis fünf Uhr Unterricht in der altindischen Sprache erteilte. Zahlreiche Männer und Frauen fanden sich jeden Sonntag bei einem literarischen Tee-Abend in der Schlegel’schen Wohnung zusammen, gleich im Anschluss an eine öffentliche Vorlesung, die der Philosoph am »Athenée des étrangers« vor einer großen Menge Zuhörer gab, um, wie er es fasste, »das Evangelium auf meine Weise zu verkünden«.12 Bei den sonntäglichen Geselligkeiten verwandelte sich das Haus in einen Salon: Man las einander vor, diskutierte, musizierte gemeinsam, lachte, aß und trank viel. Die Gäste kamen aus vielen Ländern: Es waren Deutsche, Franzosen, Schweizer, Portugiesen, Dänen, Niederländer und Italiener darunter. So ließ sich zum Beispiel Dorothea von Rodde blicken, die erste promovierte Geisteswissenschaftlerin Deutschlands. Der Schriftsteller Achim von Arnim kam hinzu und stritt mit Schlegel über das, was Romantik im Kern bedeute. Der später berühmte italienische Bildhauer Lorenzo Bartolini bereicherte die Zusammenkünfte ebenso wie Vivant Denon, der Direktor des Musée Napoléon.
In diesem Getriebe wusste besonders eine zwanzigjährige Frau aufzufallen, nicht nur wegen ihrer großen mandelförmigen Augen und der langen schwarzen Haare, die sie zu einem Dutt hochgesteckt hatte. Mehr noch tat sie sich durch ihr Temperament, ihre Neugierde für Menschen und ihre ausgeprägte Gesprächsfreudigkeit hervor. Ihr koketter Charme war in Paris in aller Munde. Helmina von Halfter, so ihr Name, stammte aus Berlin und war die Enkelin der damals berühmten Schriftstellerin Anna Louisa Karsch. Diese Herkunft bereitete ihr ein vorzügliches Entree in die gehobenen Kreise von Paris. Helmina hatte es nach einer gescheiterten Ehe an die Seine verschlagen, wo sie als Korrespondentin für verschiedene deutsche Zeitungen tätig war. Bald übernahm sie auch die Redaktion einer Zeitschrift, der »Französischen Miscellen«, in denen sie Klatsch und Tratsch vom Hofe Napoleons zum Besten gab. Das deutsche Publikum las die Reportagen aus der Herzkammer des Feindes mit lebhaftem Interesse.
Helmina fühlte sich in der Hausgemeinschaft bestens aufgehoben, sie arbeitete am liebsten draußen in der Orangerie und liebte den Blick, der sich ihr von dort aus über ganz Paris bot. Den Gastgebern Friedrich Schlegel und Dorothea Veit war sie nah verbunden. Als das Paar im Sommer des vorangegangenen Jahres fast mittellos nach Paris gezogen war, hatte Helmina ihnen mit finanzieller Unterstützung über die schwierige Anfangszeit hinweggeholfen. Das vergalt ihr das Paar später mit dem Angebot, in das Holbach’sche Palais zu ziehen. Die junge Deutsche ließ sich nicht zwei Mal bitten. Besonders zu Dorothea fasste sie Vertrauen und Zuneigung. Jene war ihr wie eine zweite Mutter, mit ihr teilte sie ihre Geheimnisse, Ängste und Vorlieben. Die Tochter des berühmten Aufklärungsphilosophen Moses Mendelssohn verfügte wie Helmina über eine profunde Bildung, hatte ein ausgeprägtes Interesse an Literatur und betätigte sich als Schriftstellerin. Beide Frauen waren bereits ein Mal geschieden, was der einen genauso wenig ausmachte wie der anderen. Helmina sprach hingebungsvoll über ihre neue Ersatzmutter: »Sie war freudig und stark, großartig und mild, duftend wie eine Blume, saftig wie eine Frucht, feurig wie ein Mann, zartfühlend wie ein Weib.« Zu Friedrich Schlegel hatte Helmina dagegen ein eher kompliziertes Verhältnis. Sie betrachtete ihn mit einer Mischung aus Bewunderung und Skepsis. Nicht ohne Furcht nahm sie seine »kolossale überströmende Natur« zur Kenntnis. Sie schrieb, er sei »einklanglos und in seinem Wesen die entschiedensten Gegensätze offenbarend: weich wie ein Kind und schroff wie ein Gigant, hinwogend im Aether wie ein Adler und wühlend im Boden nach Vergnügungen, die ganz irdischer Natur waren«. Sie nahm wahr, wie der Mann von seinen gegensätzlichen inneren Impulsen hin- und hergezogen wurde: »Er wußte und erstrebte zu vielerlei.« Schlegel bemühte sich zwar nach Kräften, Helmina in ihrem Bildungsstreben zu unterstützen, doch fühlte sie sich von ihm zugleich oft zurückgestoßen. Das »Eckige und Schroffe, das öfters bei ihm hervortrat«, machte ihr oftmals großen Kummer.13
Die schwankenden Stimmungen Schlegels mögen ihren Grund darin gehabt haben, dass er in Paris nicht die Erfüllung fand, die er sich gewünscht hatte. Der Dreißigjährige verfolgte hier das Ziel, seine frei schwebende Existenz als privater Gelehrter aufzugeben und eine feste berufliche Stellung zu erlangen, um sich erstmals in seinem Leben auf verlässliche Einkünfte stützen zu können. Er setzte sich in Paris für die Gründung einer deutsch-französischen Gelehrtenakademie ein, an der er selbst zu lehren gedachte. Bei den Pariser Behörden stieß Schlegel aber auf taube Ohren, was ihn vollends ernüchterte. Bekleidet mit einem schwarzen Paletot, stromerte er durch die Stadt, während ihm sein durchlöcherter Hut das Aussehen einer, wie ein Augenzeuge formulierte, »Sperlingsscheuche«14 verlieh. Dabei wälzte er in seinem Kopf grollende Phantasien. Sein Unmut spießte alles auf, was französisch war oder nur so aussah. Schlegel fühlte sich als ein Exot. An seinen Bruder August Wilhelm schrieb er: »Auch die Ménagerie [der zoologische Garten im Jardin des Plantes] hier ist sehr schön; besonders der Elefant hat mir viel Achtung und Teilnahme eingeflößt. Er ist unstreitig nächst mir derjenige welcher am wenigsten hier zu Hause ist.«15 Schlegel war ratlos, er sehnte sich nach einem äußeren Ereignis, das ihn von seiner Unzufriedenheit erlösen würde.
Im September 1803 klopften drei junge Männer an das schwere Tor des Holbach’schen Palais, und es war Helmina, die als erste zur Stelle war und öffnete. Beim Anblick der Herrschaften konnte sie ein Schmunzeln kaum unterdrücken. Die Männer standen da »ganz weiß gepudert, mit Taubenflügeln und Zöpfen, in Fracks, seidenen Strümpfen und Schuhen mit goldenen Schnallen« – solche Toiletten trug man in Paris schon lange nicht mehr. Helmina trieb mit den dreien sogleich ihren Schabernack. Deren Frage, ob sie es wohl mit Frau Schlegel zu tun hätten, bejahte sie, woraufhin sie ein wohlklingendes Kompliment zu hören bekam: »Das Gerücht hat Sie uns nicht ganz schön beschrieben, Frau Schlegel!«16
Die Neuankömmlinge hatten den Weg von Köln, ihrer Heimatstadt, nach Paris in einer Postkutsche zurückgelegt. Es waren allesamt wohlbegüterte Kaufmannssöhne, von denen einer, offenbar der Älteste, sogleich die Rolle des Wortführers übernahm. Er stellte sich als Johann Baptist Bertram vor. Die beiden anderen waren offensichtlich jünger und, wie unschwer zu erkennen war, Brüder: Sie führten sich als Sulpiz und Melchior Boisserée ein. Während Bertram bereits ein Studium der Jurisprudenz und der Philosophie absolviert hatte, lag die Schulzeit für die beiden anderen noch nicht weit zurück.
Die Boisserée waren Sprösslinge einer Familie, die ursprünglich in der Gegend von Lüttich ansässig gewesen war. Der Vater war von dort nach Köln gezogen, um die Leitung des Handelshauses zu übernehmen, das ihm sein kinderloser Onkel vererbt hatte. Der tüchtige Boisserée hatte dann eine Kölner Kaufmannstochter geheiratet und mit ihr eine zwölfköpfige Familie gegründet, die »am Blaubach« wohnte, mitten in den verwinkelten Gassen der Stadt und nur einen Steinwurf von Neumarkt und Heumarkt entfernt. Der zwanzigjährige Sulpiz, im Verhältnis zu seinem jüngeren Bruder Melchior der zweifellos Aufgewecktere und Temperamentvollere, absolvierte eine Kaufmannslehre in Hamburg. Die Entwicklung des weltläufigen jungen Mannes nährte die Erwartung, dass er, wie von seiner Familie erhofft, in die Fußstapfen des Vaters treten und eine Karriere als Kaufmann einschlagen werde. Das wäre auch so gekommen, wenn er nicht durch Zufall bei einem Kölner Buchbinder »einem jungen Manne mit krausem Haar und lebhaften Augen« begegnet wäre, eben dem um sieben Jahre älteren Johann Baptist Bertram. Sulpiz Boisserée erinnert sich: »Das Gespräch führte gleich auf die Brüder Schlegel, besonders auf Friedrich; die unbedingte Begeisterung, welche der junge Mann für diese beiden genialen, aber etwas gar zu stürmisch auftretenden Männer aussprach, wollte mir nicht einleuchten.«17 Von den Vorbehalten des Sulpiz Boisserée aber ließ sich Bertram nicht entmutigen. In den kommenden Tagen und Wochen suchte er Sulpiz immer wieder auf und schrieb ihm mehrere Briefe, um ihn für Schlegels Ideen und Schriften zu begeistern. So gelang es Bertram, Sulpiz Boisserée mit dem Virus der Schlegel-Begeisterung zu infizieren. Jener beschloss, nun von den schönen Wissenschaften fasziniert, von der Kaufmannslaufbahn zu lassen, um statt dessen ein Studium zu beginnen. Er fasste den Plan, sich im Herbst 1803 an der Universität Jena zu immatrikulieren, wo die idealistische Philosophie durch Lehrer wie Friedrich Schelling oder Georg Wilhelm Friedrich Hegel in Blüte stand. Um die verbleibende Wartezeit zu überbrücken, schlug Bertram seinem neuen Freund einen Plan vor: Warum sollte man nicht nach Paris reisen, bei Schlegel anklopfen und für eine Weile bei ihm in die Lehre gehen? Sulpiz stimmte zu und überzeugte auch seinen jüngeren Bruder Melchior, sich den Reisenden anzuschließen.
In der Rue de Clichy angekommen, zögerten die drei nicht, Schlegel eine Bitte vorzutragen: Sie hätten den Wunsch, einige Wochen in seiner Pension zu wohnen und für das Gold, das sie ihm gäben, nicht nur Kost und Logis, sondern auch Privatvorlesungen zu erhalten. Diesen Wunsch erfüllte ihnen der Hausherr gern. Im »Cabinet«, dem Arbeitszimmer, erging er sich, zwischen Bücherstapeln und Haufen von Manuskripten stehend, vor seinen Zuhörern in gelehrten Ausführungen über Literatur, Kunstgeschichte und Philosophie. Der Parisaufenthalt der Kölner sollte sich wegen eines Hautleidens von Sulpiz indes verlängern, und so kamen sie ein halbes Jahr lang in jenen Genuss. Auch Helmina durfte mitlauschen. Sie äußerte sich hernach begeistert: »Unsere Stunden waren sehr belebt, der Geist durchwehte sie wie eine angenehme Zugluft.«18 Sulpiz war nicht weniger angetan: Schlegels »Urteile … fesselten uns, trotz der Paradoxien, worin er sich dann und wann verstieg«.19
Was bewegte die Kölner Gäste, ihre Pläne für Ausbildung und Beruf über Monate hintanzustellen, um sich von den Ideen eines Philosophen bereichern zu lassen? War es allein dessen schillernde Intellektualität, die den Ausschlag gegeben hatte? Gewiss, Bertram und die Boisserée gaben einem ausgeprägten Streben nach Bildung nach, das für die höheren Familien Kölns durchaus charakteristisch war. Doch spielte noch ein weiteres Motiv eine Rolle, und das waren die Zustände, in denen sich die Heimatstadt der drei Parisbesucher in jener Zeit befand. Seitdem die Franzosen die linksrheinischen Gebiete im Jahr 1794 besetzt hatten, war es mit Köln bergab gegangen. Die neuen Herren beraubten die Stadt nicht nur ihrer wirtschaftlichen Substanz, sondern sie hatten es auch auf den Lebensnerv abgesehen, der der Stadt seit jeher Stolz und Selbstbewusstsein gegeben hatte. Das waren die anscheinend zahllosen Kirchen, Klöster und Stifte und der unermessliche Reichtum, der in jenen Einrichtungen aufbewahrt wurde: mittelalterliche Tafelbilder, kostbares Schnitzwerk, liturgische Geräte aus wertvollen Materialien. Seit Beginn der Besetzung schafften die Franzosen das Kölner Kirchengut in großen Mengen nach Paris, wo im Jahr 1793 der Louvre zu dem Zweck eröffnet worden war, das Gut, das dem König und dem Adel Frankreichs sowie den eroberten Ländern geraubt worden war, aufzubewahren und öffentlich auszustellen. Die Situation sollte sich für Köln im Jahr 1802 weiter verschärfen. Im Juni dieses Jahres wurde im Rheinland das sogenannte Supressionsgesetz erlassen, ein Vorläufer des »Reichsdeputationshauptschlusses«, der ein Jahr darauf die Säkularisation für ganz Deutschland verbindlich machen sollte. Zwischen August und Oktober 1802 wurden in Köln fast alle geistlichen Institutionen aufgelöst. Man riss Kirchen und Klöster ab oder führte sie einem neuen, weltlichen Zweck zu. Priester und Ordensleute mussten binnen zehn Tagen die geistliche Kleidung ablegen und sich eine neue Bleibe suchen. Der gesamte Kirchenbesitz wurde kurzerhand zu französischem Nationalgut erklärt. Ein Teil davon übergab man einer Reihe deutscher Fürsten östlich des Rheins, die Napoleon sich als künftige Bündnispartner gegen Preußen und Österreich gewogen machen wollte. Der andere Teil ging vom Staat zurück in private Hände: Kunstgegenstände wurden von Sammlern angeboten und auf den Jahrmärkten verhökert.
Diese Geschehnisse warfen für die Zeitgenossen eine Frage auf: Welchen Wert hatte eigentlich die Kunst des Mittelalters? Der aufgeklärte Zeitgeist sprach ein klares Urteil: Die Kunst der Antike und der Renaissance war wertvoll, die des »finsteren« Mittelalters dagegen nicht. Bevor sich der Markt diesem Geschmacksurteil anpassen sollte, ergriffen die vornehmen Familien Kölns die Initiative. Sie wollten das kulturelle Erbe der Stadt retten, indem sie der Kunst des Mittelalters einen neuen, höheren Wert verliehen. Das war, so wurde es in den höheren Kreisen der Stadt einhellig begriffen, zur entscheidenden Existenzfrage Kölns geworden.
Hier dürfte wohl der entscheidende Grund zu suchen sein, warum Bertram und die Boisserée nach Paris reisten. Schlegel war für sie der ideale Mann, um die Kölner Ambitionen zu unterstützen. In der Zeitschrift »Europa«, die er seit dem Frühjahr 1803 herausgab, unternahm er den Versuch, die mittelalterliche Kunst neu zu entdecken und sie zu diesem Zwecke genauestens zu beschreiben. Das Musée Napoléon, wie der Louvre inzwischen hieß, bot ihm dafür einen breiten Fundus an. Weil der neue Blick, den Schlegel auf die mittelalterliche Kunst warf, die Kölner Gäste zu ihm gelockt hat, erscheint an dieser Stelle ein Exkurs über die sogenannten Gemäldebeschreibungen des Philosophen lohnenswert.