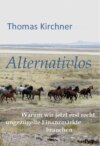Czytaj książkę: «Alternativlos»
Thomas Kirchner
Alternativlos
Thomas Kirchner
Alternativlos
Warum wir jetzt erst rechtungezügelte Finanzmärktebrauchen

2. Aktualisierte E-Book-Auflage
© TvR Medienverlag, Jena 2016
All rights reserved.
E-Book ISBN 978-3-940431-58-5
eBook-Herstellung und Auslieferung:
readbox publishing, Dortmund
Inhalt
Einleitung: Worum es geht
1 Verursacht Devisenhandel Krisen?
2 Wurde die Asienkrise durch Währungsspekulanten ausgelöst?
3 Verhindert „Turbokapitalismus“ nachhaltiges Wirtschaften?
4 Regiert Geld die Welt?
5 Sind Verbriefungen gefährlich?
6 Wozu braucht man Rating-Agenturen?
7 Was bringt eine europäische Rating-Agentur?
8 Sind Rating-Agenturen am Griechenland-Debakel schuld?
9 Gaben Banken Griechenland leichtfertig Kredite?
10 Sollten Leerverkäufe verboten werden?
11 Welche Finanzinstrumente sollen verboten werden?
12 Warum brauchen wir Investmentbanken?
13 Brauchen wir ein Trennbankensystem?
14 Unterstützen Hedgefonds und die Wall Street hauptsächlich die Republikaner?
15 Attackieren Spekulanten den Euro?
16 Sind Immobilienkäufer Opfer der Banken?
17 Warum mußten Banken in der Krise gerettet werden?
18 Müssen Hedgefonds stärker reguliert werden?
19 Wurde die Finanzkrise durch Banken und Hedgefonds ausgelöst?
20 Brauchen die DAX-Konzerne eine Frauenquote
21 Sind Subprime-Hypotheken riskant?
22 Sind 25 Prozent Eigenkapitalrendite zu viel und unmoralisch?
23 Wie viele Billionen sind spekulativ am Devisenmarkt investiert?
24 Was bringt eine Finanztransaktionssteuer?
25 Gibt es einen Währungskrieg?
26 Treiben Spekulanten die Rohstoffpreise in die Höhe?
27 Wie sehr profitieren Spekulanten von Kreditversicherungen?
28 Sollten hohe Gehälter gedeckelt werden?
29 Zahlen Unternehmen wie General Electric wirklich keine Steuern?
30 Wie gefährlich sind Pensionsfonds?
31 Sind Nichtregierungsorganisationen demokratischer als Unternehmen?
32 Zerstören angelsächsische Heuschrecken unseren soliden Mittelstand?
33 Verschärft Turbokapitalismus Einkommensunterschiede?
34 Mit Steuern Ungleichheit bekämpfen?
35 Warum brauchen wir Steueroasen?
36 Schaden Steueroasen dem Fiskus?
37 Leben Amerikaner über ihre Verhältnisse?
38 Ist die Finanzbranche zu groß?
39 Wer gehört zum oberen einen Prozent?
40 Sollte man Reiche und Kapital stärker besteuern?
41 Wann ist der keynesianische Endpunkt erreicht?
42 Sind Steuern auf Kapital und Vermögen sinnvoll?
43 Schulden mit mehr Schulden zurückzahlen?
44 Wiederholt sich Havensteins Trugschluß?
45 Kann der Euro überleben?
46 Jetzt mehr Markt!
Anhang
Einleitung:
Worum es geht
Seit der Finanzkrise quellen die Bücherregale mit empörten Erklärungsversuchen, kapitalismuskritischen Streitschriften und alarmierenden Vorhersagen über, meist verfasst von aufgeregten Zeitgenossen, die es schon immer gewusst haben wollten. Manchmal melden sich auch selbsternannte Aussteiger zu Wort, die plötzlich auf mysteriöse Weise zu Kritikern geläutert wurden, nachdem sie vorher jahrelang gut im Finanzsystem verdient haben und jetzt neue Einnahmequellen brauchen. Es ist ein wohlbekanntes Muster. Wir werden mit Warnungen vor Krisen, Kriegen und Katastrophen derart überschwemmt, dass man sich kaum noch aus dem Haus wagt.
Mit diesem Buch gehe ich bewusst einen anderen Weg. Es wäre nicht sehr schwierig, dem am Boden liegenden Finanzsektor, dessen öffentlicher Ruf bekanntlich ruiniert ist, noch einen weiteren Schlag zu versetzen. Vielleicht zur Krönung noch ein paar Klischees über gierige Bankiers. Doch mehr als genug andere tun das bereits im Überfluss. Wesentlich interessanter und schwieriger ist die eigentliche Frage: War wirklich alles so leicht vorhersehbar, wie im Nachhinein behauptet wird? Der Nobelpreisträger Joseph Stiglitz betont heute bei jeder Gelegenheit, dass er lange vor der Krise gewarnt hatte. Doch er vergisst zu erwähnen, dass er gegen ein großzügiges Honorar ungefähr zur gleichen Zeit eine Studie verfasste, in der er zum Schluss kam, die Immobilienfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac könnten den Staat im schlimmsten Fall zwei Millionen Dollar kosten.1 Die tatsächlichen Rettungskosten beliefen sich dann zwar auf fast 200 Milliarden, doch Stiglitz findet auch heute noch Anerkennung als Krisenexperte.
Die Materie ist komplex und die Krisenliteratur inzwischen so unübersichtlich, dass nur noch wenige Experten in der Lage sind, ernstzunehmende Verbesserungsvorschläge von Scharlatanerie zu unterscheiden. Deshalb vermeide ich detaillierte Beschreibungen der diversen Hilfsprogramme mit ihren zahllosen Abkürzungen – interessierte Leser können anderswo umfangreiche Schilderungen finden. Ich gehe davon aus, dass die meisten mit den groben Zügen der Krise aus der eigenen Lebenserfahrung vertraut sind. Eine genaue Kenntnis der Rettungsmaßnahmen oder einzelner Finanzprodukte ist für das Verständnis aber nicht notwendig.
Dieses Buch enthüllt Scharlatane, die von der Krise profitieren und uns durch fehlerhafte Erklärungen, unzulässige Vereinfachungen und undurchdachte Forderungen manipulieren wollen. Kaum jemand sah die Krise kommen. Einige sahen sie schon vorher, als die Grundlagen der Krise noch gar nicht gelegt waren und verkauften seit den 80er und 90er Jahren regelmäßig Bücher mit Titeln wie Die Krise kommt. Wer lang genug eine Katastrophe prophezeit, hat durchaus die Chance, irgendwann richtig zu liegen. Dann erscheint der Protagonist dieser Forderung plötzlich als weiser Prophet.
Im Nachhinein ist man eben immer schlauer. Seltene Ereignisse wie Erdbeben und Finanzkrisen eignen sich ganz besonders für die Warnungen von Scharlatanen. Wenn das Ereignis dann doch eintritt, sollte aus einem Scharlatan eigentlich nicht automatisch ein ernstzunehmender Experte werden. Für Auftritte in Fernsehsendungen mag seine Glaubwürdigkeit steigen, aber ein Scharlatan bleibt trotzdem ein Scharlatan.
Dieses Buch zeigt, wie sich Kapitalismuskritiker aller politischen Richtungen skrupellos der Finanzkrise bedienen, um die Öffentlichkeit für ihre Ziele zu gewinnen – oder einfach nur Bücher zu verkaufen. Als Kontrast zu dieser Art Literatur, die auf Bauchgefühl anstatt auf Fakten setzt, präsentiere ich bewusst Statistiken, um Trugschlüsse zu entlarven und Tatsachen zu belegen.
Damit begebe ich mich auf dünnes Eis. Denn wer quantitativ argumentiert, gilt als herzloser Zahlenjongleur und setzt sich dem Vorwurf aus, Erbsenzähler oder, schlimmer noch, Ingenieur zu sein. Ich würde solche Vorwürfe als Kompliment auffassen, denn die Geistesblitze der Ingenieure sind es, die der Menschheit Fortschritt bescheren. Googles Chefvolkswirt Hal Varian bemerkte zur zunehmenden Bedeutung von Statistiken:
Ich sage immer wieder, dass der coolste Beruf der nächsten zehn Jahre der Statistiker sein wird. Die Leute denken, ich mache einen Witz, aber wer hätte gedacht, dass Computerprogrammierer den coolsten Beruf der 1990er Jahre haben würden? Die Fähigkeit, Daten zu verarbeiten – in der Lage zu sein, sie zu verstehen, aufzubereiten, Wert daraus zu schöpfen, grafisch darzustellen, sie zu kommunizieren – all das werden sehr wertvolle Kenntnisse sein.2
Im Gegensatz dazu liefern Zahlen für Kapitalismuskritiker lediglich den Beweis dafür, dass die Märkte den Menschen zum Sklaven gemacht haben. Bei einer solchen Denkweise ist jegliche vernünftige Diskussion von vorneherein ausgeschlossen.
Die meisten Probleme, die sich während der Finanz- und Staatsschuldenkrisen offenbarten, gehen keineswegs auf gierige Bankiers zurück, wie die vereinfachenden Experten in Fernsehrunden behaupten. Meist stecken langjährige Entwicklungen dahinter, oftmals von der Politik gefördert, aber immer von ihr mindestens abgesegnet. Im Nachhinein liegt es nahe, verantwortungsloses Handeln gieriger Bankiers als Ursache allen Übels abzustempeln. Doch der komplette Hintergrund ist weit differenzierter. Wir leben in einer komplexen Welt, in der vernünftig erscheinende Entscheidungen meist unbeabsichtigte Folgen haben können.
Ein Beispiel vorab: Nach der lateinamerikanischen Schuldenkrise der 80er Jahre förderte man die Verbriefung von Krediten, um zu verhindern, dass Kreditrisiken in den Banken verbleiben. Nach der aktuellen Finanzkrise behaupten nun regulierungswütige Besserwisser, Krisen könnten vermieden werden, wenn Verbriefungen beschränkt werden. Die unbeabsichtigten Folgen sind schon vorherzusehen: Faule Kredite werden irgendwann wieder Banken in Schieflage bringen, und dann wird man erneut zu der Einsicht kommen, dass Verbriefungen ein gutes Instrument sind, um Risiken aus den Banken herauszulösen. Unbeabsichtigte Folgen sind quasi ein Naturgesetz der modernen Gesetzgebung.
Viel ist schiefgelaufen, aber nichts geschah außerhalb und ohne Mitwissen des Staats, also von Politik und Verwaltung. Die meisten Ereignisse waren eine Wiederholung der Geschichte. Nicht gierige Banken haben das Finanzsystem im Alleingang geschaffen, sondern in Zusammenarbeit, und oftmals unter dem Druck, der Staaten.
Dieses Buch zeigt deshalb auch, wie der Staat zur Vermeidung von Krisen genau die Strukturen schuf, denen jetzt die Verantwortung für die Krise zugeschoben wird. Neue Vorschriften werden nicht Krisen verhindern, sondern Wohlstand. Was wir brauchen, ist mehr Markt und weniger Staat.
Es ist ein Muster, das wir schon in der Vergangenheit gesehen haben. Nach jeder Krise werden neue Vorschriften erlassen, die möglicherweise die vergangene Krise verhindert hätten. Genau diese Maßnahmen werden dann zehn oder zwanzig Jahre später für die nächste Krise verantwortlich gemacht. Denn anstatt Krisen zu verhindern, verzögern viele Vorschriften lediglich notwendige Anpassungen. Da die Welt aber nun einmal nicht stabil ist, sondern sich kontinuierlich wandelt, schaffen die Vorschriften nur einen Schein von Stabilität.
Diese vermeintliche Stabilität maskiert lediglich die sich langsam aufbauenden Spannungen, die sich in der nächsten Krise entladen. Feinde freier Märkte freuen sich über die Stabilität und loben die ihre Weitsicht und die durch sie geschaffenen Gesetze. Für die nächste Krise sind dann nicht sie verantwortlich, sondern näher liegende Täter: gieriges Finanzkapital und Spekulanten. Seltsam nur, dass niemand diese mysteriösen Spekulanten fassen kann.
Risiko lässt sich nicht per Gesetz abschaffen. Die Idee, durch Gesetze mehr Stabilität in eine instabile Welt zu bringen, ist absurd. Doch genau dies wird im augenblicklichen populistischen Klima suggeriert. Die gleichen Aufsichtsbehörden, die vor der letzten Krise geschlafen haben, sollen jetzt mit zusätzlichen Kompetenzen wacher werden.
Wahrscheinlicher ist, dass sie mit mehr Kompetenzen die letzte Krise bekämpfen und die nächste verschlafen. Denn auch hier gilt: die Zukunft kann man nicht perfekt vorhersagen. Aufsichtsbehörden können nicht die Zukunft bestimmen, sondern lediglich hoffen, dass die gegenwärtigen Vorschriften genau richtig sind. Aufsichtsbehörden haben vor der letzte Krise nicht über unzureichende Kompetenzen geklagt. Sie haben genauso versagt, wie alle anderen Beteiligten auch. Dennoch sollen der Staat und damit auch die Behörden jetzt kräftig zupacken und in Zukunft alles besser machen.
Ich gehe in diesem Buch deshalb auch darauf ein, wie schwierig es sein kann, sinnvolle Entscheidungen im Voraus von unsinnigen zu unterscheiden. Natürlich gehen die Meinungen immer auseinander, und es gibt stets plausible Argumente für und auch gegen ein und dieselbe Vorschrift. Solange wir die Zukunft nicht perfekt vorhersagen können, werden sich Gesetze und Vorschriften im Laufe der Zeit immer wieder entweder als unzureichend oder als kontraproduktiv erweisen.
Ich argumentiere in diesem Buch deshalb, dass sich der Staat nicht länger auf das derzeitigen Bankensystem stützen sollte, sondern echte Kapitalmärkte ermöglichen sollte, in denen nicht Banken das Zentrum bilden, sondern echte Kapitalgeber über ihre Anlagen entscheiden können. Europa verlässt sich zu sehr auf den Staat und die Banken. Es ist Zeit für weniger Staat, weniger Banken und mehr Markt.
1 Joseph E. Stiglitz, Jonathan M. Orszag und Peter R. Orszag. Implications of the New Fannie Mae and Freddie Mac Risk-based Capital Standard. Fannie Mae Papers, Washington D.C., März 2002.
2 Hal Varian, „Hal Varian on how the Web challenges managers” In: The McKinsey Quarterly, 1. 2009. Übersetzung des Autors.
1
Verursacht Devisenhandel Krisen?
K ritiker datieren den Beginn des Finanzkapitalismus auf die Freigabe der Wechselkurse in den 70er Jahren. Damit wurde, so der Vorwurf, Spekulation auf Wechselkurse überhaupt erst möglich. In diesem Augenblick habe ein Zeitalter der Deregulierung begonnen, das in der aktuellen Krise endete. Zur Zeit des Bretton Woods-Systems, das auf feste Wechselkurse und Goldkonvertibilität aufbaute, sollen demnach paradiesische Zustände geherrscht haben, bei denen sich Währungen nie änderten, das Wachstum hoch und Krisen unbekannt waren.
Doch die Verfechter dieser Behauptungen ignorieren einfach die wahre Geschichte von permanenter Instabilität, Krisen und häufigen Abwertungen. Denn entgegen allen Behauptungen wurden 1971 nicht primär die Wechselkurse freigegeben. Vielmehr wurde der Goldstandard abgeschafft, der seit dem Abkommen von Bretton Woods im Jahr 1945 einen Dollar als ein Fünfunddreißigstel einer Feinunze Gold definierte. Oder umgekehrt formuliert: Eine Feinunze Gold sollte 35 Dollar kosten. Die Konvertibilität des Dollars war natürlich nicht für jedermann zu haben. Nur Zentralbanken konnten ihre Dollarreserven in Gold wechseln lassen.3
Alle anderen Währungen koppelten sich freiwillig an den Dollar und mussten entweder durch Gold besichert sein, oder durch Dollar, und damit indirekt ebenfalls durch Gold. Der große Nachteil jedes Systems fester Wechselkurse ist die Unmöglichkeit einer autonomen Geldpolitik. Die Geldpolitik der Zentralbanken richtete sich nicht nach den Erfordernissen ihrer jeweiligen Volkswirtschaft, sondern nach der Stabilität des Wechselkurses zum Dollar. Grundsätzlich gilt, dass feste Währungen nur in Wirtschaftsräumen sinnvoll sind, deren Zyklen eng beieinander liegen. Das System von Bretton Woods zwängte die ganze Welt in einen einheitlichen Wirtschaftsraum. Dies führte zwangsweise zu erheblichen Spannungen.
Zur Zeit des Wiederaufbaus bis in die 60er Jahre hinein litt Europa unter akuter Kapitalknappheit. Im Laufe der 60er Jahre änderte sich dies jedoch und die Vereinigten Staaten bauten ein doppeltes Haushalts- und Leistungsbilanzdefizit auf. Nun litt die Welt nicht mehr an Kapitalknappheit, sondern an einem Überschuss von Dollar. Die Situation wurde als sogenanntes Triffin-Dilemma4 bezeichnet: alle Länder brauchten Dollar, um miteinander handeln zu können. Dollar konnten sie aber nur durch Handelsüberschüsse mit den USA bekommen. Also mussten die Vereinigten Staaten entweder unter einem permanenten Handelsdefizit leiden, oder die Weltwirtschaft wäre zusammengebrochen. Doch ein permanentes Handelsdefizit ist ebenfalls äußerst instabil. Folglich war das gesamte System fester Wechselkurse auf einem instabilen Fundament aufgebaut.
Als der in vielerlei Hinsicht glücklose Präsident Nixon die Konvertibilität des Dollar in Gold aufhob, wurde aus dem Goldstandard ein Dollarstandard. Somit bestand natürlich kein Grund mehr, die anderen Währungen fest an einen Dollar zu koppeln, der nicht mehr durch Gold gesichert ist. Innerhalb weniger Jahre standen fast alle Währungen in flexiblen Wechselkursen zueinander. Das Ende der Goldkonvertibilität war keineswegs ein Akt amerikanischer Deregulierungswut, wie heute manchmal behauptet wird, sondern war eine Flucht aus dem Korsett der festen Wechselkurse.
Es war übrigens auch die Konsequenz einer europäischen Anti-Dollar Politik. Da der Dollar Leitwährung war, hatten Zentralbanken weltweit jahrelang Dollar gesammelt, und zwar weit mehr Dollar, als durch Goldreserven gedeckt waren. Ein durch feste Wechselkurse überbewerteter Dollar verhinderte die Wettbewerbsfähigkeit amerikanischer Exporte, so dass der Handel mit Gütern nicht den Rückfluss der angehäuften Dollar erzielen konnte. Daher kam es zu einem Leistungsbilanzdefizit der USA. Das wiederum führte dazu, dass Zentralbanken auf unablässig steigenden Dollarreserven saßen.
Das Problem dabei war, dass diese Dollar durch Gold hätten gedeckt sein sollen. Die Geldmenge konnte nur wachsen, wenn mehr Gold zur Verfügung stand. Das Wirtschaftswachstum war also in gewissem Umfang von der Goldförderung abhängig, und ein großer Teil der weltweiten Goldminen liegt ausgerechnet in der Sowjetunion, die im kalten Krieg nicht gerade an der Förderung des Wachstums klassenfeindlicher Volkswirtschaften interessiert war.
Die einzige Lösung während des starken Wachstums der 50er und 60er Jahre war also die Ausgabe von mehr Geld, als durch Gold gedeckt werden konnte. Da der Dollar die Ankerwährung des Systems war, bedeutete dies, dass mehr Dollar existieren mussten, als durch Gold gedeckt waren. Die Schere zwischen Dollar und Gold ging so weit auseinander, dass 1970 nur noch 55 Prozent der von ausländischen Zentralbanken angehäuften Dollarreserven durch Gold gedeckt werden konnten, ein Jahr später aufgrund der starken Goldabflüsse aus den USA sogar nur noch 22 Prozent.
Die bei weitem größte Schwäche war jedoch nicht der Goldstandard selbst, sondern die grundsätzlichen Fehlkonstruktion eines jeden Systems fester Wechselkurse. Sie funktionieren nur, wenn all Staaten die exakt gleiche Inflationsrate haben.
Bei der Planung des Systems von Bretton Woods war diese Voraussetzung einfach als ein immerwährender Zustand angenommen worden. In der Realität gingen die Inflationsraten gegen Ende der 60er Jahre in der Welt aber immer weiter auseinander. Steigende Inflationsraten waren übrigens politisch durchaus gewollt, sowohl in den USA als auch in Europa.
In den 60er Jahren setzte sich die Idee der sogenannten Phillipskurve durch.5 Diese Theorie besagt, dass man die Arbeitslosigkeit senken kann, wenn man ein bisschen Inflation schafft. Eine solche schleichende Inflation wird übrigens auch heute wieder von Paul Krugman und anderen Keynesianern gefordert. Durch die Theorie der Phillipskurve wurde Inflation salonfähig, zumindest in einigen Ländern. Die Bundesbank war eine der wenigen Ausnahmen und hielt an ihrer antiinflationären Geldpolitik fest. Sie sollte Recht behalten, denn in den 70er Jahren ging die Welt dann durch eine Ära der Stagflation – also Inflation in Kombination mit wirtschaftlicher Stagnation und hoher Arbeitslosigkeit. Das sollte in der Theorie der Phillipskurve eigentlich nicht vorkommen.
Nach diesen Erfahrungen glauben heute nur noch wenige Unverbesserliche an die Phillipskurve.
| Jahr | Land | Aufwertung (+) oder Abwertung (-) in Prozent |
| 1961 | Deutschland | +5,0 |
| Niederlande | +5,0 | |
| 1962 | Kanada | -11,8 |
| 1967 | Großbritannien | -14,3 |
| Dänemark | -7,9 | |
| 1969 | Frankreich | -11,4 |
| Deutschland | +9,3 | |
| 1971 | Österreich | +5,05 |
| Schweiz | +7,07 |
Tabelle 1: Währungskrisen in führenden Industrienationen in der Zeit fester Wechselkurse im Jahrzehnt von 1960 bis 1971; Quelle: Samuel Katz, Devaluation-Bias and the Bretton Woods System. Discussion Paper No 2, Board of Governors of the Federal Reserve, Washington D.C., 1971.
Mit steigenden Inflationsraten wurden die Spannungen im System fester Wechselkurse immer offensichtlicher. Je länger das System existierte, desto häufiger wurden Anpassungen der Wechselkurse. Verteidiger des Bretton Woods-Systems hätten dies auch genauso formuliert, als Anpassung der Wechselkurse. Dahinter verbirgt sich allerdings nichts anderes als eine Währungskrise, wie sie sich gegen Ende der 60er Jahre häuften. Tabelle 1 zeigt diese Anpassungen für die größeren europäischen Staaten nach 1960.
Jede dieser sogenannten Anpassungen war jedoch in Wirklichkeit eine kleine Krise, wie von heutigen Anhängern fester Wechselkurse gerne übersehen wird. Die Entscheidung über eine Auf- oder Abwertung schafft immer Gewinner und Verlierer und ist damit hochpolitisch. Regierungen neigen dazu, erst dann auf- oder abzuwerten, wenn es nicht mehr anders geht. Genau das ist die Definition einer Währungskrise, wie es sie aber nach Meinung vieler Kapitalismuskritiker damals gar nicht gab.
Für weniger entwickelte Staaten waren Auf- und Abwertungen in der Zeit von Bretton Woods ein weit häufigeres Vorkommnis. Tabelle 2 zeigt insgesamt 48 Währungskrisen in Entwicklungsländern und auch weniger entwickelten Staaten Europas, bei denen die Wechselkurse um mindestens 14 Prozent stiegen oder fielen. Abwertungen um geringere Beträge sind nicht aufgelistet. Das bedeutet, es gab in dem Vierteljahrhundert des Bretton Woods Systems im Schnitt rund zwei Währungskrisen pro Jahr.
Die Behauptung, Währungskrisen wären das Produkt flexibler Wechselkurse oder gar des Devisenhandels, ist entweder ein Zeichen von Ignoranz, oder reine Propaganda.
| 1954 | Mexiko |
| 1955 | Argentinien, Nicaragua, Pakistan |
| 1957 | Kolumbien |
| 1958 | Türkei, Peru |
| 1959 | Uruguay, Argentinien, Spanien |
| 1960 | Korea |
| 1961 | Costa Rica, Ecuador, Jugoslawien |
| 1962 | Israel, Argentinien, Kolumbien, Ägypten, Philippinen, Chile |
| 1963 | Uruguay |
| 1964 | Korea, Venezuela, Tunesien |
| 1965 | Kolumbien, Jugoslawien |
| 1966 | Indien |
| 1967 | Brasilien, Ghana, Israel, Jamaika, Kolumbien, Malawi, Peru, Sierra Leone, Spanien, Sri Lanka, Trinidad und Tobago, Zaire |
| 1970 | Argentinien, Ecuador, Indonesien, Philippinen, Türkei |
| 1971 | Ghana, Israel, Uruguay, Jugoslawien |
Tabelle 2: Währungskrisen mit mindestens 14 Prozent Kursänderung in weniger entwickelten Ländern zur Zeit der festen Wechselkurse des Bretton Woods-Systems. Nach: Sebastian Edwards, Julio Santaella: Devaluation Controversies in the Developing Countries: Lessons from the Bretton Woods Era. In: A Retrospective on the Bretton Woods System: Lessons for International Monetary Reform. University of Chicago Press, Chicago 1993
Obwohl nach den Regeln des Systems von Bretton Woods der offizielle Kurs des Dollars zu Gold bei 35 Dollar pro Feinunze lag, wurde Gold in Europa zu Preisen von bis zu 40 Dollar ge- und verkauft, also weit über der Parität. Wenn Amerikanern der private Besitz von Gold nicht verboten gewesen wäre, hätte sich der Goldpreis zweifellos auch auf der anderen Seite des Atlantiks ähnlich entwickelt. Die Käufer ahnten offenbar, dass die Tage von Bretton Woods gezählt waren und zahlten freiwillig einen höheren Preis, um im Fall eines Zusammenbruchs des Systems Gold als Sicherheit zu besitzen.
Zentralbanken versuchten in konzertierten Aktionen, durch Verkäufe ihrer Goldreserven den Goldpreis auf 35 Dollar zu drücken. Diese Verkäufe ermöglichten Zentralbanken ein lukratives Geschäft: sie konnten Gold auf dem Markt für bis zu 40 Dollar an Privatpersonen verkaufen und anschließend 35 der so erworbenen Dollar bei der amerikanischen Zentralbank in Gold umtauschen. Die Differenz von bis zu fünf Dollar war ihr Gewinn und gleichzeitig für die amerikanische Zentralbank ein Verlust.
Insbesondere die französische Regierung machte von dieser Möglichkeit im großen Stil Gebrauch, wodurch die amerikanischen Goldreserven bedrohlich schrumpften. Es ist nicht verwunderlich, dass sich die amerikanische Regierung diese französischen Tricksereien nicht lange bieten lassen wollte. Man sieht: Es waren keine finsteren Finanzspekulanten, die das System missbrauchten, sondern Regierungen.
Es war also nur eine Frage der Zeit, bis das System fester Wechselkurse, das auf Gold beruhte, zusammenbrechen würde. Es war klar, dass Gold gegenüber dem Dollar zu billig war. Und da der Dollar und alle anderen Währungen fest aneinander gekoppelt waren, war Gold in allen Währungen zu billig. Eine Abwertung des britischen Pfunds im Jahr 1967 um 14,3 Prozent hatte aller Welt verdeutlicht, dass feste Wechselkurse nicht auf alle Ewigkeit fest sein würden. Briten, die rechtzeitig Gold gekauft hatten, konnten dadurch einen Verlust ihrer Ersparnisse um 14,3 Prozent verhindern. Wer konnte, sparte von nun an in Gold statt Geld.
Die Abwertung des Pfunds von 1967 war bei weitem nicht die erste Abwertung im System der doch eigentlich festen Wechselkurse. In den Jahren vorher hatten bereits viele andere Staaten abgewertet und Deutschland aufgewertet. Die Höhe der Abwertung durch ein so großes Land wie Großbritannien war jedoch ein Schock. Sie hatte Signalwirkung und zeigte, dass die Tage weltweit fester Wechselkurse gezählt waren.
Auch in Deutschland führten feste Wechselkurse zu wirtschaftlichen Spannungen, die heute längst vergessen sind und deshalb ignoriert werden. Deutsche Exportüberschüsse und niedrigere Inflation als im Rest der Welt sorgten für Aufwertungen der D-Mark in den Jahren 1961 (5 Prozent) und 1969 (9,3 Prozent).
Beide Aufwertungen geschahen nicht in einem Vakuum, sondern waren lange erwartet. Die Politik zögerte jedes Mal, denn jede Aufund Abwertung hat Gewinner und Verlierer. In Erwartung der Aufwertungen erlebte Deutschland starke Kapitalzuflüsse in den Monaten vor den Aufwertungen. Die damaligen Regierungen ergriffen die gleichen Maßnahmen, die auch heute noch von Staaten angewandt werden, die verzweifelt Währungen auf unrealistischem Niveau zu halten versuchen. Die Devisenmärkte wurden für mehrere Tage geschlossen, Diskontsätze und Mindestreserven erhöht oder gesenkt. Dazu kamen Durchhalteparolen der Politik. Regierungssprecher Conrad Ahlers erklärte 1969 zum Gelächter der anwesenden Journalisten, die D-Mark würde endgültig, eindeutig und ewig nicht aufgewertet. Am Tag nach der Wahl endete diese Ewigkeit und Deutschland gab zeitweise die Wechselkurse frei.6
Trotz der eigentlich festgesetzten Wechselkurse konnte nun der Markt den Wert der D-Mark ermitteln. Als sich der Wert um 3,70 Mark pro Dollar stabilisierte, entschied die Bundesregierung, zu festen Wechselkursen bei 3,66 Mark pro Dollar zurückzukehren. Dies entsprach einer Aufwertung um 9,3 Prozent. Bemerkenswert ist, dass der neue feste Wechselkurs also vom freien Markt bestimmt worden war. Wenn man also den Devisenmarkt braucht, um das jeweilige Niveau der Wechselkurse zu bestimmen, auf dem sie dann festgesetzt werden, dann können Devisenmärkte genauso gut kontinuierlich das Niveau festlegen. So lassen sich die Folgen einer plötzlichen krassen Abwertung mindern.
Am 5. August 1971 war es dann endgültig soweit. Präsident Nixon erklärte, dass der Dollar nicht mehr in Gold gewechselt werden könne. In seiner Rede machte er für diese Entscheidung natürlich nicht das unhaltbare System fester Wechselkurse und Goldkonvertibilität verantwortlich. Er fand andere Schuldige:
In den letzten Wochen haben Spekulanten einen Krieg mit allen Mitteln gegen den Dollar geführt.
Richard M. Nixon, 15. August 1971
Von Defiziten, Inflation, den Tricksereien der französischen Zentralbank oder den grundsätzlichen Problemen fester Wechselkurse sprach er dabei natürlich nicht. Dass die sogenannten Spekulanten letztlich europäische Zentralbanken waren, war Nixon dann doch zu heiß. Trotzdem wussten alle, wovon er sprach.
Nixons Entscheidung wird von Kritikern als der Anfang einer langen Phase von Deregulierung in den angelsächsischen Ländern gesehen, sogar von der Grundwertekommission der SPD. Doch hatte Bretton Woods keineswegs ein Finanzparadies von dauerhafter Stabilität geschaffen, wie es manch einer mit Scheuklappen im Rückblick zu sehen glaubt. Spannungen im System waren vorprogrammiert und wurden durch Abwertungen oder Aufwertungen bereinigt, sobald der Status Quo nicht mehr zu verteidigen war.
Die Rolle der Kosten des Vietnamkriegs beim Zusammenbruch des Systems wird manchmal übertrieben; trotz der hohen Kriegskosten konnten die USA ihren Schuldenstand7 bis 1973 auf ein Rekordtief senken. Weder Deregulierungswut noch Kriegskosten sind also letztlich für das Scheitern des Bretton Woods-Systems verantwortlich. Vielmehr waren es die Spannungen, die sich aus den festen Kursen ergaben und auf die gesamte Wirtschaft auswirken.
Es wird auch gerne vergessen, dass Nixon eigentlich nur ein Nachzügler war. Deutschland und die Niederlande hatte bereits im Mai 1971, also drei Monate vor Nixon, das System von Bretton Woods verlassen und die Mark beziehungsweise Gulden zum freien Handel freigegeben. Also müssten Gegner freier Märkte eigentlich die von ihnen beklagten angelsächsischen Deregulierungen als Made in Germany verteufeln. Noch dazu als von der damaligen SPD-Regierung ausgelöst. Doch eignet sich der damalige Helden-Kanzler Willy Brandt (Mehr Demokratie wagen!) anscheinend nicht als Urheber einer drei Jahrzehnte dauernden neoliberalen Deregulierung – also muss Nixon (rechter Republikaner!) herhalten.
Anfang der 70er Jahre stand die Niedrigzinspolitik der Vereinigten Staaten im Widerspruch zu der von der Bundesbank betriebenen Geldpolitik, die auf Preisstabilität abzielte. Die Inflation stieg 1970 und 1971 jeweils auf knapp 8 Prozent, nicht zuletzt, weil der günstige Wechselkurs der Mark Einkäufe in Deutschland billiger machte. Damit importierte Deutschland die Inflation anderer Staaten und erhielt gleichzeitig mehr und mehr Dollar von den Exporteuren.