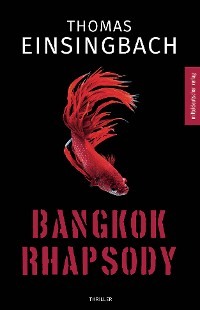Czytaj książkę: «Bangkok Rhapsody»
THOMAS
EINSINGBACH

THRILLER
mitteldeutscher verlag
Inhalt
Cover
Titel
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Ebenfalls im Mitteldeutschen Verlag erschienen
Impressum

PROLOG
Phnom Penh, im April 1978.
„Schachmatt! Ich gratuliere. Der Vorstoß mit dem Springer war mein entscheidender Fehler.“ Der Verlierer, dessen weiße Uniform nicht den kleinsten Makel aufwies, lächelte verlegen. Dann nickte er seinem Adjutanten zu, der sich daraufhin anschickte, ihm Rotwein nachzuschenken. Der Gewinner, der splitternackt auf einem Holzhocker saß, beobachtete wortlos, wie die letzten Strahlen der Abendsonne den Raum durchfluteten und sich mit dem kalten Schein der Neonbeleuchtung zu einem unangenehmen Zwielicht vermischten. Er hatte sein gut gefülltes Weinglas noch nicht einmal angerührt.
Es roch nach verbrannter Haut und menschlichen Ausscheidungen, und die Klimaanlage kämpfte angestrengt gegen die feuchte Hitze, die von draußen in das schlecht isolierte Büro drang.
„Auf Ihr Wohl. Warum trinken Sie nicht? Es ist ein hervorragender Tropfen.“ Der Weißgekleidete hob sein Glas. „Wie wäre es mit einer Revanche?“
Die langen, dürren Beine seines siegreichen Gegners fanden unter dem halbhohen Tisch, auf dem das Schachspiel, die Weingläser und eine Flasche Bordeaux platziert waren, nur schwer Platz. Der Mann hatte in den letzten Wochen enorm an Gewicht verloren und sein entblößter Körper war übersät von notdürftig versorgten, noch nicht ausgeheilten Wunden. Seine strähnigen blonden Haare hingen ihm fettig vor den Augen. Nur unter Aufbietung seiner letzten Kräfte gelang es ihm, Haltung zu bewahren. Niemals würde er mit dem Teufel anstoßen. Im Augenwinkel sah er den jungen Kambodschaner, der in einer Ecke des Raumes kauerte und blutverschmiert wimmerte. Aus einer handtellergroßen Wunde an dessen linker Kopfseite tropfte dunkelrotes Blut in die Urinlache, die sich um ihn herum ausgebreitet hatte.
Vor gut einer Stunde hatten zwei Sergeanten den schmächtigen Asiaten gepackt und ihn an die Rückenlehne eines Schemels gefesselt, die mit scharfkantigen Metalldornen bespickt war, welche sich tief in sein Rückgrat bohrten. Das Verhör wurde in kambodschanischer Sprache geführt und blieb offenbar ohne den gewünschten Erfolg. Auf ein Zeichen des Weißuniformierten hin brannten die Peiniger ihrem Gefangenen immer wieder die Glut ihrer Zigaretten ins Gesicht. Der Gefolterte ertrug die Qualen nahezu lautlos. Erst als sie ihm routiniert die Arme brachen, stieß der zähe Asiate spitze Schmerzensschreie aus. Schließlich schnitten die Schergen ihm das Ohr ab, woraufhin ihr Opfer für einige Zeit das Bewusstsein verlor.
„Sie mögen diesen Mann. Ich sehe es Ihnen an.“ Genüsslich tapezierte der Verlierer der Schachpartie seinen Gaumen mit einem Schluck Wein.
„Ich mache Ihnen einen Vorschlag: Gewinnen Sie die Revanche, lassen wir Ihren Freund frei. Verlieren Sie hingegen …“ Die tiefbraunen Augen des Herausforderers suchten die seines Kontrahenten. „Nun, mein Lieber, ich bin mir sicher, Sie werden verhindern, dass es so weit kommt.“
Der Gewinner der ersten Partie nickte kaum merklich. Sein Mund war staubtrocken, der Schweiß rann ihm von der Stirn in die Augen. Er wusste, dass er verloren war, ganz egal, wie das nächste Spiel auch enden würde. Mit leerem Blick verfolgte er die Sergeanten, die sorgsam die Lage der dünnen Elektrodrähte überprüften, mit denen sein nackter Oberkörper und seine Genitalien umwunden waren.
1
Als sie den Gebetstempel verließen, empfing die beiden Frauen die Wucht der tropischen Schwüle. Hoch über dem Kloster Wat Suwan formierten sich grafitgraue Wolkentürme. Weiter unten verharrte die Atmosphäre noch regungslos und lastete schwer auf der lebenden Kreatur. Gleich würde die Ouvertüre folgen, in der Luftvibrationen die Regungslosigkeit ablösten und sich die Spannung bis zur Unerträglichkeit steigerte. Surang hob den Kopf und schnupperte, wie ein scheues Tier, das Witterung aufgenommen hat. Sie konnte sich nicht erinnern, dass es früher zu dieser Jahreszeit noch so aufdringlich nach Unwetter gerochen hatte. Alles schien durcheinandergeraten zu sein. Ihre Begleiterin blickte ängstlich zu dem Gewittergebirge über den nördlichen Stadtbezirken Bangkoks und ergriff Surangs Hand. „Wir müssen uns beeilen. Es wird gleich schrecklich stürmen und regnen.“
Unzählige Male hatte Surang den Weg vom Kloster zum Altenheim zurückgelegt. Selten unbegleitet, denn auf sich alleine gestellt hatte sie ihre Orientierung vor einer Ewigkeit verloren. Was wusste ihre junge Führerin schon über die wirklichen Gefahren des Lebens? Wortlos folgte sie dem Mädchen durch die staubigen Gassen, dem heranbrausenden Unwetter entgegen.
Gerade noch rechtzeitig schlüpften die Frauen durch das hölzerne Tor in die schützende Empfangshalle des Altenheims, ehe sich der Himmel mit feuchtheißer Explosivität öffnete. Blitze durchschnitten gespenstisch die plötzliche Düsternis. Krachender Donner rollte über den Stadtteil Khlong San. Die Wassermassen klatschten gegen die schmalen Fenster, die zur Soi Charoen Nakorn zeigten. Aus kleinen Rinnsalen wurden auf dem löchrigen Asphalt der belebten Gasse rasende Bäche, die zuerst die Kanalisation überfluteten, um sich dann in teichgroßen Sammelbecken zu vereinen. Ladenbesitzer rafften ihre Auslagen zusammen und brachten sich und die Ware vor dem Regensturm in Sicherheit. Passanten hasteten durchnässt zum nächstgelegenen Unterstand. Andere flüchteten in die einfachen Restaurants des Viertels und gönnten sich eine scharfe Suppe oder etwas Kurzgebratenes.
Durch die zum überdachten Innenhof geöffneten Fenster und Türen drückte der feuchtwarme Dunst ins Gebäudeinnere des Altenheims.
Auf dem Bildschirm des Fernsehgerätes flackerte eine Reklame für Eistee. Surang beobachtete gebannt, wie eine giftgrüne Flüssigkeit perlend in ein Glas strömte, und versuchte dabei vergeblich, den Duft des Getränks zu erhaschen. Endlich setzte sie sich mit überkreuzten Beinen auf den Dielenboden und wandte sich dem Hausaltar zu, in dem eine goldglänzende Buddha-Figur, umgeben von Räucherstäbchen, Blumengirlanden und allerlei Opfergaben, über die Halle wachte. Surang schloss die Augen und begann, ihren Oberkörper im Einklang mit ihrem Herzschlag rhythmisch zu wiegen. Dabei presste sie bei der Vorwärtsbewegung ihre Lippen fest aufeinander, um sie auf dem Rückweg wieder einen schmalen Spalt zu öffnen, so als ob sie zum Sprechen ansetzen wollte. Man ließ die kleingewachsene Frau mit dem gescheitelten, schulterlangen Haar ihre eigenwillige Meditation unbehelligt zelebrieren. Jeder im Heim kannte dieses Ritual, dem sich Surang regelmäßig hingab.
Zwei Helferinnen ließen sich, nicht weit entfernt, ebenfalls auf dem Fußboden nieder. Sie griffen nach den noch nicht ganz fertiggestellten Schiffchen aus den Strünken der Bananenstaude, die sie mit den Heimbewohnern für das Loy-Krathong-Fest bastelten. Geschmückt mit Blumen und brennenden Kerzen wollte man die schwimmenden Gestecke in der Vollmondnacht des zwölften Monats des Lunisolarkalenders, die stets auf das Novemberende fiel, gemeinsam auf dem Chao Phraya zu Wasser lassen und das Ende der Regenzeit feiern. Die Opfergaben würden Mae Khongkhe, die göttliche Mutter des Wassers, gewiss versöhnlich stimmen und die Seelen der Spender von den Verunreinigungen des ausgehenden Jahres befreien.
Ein paar Interessierte gesellten sich zu der kleinen Runde und boten ihre Hilfe an, während die Regenflut unvermindert auf das Gebäude herabstürzte. Wieder zuckte eine elektrische Himmelsentladung grell durch die im Halbdunklen liegende Halle. Unmittelbar darauf folgte ein Donnerschlag, der die Grundmauern des Anwesens zu erschüttern schien. Flehende Blicke wandten sich gen Firmament, in der Hoffnung auf ein Erbarmen der Gewitterdämonen.
Einzig Surang schaukelte unbeirrt im gleichen Takt hin und her, unbeeindruckt vom Tosen der Naturgewalten. Keine der jungen Pflegerinnen kannte die Vergangenheit dieser verschlossenen Frau. Ihre äußere Erscheinung ließ keine verlässliche Schätzung ihres Alters zu. Surangs mädchenhafte, biegsame Figur täuschte eine Art unbekümmerte Jugend vor. Sie schien in einer eigenen Welt zu leben, unnahbar und stumm. Nur der Heimleiter Dr. Bertoli kannte Surangs Geschichte und wusste, dass sie durchaus in der Lage war zu sprechen.
2
Nur mit Mühe gelang es William LaRouche, die Augenlider zu heben. Er hatte wieder einmal miserabel geträumt, war immer wieder aufgeschreckt, hatte Polizeisirenen gehört und dabei Schweißausbrüche bekommen, obwohl sein Apartment zugig und unzureichend beheizt war. Sein müder Blick fiel auf den kahlen Kirschbaum an der Hinterhofmauer, der im nebligen Dunst des frühen Novembertages verschwamm. Ein Schwarm Wildenten strich im Formationsflug über die Dächer der Backsteingebäude Hobokens in Richtung Osten, dem Hudson River entgegen. Williams Blick kehrte in die Ödnis seiner Unterkunft zurück, wo ihn die Unbeflecktheit der weißgekalkten Zimmerdecke fesselte. Seine Hand berührte das durchgeschwitzte Laken, dessen klamme Kälte ihn erschaudern ließ. So musste sich der Tod anfühlen, nachdem sich die lebende Materie zum Abschied ein letztes Mal fiebrig aufgebäumt hatte. Warum blieb er nicht einfach liegen, in stoischer Erduldung des Schlussakkordes des irdischen Daseins und in Erwartung des Unvorstellbaren, was danach kommen würde? Hatte er irgendeinen Grund aufzustehen oder würde ihn nur ein weiterer sinnloser Tag quälen, der sich endlos in die Länge zog und seiner Seele keinerlei Impulse gab?
William drehte sich zur Seite, schob die Beine aus dem Bett und brachte seinen Körper in die Senkrechte. Wenig später saß er ungewaschen, ungekämmt und unschlüssig an seinem den Raum dominierenden Schreibtisch, rührte in einer Tasse mit aufgebrühtem Instantkaffee und erinnerte sich, wie er diese protzige Karikatur der Bürokratie aus einer Firmeninsolvenz für zwanzig Dollar ersteigert hatte. Seit einer halben Minute läutete das Telefon. Er bemühte sich, das lästige Geräusch zu ignorieren. Aber der Anrufer war ausdauernder als er. Nach einer weiteren halben Minute griff William mürrisch zum Hörer.
„LaRouche, Agentur für …“
„Billy, mein Junge! Ich dachte schon, du wärst bereits unterwegs. Du hast bestimmt immer mächtig viel zu tun! Good morning, New York City!“
Es war Doris. Die Stimme seiner Mutter kam ihm aufgekratzt und fremd vor. „Mom?“
Ganz sicher war sie wieder einmal, mit der Bibel in der Hand, in der Nacht durch ihr Puppenhäuschen in Lake View gegeistert und hatte sich den Kopf über ihr einziges Kind zerbrochen, von dessen Leben sie keinen blassen Schimmer hatte.
„Hoboken, Mom. Ich lebe in Hoboken, New Jersey. Nicht in New York“, korrigierte William, obwohl er wusste, dass es keinen Zweck hatte. Doris würde unbeirrt weiterhin in ihrer Nachbarschaft damit prahlen, dass ihr Sohn Direktor einer Agentur in New York City sei.
In den ersten Jahren nach dem Verschwinden von Williams Vater hatte sich Doris mit ihrer täglichen Flasche Wodka getröstet. Wenn sie betrunken war, schien sie weniger verzweifelt zu sein und fühlte sich irgendwie gemütlich an. Ihre Haut war weich und roch nach einer Melange aus Lavendel, Kuchenduft und Alkoholausdünstungen. Als Williams Vater auch nach drei Jahren nicht wiederaufgetaucht war, klammerte sich Doris an die Bibel, flüchtete sich in das Universum des süßen Backvergnügens und stellte beeindruckende Mengen unterschiedlichster Kuchen und Torten für die römisch-katholische Gemeinde von Lake View, einem Stadtteil von New Orleans, her.
„Billy, ist der Apfelkuchen angekommen? Ich habe ihn in eine Spezialfolie eingeschweißt. Er ist doch nicht etwa zerdrückt worden?“
„Nein, Mom, alles bestens. Kam an und hat vorzüglich geschmeckt“, log William und streifte mit seinem Blick den ungeöffneten Karton, den ein Paketbote vor ein paar Tagen gebracht hatte.
„Bei uns in New Orleans ist es noch keine halb sechs, mein Junge. Ich weiß doch, wie gerne du früh aufstehst, einen starken Kaffee trinkst und dich dann in deine Arbeit stürzt. Ich wollte ja nur hören, ob du den Apfelkuchen bekommen hast.“ Doris hatte mittlerweile ihre weinerlich-fordernde Tonart angeschlagen. „Aber du kommst doch Thanksgiving nach Hause?“
Mit Missmut erinnerte sich William an das letzte gemeinsame Thanksgiving in Lake View. Wie gewöhnlich hatte seine Mutter den Tisch festlich für drei Personen eingedeckt. Neben dem dritten, niemals benutzten Gedeck war wie jedes Jahr der Silberrahmen mit dem ewig gleichen, ikonenhaften Foto aufgebaut: Williams Vater im Alter von siebenundzwanzig Jahren auf seinem Segelboot. Der Fotograf hatte einen Moment eingefangen, in dem eine kräftige Meeresbrise die blonden Haarsträhnen mit dem Sternenbanner am Bootsheck um die Wette flattern ließ. William war damals kaum vier Jahre alt gewesen und hatte nur noch eine verschwommene Erinnerung an die kurzen Besuche seines Vaters zu Hause in Lake View.
Es war einfach verdammtes Pech, dass der Mann nicht bei einem Motorradunfall oder an Krebs gestorben war. Ein Leichnam und ein Begräbnis hätten vieles leichter gemacht. William war sich sicher, dass es die Ungewissheit war, die seine Mutter erst zur Flasche und dann, was zweifellos eine gewisse Verbesserung darstellte, zur Bibel hatte greifen lassen. Möglicherweise waren andere Frauen von verschollenen Ehemännern stärker als Doris LaRouche, aber schließlich konnte man sich weder sein Schicksal noch seine Mutter aussuchen. Im Grunde genommen, dachte William, hatte er sogar noch Glück gehabt. Das Schicksal hatte ihm Jonathan geschickt. Ohne den afroamerikanischen ehemaligen Kollegen von Williams Vater wäre manches ganz sicher viel schlechter gelaufen. Er hatte erreicht, dass sich das FBI großzügig zeigte und der vermeintlichen Witwe eine ordentliche Hinterbliebenenpension zugestand, von der sie die Zahnspange ihres Sohnes bezahlen und ihn aufs College schicken konnte. Für den heranwachsenden William war Jonathan damals ein Fels in der Brandung gewesen, wenn seine Mutter wieder einmal unberechenbar zwischen manischer Umtriebigkeit und depressiver Lethargie pendelte. Auf ihn konnte sich der kleine blonde Billy verlassen. Er erinnerte sich noch lebhaft an den traurigen Tag, als Jonathan seinem Jungen, so nannte er William beharrlich, mitteilte, dass er in die FBI-Führung nach Washington berufen worden war und deshalb New Orleans verlassen musste.
Williams Gedanken kehrten in die Gegenwart zurück. Er beendete das Telefonat mit seiner Mutter, erhob sich aus seinem Bürodrehstuhl, schob den Vorhang zur Seite, der die Nische mit der Küchenzeile verdeckte, und brühte sich einen zweiten Instantkaffee auf. William betrachtete sich im Spiegel über dem Spülbecken. Seine Jugend war unwiderruflich dahin. Wie sein Dad wohl mit zweiundvierzig ausgesehen hätte? William fuhr sich über den ungepflegten Mehrtagebart. Viel war nicht geblieben von seiner ehemals athletischen Erscheinung. In den letzten Jahren hatte er fünfundzwanzig Pfund zugenommen und seine blonde Venice-Beach-Mähne hatte sich auf ein dünnes Gestrüpp reduziert, mit dem er notdürftig eine hohe Stirn verdeckte.
William nahm seinen Kaffeebecher und trat auf den Balkon hinaus, der zur Park Avenue zeigte, wo sich der morgendliche Berufsverkehr durch Hobokens Stadtzentrum schob. Er steckte sich eine Lucky Strike an und sog das Nikotin tief in die Lungen. Park Avenue in Hoboken, Downtown! Kein Vergleich mit Manhattans Park Avenue, aber weiß Gott nicht die schlechteste Adresse für einen lausigen Einmannbetrieb, der private Ermittlungen aller Art anbot und dessen teuerste Investition das glänzende Messingschild am Hauseingang gewesen war. Bildfetzen tauchten vor Williams innerem Auge auf: Sein Vater lächelte ihn an. Strahlend weiße Zahnreihen. Saphirblaue Augen. Eine schützende Hand streichelte liebevoll über sein Haupt. William versuchte diese Bilder zu verdrängen. Warum quälte ihn eine fortwährende Sehnsucht nach diesem Mann, den er nie wirklich gekannt hatte, und der vor Jahrzehnten vom Erdboden verschluckt worden war.
3
Ein kalter Nordostwind peitschte durch die Washingtoner Constitution Avenue, auf der an diesem unwirtlichen Morgen die ersten der vielen tausend Angestellten, in dicke Mäntel gehüllt und mit dampfenden Kaffeebechern in den Händen, in die Ministerien des Regierungsviertels strebten.
Die Chefetage des Justizministeriums war, wie üblich, schon seit geraumer Zeit hell erleuchtet. Melinda Rodriguez, die erste Frau in der amerikanischen Geschichte, die den Titel United States Attorney General trug, betrachtete versonnen ihren Kaffeebecher mit dem Amtssiegel und dem Aufdruck „Qui Pro Domina Justitia Sequitur“, was so viel wie „Derjenige, der die Angelegenheiten Justitias erledigt“ heißen sollte. Ein merkwürdiges Motto, dachte sie. In den letzten zwei Jahren hatte Melinda lernen müssen, wie viele Widerstände sich ihrem Kampf für Recht und Gesetz entgegenstellten. Nicht allen ihrer Gegner ging es dabei um sachliche Auseinandersetzungen, vielmehr zielten die Angriffe auf ihre Person. Nicht alle des Washingtoner Establishments konnten sich mit der Tatsache anfreunden, dass mit Melinda Fortuna Rodriguez ein neuer Stern am Firmament der amerikanischen Machtpolitik aufgegangen war.
Sie nippte an dem Getränk. Dünner Behördenkaffee. Eine schreckliche Brühe. In jeder mexikanischen Dorfkneipe gab es bessere Qualität. Melinda erhob sich aus ihrem Chefsessel und betrat ihre private Rückzugsmöglichkeit, ein Bade- und ein Schlafzimmer, die sich hinter einer holzvertäfelten Tür versteckte. Sie schaltete die Beleuchtung über dem Schminktisch ein und entdeckte in ihrer brünetten Löwenmähne ein paar graue Haarbüschel. Ein Termin beim Friseur zum Nachfärben war dringend erforderlich. Mit einem weinroten Lip Stylo frischte sie ihr Lippen-Make-up auf. Anschließend tupfte sie mit einem transparenten Gel ihre getrimmten Augenbrauen ab, die mit ihrer gradlinigen Ausrichtung gut in ihr rundliches lateinamerikanisches Gesicht passten. Melindas Vater war ein mexikanischer Farmarbeiter indianisch-spanischer Abstammung gewesen. Auch seiner Tochter sah man an, dass sie die Gene der Nahua-Indianer, Nachkommen der stolzen Azteken, in sich trug.
Die antike Standuhr in Melindas Amtszimmer zeigte sechs Uhr dreißig, als ihr Büroleiter Jonathan Robson mit einem triumphierenden Lächeln den Raum betrat. In der Hand balancierte er ein Tablett mit zwei Latte macchiato und einer Gebäckauswahl aus dem italienischen Bistro im Erdgeschoss des Justizministeriums.
„Melinda“, strahlte Jonathan, „es gibt erfreuliche Neuigkeiten. Sichere Informationen aus verlässlicher Quelle.“
„Wo ist er diesmal untergetaucht?“ Melinda griff nach einem Pappbecher und einem Brownie.
„Alles deutet darauf hin, dass er sich in Bangkok aufhält.”
„Bangkok? Eine Stecknadel im Heuhaufen dürfte leichter zu finden sein.“
„Sechzehn Millionen Einwohner, davon ein paar zehntausend weiße Ausländer mit dauerhafter Aufenthaltserlaubnis, dazu eine unbekannte Anzahl Illegaler. Nicht einfach, aber auch nicht unmöglich.“
„Seine Tarnung ist immer perfekt. Sein Netzwerk von Unterstützern reicht bis in höchste CIA-Kreise.“
„Das mag stimmen, aber ein professioneller, mit Bangkok vertrauter Exposer und ein wenig Glück …“, gab sich Jonathan zuversichtlich.
„Was schlägst du vor?“
„Wir operieren zunächst inoffiziell. Je weniger Leute von unserem Plan wissen, desto besser. Wir können keinen Agenten aus dem aktiven Dienst einsetzen. Dann werden Vorgesetzte eingebunden, thailändische Behörden erhalten Vorabinformationen …“
„ … und auf wundersame Weise ist das flüchtige Reh wieder verschwunden. Du erinnerst dich an die Beerdigung seiner Mutter in Chicago vor fünf Jahren?“, unterbrach Melinda. Natürlich erinnerte sich Jonathan. Melinda war damals noch Abteilungsleiterin und er selbst gerade aus dem FBI-Dienst ausgeschieden und als Berater ins Justizministerium gewechselt. Sie hatten den Fisch schon an der Angel gehabt. Dann führte eine Indiskretion zur Katastrophe. Die Zielperson schien sich in Luft aufgelöst zu haben und drei FBI-Agenten wurden tot in einem stillgelegten Bergwerk gefunden. Nur mit Mühe und Not konnte verhindert werden, dass diese misslungene Aktion an die Öffentlichkeit drang.
„Ich habe einen Mann im Sinn, der passen könnte. Er ist asienerfahren und der beste Ermittler, den ich kenne. Er riecht seine Klienten, Erfolgsquote nahe einhundert Prozent.“
„Wo viel Licht, da hat’s auch Schatten.“ Melinda blickte Jonathan skeptisch an.
„Ich kenne ihn seit seiner Kindheit und habe lange mit seinem Vater zusammengearbeitet. Der Junge ist besser als sein Dad und war bereits in Thailand im Einsatz. Vor ein paar Jahren hat er aus persönlichen Gründen das FBI verlassen und in New Jersey eine private Ermittlungsagentur eröffnet.“
„Ich hatte nach dem Schatten gefragt“, erinnerte ihn Melinda.
„Schatten?“
Jonathan schob seine grauschwarze Hornbrille auf seiner flachen Nasenwurzel zurecht. „Der Junge ist instinktgesteuert, hoch emotional, aber in jeder Hinsicht loyal. Das garantiere ich.“
„Jonathan, wenn wir inoffiziell und mit einem Freelancer arbeiten, lautet die entscheidende Frage: Ist dein Mann kontrollierbar?“