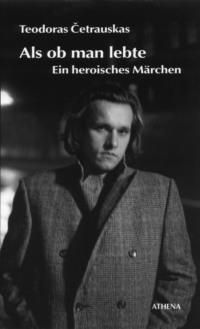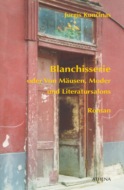Czytaj książkę: «Als ob man lebte»
Teodoras Četrauskas
Als ob man lebte
Ein heroisches Märchen
aus dem Litauischen
von Klaus Berthel
ATHENA
Literatur aus Litauen
Band 5
Die Übersetzung dieses Buches wurde gefördert von »Bücher aus Litauen« mit Mitteln des Ministeriums für Kultur der Republik Litauen.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
E-Book-Ausgabe 2013
Copyright © 2001 by Teodoras Četrauskas
Copyright © der deutschen Ausgabe 2002 by ATHENA-Verlag,
Copyright © der E-Book-Ausgabe 2013 by ATHENA-Verlag,
Mellinghofer Straße 126, 46047 Oberhausen
www.athena-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagfoto: © Mona Filz www.4tunes.de
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN (Print) 978-3-89896-121-9
ISBN (ePUB) 978-3-89896-840-9
1
Juozas lag in einem weißen Krankenhausbett, und es tat weh. Das eine Bein war eingegipst, von einem eindrucksvollen Gewicht in der Schwebe gehalten, auch die Brust zierte ein Gipspanzer, der Kopf war mit einem dicken Verband umwickelt. So glich er eher einem großen Käfer oder einer in ihren Kokon eingesponnenen Seidenraupe als einem Menschen. Einem Menschen, der von einem Auto überfahren wurde. Übrigens nicht einfach einmal überfahren, sondern gleich dreimal: vor, zurück, dann wieder vor. Ein wenig so, wie es dem seligen Pasolini erging. Nur überfuhr man Juozas nicht an einem azurnen Strand, sondern im Wald, im kalten Winter des Jahres 1947, in Tannenbergland, Heimstatt der Kriven und Vaidiluten[1]. Und ein weiterer Unterschied bleibt festzuhalten: Juozas hatte es nicht mit einem Jeep Cherokee zu tun, von einem Schwulen gelenkt, sondern mit einem rumpeligen Lastwagen, einer sogenannten Polutorka, gelenkt von wer weiß wem. Deshalb lag er jetzt hier, und es tat eben höllisch weh, vom Kopf bis hinunter zu den Zehenspitzen, überall dort, wo das Ungetüm hängen geblieben war, und dazu gehörten nicht wenige Körperstellen. Man hatte ihn ja nicht zufällig überrollt, sondern in voller Absicht. Diese Fahrkünste ähnelten nur allzu sehr den gleichfalls in Mode gekommenen Fangschüssen in den Hinterkopf. Kein Zweifel, man hatte ihn aus dem Leben befördern wollen, wollte nicht, dass er weiter auf dieser geliebten, aber auch verabscheuten Welt herumspazierte. Das verstand Juozas. Dennoch verspürte er keine übermäßige Traurigkeit. Sie haben das ihre getan, dachte er, aber du hast sie trotzdem hinters Licht geführt, hast sie geleimt, verarscht. Das war es vor allem, was Juozas beschäftigte. Früher, als er noch nicht überfahren worden war, hatte er gern in Synonymen gedacht, auch jetzt konnte er nicht davon lassen, umso mehr, als der Schmerz ein wenig nachgelassen hatte und ihn eine seltsame Ruhe überkam. Natürlich ahnte er, was das bedeutete. »Wenn es einem Menschen vom Kopf bis hinunter zum Bauch weh tut, dann geht es zu Ende mit ihm«, das war wie aus weiter Ferne die Stimme Rosalias, der Großmutter seiner Frau Judita. Sie belehrte gerade seinen Sohn Aurelius, der schon halbwegs erwachsen schien, in die dritte oder vierte Klasse ging und nicht mehr ein zweieinhalbjähriger Bengel war. Rosalia saß mit ihm auf der Ofenbank in Juditas elterlichem Haus, dort, wo man ihm geradezu feindselig begegnet war, als er um ihre Hand angehalten hatte. Eigentlich sind diese Proleten kein bisschen klassenbewusst, dachte Juozas. Und wenn, dann allenfalls diejenigen, die nichts als eben Proletarier sein wollen und das auch ihren Kindern und Enkeln wünschen. Aber gibt es solche? Seine Schwiegereltern hatten jedenfalls nicht zu denen gehört, sie ließen ihrer ältesten Tochter eine gewisse Ausbildung zukommen, dafür erhofften sie sich für sie einen Prinzen, und der kommt gewöhnlich auf einem weißen Schimmel daher, nicht wie er, Sohn eines armen Stadtschneiders, mit einem Raddampfer.
Das war für Juditas Eltern eine absolute Katastrophe, erinnerte sich Juozas, das Ende aller Hoffnungen, Bankrott, Fiasko, Weltuntergang. Dabei war es gerade Juditas Vater gewesen, ein asthmageplagter Holzfäller, der so gern an Demonstrationen teilgenommen hatte, mit Spruchbändern und Losungen, die das ruhmreiche Proletariat verherrlichten. Ein fundamentaler Widerspruch. Juozas rang sich sogar ein Lächeln ab über seinen Schwiegervater. Und eben daran, so schlussfolgerte er, sind die Bratoks[2] letztendlich gescheitert. Weil nämlich sämtliche Proletarier für ihre Töchter etwas Besseres wollten, mindestens den Sohn eines Landvermessers. Schon wunderte sich Juozas über seine sonderbar prophetischen Gedankengänge, den welthistorischen Niedergang der Bratoks betreffend, und das zu einer Zeit, als die gerade in Höchstform waren, einen Krieg gewonnen hatten und einen halben Erdteil dazu. Früher war er oft wütend gewesen auf seinen Schwiegervater. Aber jetzt war das alles gleichgültig, denn es sah wirklich nach Schluss, Ende, Finis aus. Die Symptome waren unmissverständlich. Ein beinahe schmerzfreier Zustand, und das ohne Morphium, selbst ein Hang zur Selbstbeobachtung und zu leichter Ironie ließ sich konstatieren. Aber merkwürdigerweise waren da keine Bilder, ausgenommen das von der Großmutter seiner Frau und dem Sohn, der ein gutes Stück gewachsen war. Im Finis-Falle werden doch dem Moribundus fortwährend Bilder präsentiert, der Film des Lebens spult noch einmal ab, ein kurzer Augenblick für andere, wie man weiß, aber lang genug für einen selbst. Es folgt der berühmte Korridor mit dem Licht am Ende, erst dann scheint wirklich Sense zu sein, denn es weiß keiner, ob und wie es noch weitergeht. Vielleicht, ungewollt, die Rückkehr ins Leben, gerufen von irgendwem. Oder der Arzt verpasst einem eine Ohrfeige: »Dass du mir ja nicht abkratzt und die Statistik ruinierst, verstanden!« Auf jeden Fall geschah nichts von dem, was er früher gehört hatte, was andere erzählten oder die Literatur verkündete, und gerade dieses Thema galt doch, nebst der Liebe und dem Wein, als eines ihrer wichtigsten und fundamentalsten. Vielleicht, dachte Juozas, haben uns diese Zeilenschinder alle etwas vorgemacht? Oder dieser Prozess verläuft allzu individuell? Oder nehme ich an etwas ganz anderem teil, aber woran? Da war doch diese Polutorka, der Schmerz, die Großmutter, der Sohn aus der Zukunft, ein relativ schmerzfreies und klares Gedanken-Intermezzo. Und was ist das jetzt, träume ich? Wenn ja, dann habe ich wohl die ganze Zeit nur geträumt. Das wäre eine weitere Variante. Vielleicht existiert in Wirklichkeit gar nichts, es gibt nicht mal dich selbst. Und alles ist nur ein von irgendjemandem für dich arrangierter Film. Man glaubt darin mitzuspielen, obwohl man, wie in einem Kaleidoskop, nur Bilder vorgesetzt bekommt und dennoch alles fühlt. Fast so, als ob man lebte.
Das konnte Juozas gerade noch denken, als er das nächste Bild erblickte. Es war der Friedhof seines Heimatdorfes, daneben, unten am Flussufer, eine windschiefe hölzerne Kapelle. Die Uferböschung neigte sich kaum merklich zur Seite des Beobachters hin. Sie schien etwa zweihundert Meter vom letzten Haus des Ortes entfernt, den eine asphaltierte Straße durchzog. Asphalt? Staunend blickte sich Juozas um. Eine asphaltierte Straße, so etwas kannte er nur vom Hörensagen. Aber jetzt sah er, es war Asphalt. Auch hatte es in diesem Ortsteil nie eine Straße gegeben. Sehr merkwürdig, dachte Juozas und setzte seine Erkundung fort. Sonst schien alles wie immer: die Häuser, die Kirche auf der anderen Straßenseite, ihr gegenüber das elterliche Haus. Letzteres war nicht zu sehen, doch Juozas wusste, dass es sich dort befinden musste. Allerdings, in einiger Entfernung von der Kirche war der Ort in die Breite gewachsen, ebenso der Friedhof. Der war viel größer als zu der Zeit, als er ihn zum letzten Mal gesehen hatte, bei der Beerdigung eines Nachbarn war das gewesen, eines gewöhnlichen, an einem Herzschlag verstorbenen alten Mannes. Dessen Grab musste hier sein, genau an der Stelle, wo er sich jetzt befand, gegenüber dem Eingang zur Kapelle, acht oder neun Meter davor. Ein Bob-Beaman-Sprung, dachte Juozas und stutzte zugleich. Wer war dieser Beaman? Und woher dieser Sohn aus der Zukunft, dieser Asphalt und all das? Was hatte das zu bedeuten? In diesem Moment erblickte er eine Grabinschrift, dort, wo seiner Meinung nach der Nachbar hätte liegen müssen, der mit dem Herzanfall. »Juozas K. 1920–1947«. Außerdem befanden sich auf dem Stein noch zwei Inschriften: »Kazimieras K. 1894–1958« und »Gabriele K. 1896–1961«. Nachdem er seine Lebensdaten und die seiner Eltern gelesen hatte, lächelte Juozas verstehend.
Mit diesem Lächeln auf den Lippen fanden ihn am Morgen die Krankenschwester, der Arzt, seine Frau und all die anderen, die sich aus familiären Gründen oder von Berufs wegen für eine in ihren Kokon eingesponnene Seidenraupe bzw. für ein dreimal von einer Polutorka überrolltes menschenähnliches Wesen zu interessieren haben.
So lächeln diejenigen, die nach einer Erleuchtung während eines schmerzfreien Intermezzos die Augen schließen, ungestört von den Hinterbliebenen, die ihr Bedauern durch Weinen, Händehalten und auf andere Weise zu zeigen versuchen, wissend, so wie es auch Juozas wusste, dass er damit ein paar Leute enttäuschte, die ihm weit größere Qualen zugedacht hatten, sich nun aber mit dem Überfahrenwerden durch die Polutorka begnügen mussten.
Juozas waren diese irdischen Intrigen und Kabalen gleichgültig geworden, er war schon woanders und ein anderer. Was gingen ihn die Mühen an, die seiner Familie künftig vielleicht von Nutzen sein konnten. Dieser Tochter eines asthmageplagten Holzfällers, der auf den Ruhm seiner proletarischen Kaste bedacht war, ihn aber als Sohn eines armen Schneiders nicht anerkennen wollte. Dem zweieinhalbjährigen Bengel, dem er das Lied »Wir, zwei Brüderchen« beigebracht hatte. Der bereits am zweiten Tag seines Erdenlebens die Bratoks aus dem Haus vertrieben hatte, als die sich über Judita hermachen wollten und zugleich auch noch über die vor den Ariern gerettete Krummnasige. Dafür war er von General Teufel mit dessen Taufpatenschaft beschenkt worden, eine außergewöhnliche Ehre, die der auf diese Weise Beschenkte jedoch überhaupt nicht zu würdigen wusste, eher für einen unerlaubten Luxus hielt und, nachdem er begonnen hatte, seine Nuckel durchzubeißen, in Opposition gegangen war zu allem und jedem. Der noch gar nicht das Licht der Welt erblickt hätte, im Mutterleib geblieben wäre, als sie vor drei Jahren davongelaufen waren, Fersengeld gegeben hatten vor den Bratoks, die zwar das Proletariat liebten, aber diejenigen, die nicht mehr Proletarier waren, gnadenlos aufs Eis setzten, wenn sie das Schiff bestiegen hätten, das unterwegs war ins Land der Arier, das die Bratoks, kaum dass es ausgelaufen war, sehr kunstvoll bombardierten, den Schiffsbauch nach oben kehrten, um alle, die ins Land der Arier gelangen wollten, zu ertrinken, unterzugehen, abzusaufen zwangen. Anwärter auf den Status künftiger Displaced Persons (DPs), Tellerwäscher, Nostalgiker, Seereiniger und andere Exil-Existenzformen krivisch-vaidilutisch-tannenbergländischer Menschen. Die Bratoks scherten sich um keine Rotkreuzflagge oder sie waren wütend, dass sie nicht ganz rot war.
Mit einem Wort, die, die raus wollten, samt Kommando und Bewachung, wurden auf Grund geschickt, während er und Judita, in deren Bauch schon der Bengel strampelte, am Ufer standen und alles mit ansehen mussten. Judita wollte in das nächste Schiff steigen, das, so meinte sie, würden sie sicher nicht mit Bomben belegen, aber Juozas reichte, was er gesehen hatte. Vielleicht hatten die Bratoks keine Ahnung von der Wahrscheinlichkeitstheorie, die sie wohl als bürgerlich, jedenfalls als nichtproletarisch verachteten, die Kunst des Schiffeversenkens, soviel stand fest, beherrschten sie jedoch hervorragend. Und so waren sie gezwungen, dorthin zurückzukehren, wo sie beide schon gearbeitet hatten, er als Schuldirektor, sie als Lehrerin, wo dann der Bengel das Licht der Welt erblickte, ohne im Mutterleib, in der vielleicht noch nicht salzhaltigen See, abgesoffen zu sein, ohne die Fische gefüttert zu haben, ohne – wie bei jenem Ex-Danziger – die sich an verschiedenem leblosen Fleisch labenden und zwischen Gerippen sich tummelnden Aale zu beglücken.
Sie richteten sich aufs Neue ein in dem Dorf, das ihnen nach Ende des Seminars zugewiesen worden war. Beide waren sie genau bei Kriegsbeginn oder wie es so schön heißt, am Vorabend desselben mit dem Studium fertig geworden. Nach dem Abschlussball, auf dem man gebührend feierte, konnten sie keinen Schlaf finden und verschiedenes Geflackere am Himmel hielten sie für ein Zeichen des Allmächtigen, für einen Fingerzeig Gottes, einen glücklichen natürlich. Aber sehr enttäuscht waren sie nicht, als sich am Morgen herausstellte, dass dieses Geflackere nicht Gottes Zeichen oder Fingerzeig war, sondern der Krieg, detonierende Bomben und Granaten, herumschwirrende Kugeln und Geschosssplitter. Das war kein irgendwie abstraktes Gotteszeichen, sondern eines, das anzeigte, dass die Bratoks abzogen, sich aus dem Staub machten, Fersengeld gaben, nachdem der arische Führer wortbrüchig ihren Staat angegriffen und nun auch ins Land der Kriven und Vaidiluten seinen Fuß gesetzt hatte. Ein Land, das die Bratoks sich erst unlängst mit Wissen des arischen Führers einverleibt hatten, infolge eines von beiden Außenministern unterschriebenen Vertrags, der den Bratoks erlaubte, einzumarschieren, ohne dass ein Schuss fiel, und umgehend mit der Umerziehung der Einheimischen zu beginnen. Um schon bald darauf gebeten zu werden, dass man das Land in den Verband der brüderlichen Länder aufnehme, um diesem, wie ein Vertreter aus Tannenbergland sich ausdrückte, die Sonne ihres Führers zu bringen.
Und die Bratoks kamen, zu Fuß und auf Rädern, mit rumpelnden und klapprigen Polutorkas, mit qualmenden Tanks, mit struppigen Pferden, deren Zaumzeug mit Stricken zusammengeknotet war, mit durchschwitzten Militärblusen, ein martialischer und zugleich erbarmenswerter Anblick, gleichgültig überdies gegenüber jeglichem Putz und Flitter, was ihnen bei den gut genährten und gekleideten Einheimischen ein geringschätziges Lächeln einbrachte. Als wüssten sie schon im Voraus, dass deren hohe Militärs sich bald im Theater mit ihren Frauen in Unterröcken, die diese für Abendkleider gehalten hatten, präsentieren würden. Diese Parade versetzte die eigenen Militärs in Wut, die schmucke Uniformen, Ordensspangen und Schützenschnüre liebten, aber, als es ernst wurde, auf höheren Befehl hin nicht einen einzigen Schuss in Richtung der Bratoks abgegeben hatten.
Die Bratoks weckten diese oder jene Hoffnung bei den Bauern, die billiges Eisengerät begehrten, erfreuten einen gewissen Teil der Tannenbergland-Bewohner, die meinten, sie hätten nun Glück, und die nun diese Freude laut und öffentlich zum Ausdruck brachten. Denn die Bratoks waren ihnen viel besser gesinnt als die Arier, die diesen Bevölkerungsteil aufgrund bestimmter anthropologischer Standards in den von ihnen einverleibten Ländern industriell vernichteten. Deshalb war diesem Teil der Bevölkerung die Ankunft der Bratoks lieber als die der Arier, würden doch die Bratoks angeblich nur den Teil, der sich bereichert hatte, unterdrücken, jenen aber, der nicht reich war, nicht anrühren. Deshalb freuten sie sich, denn die mögliche Unterdrückung nur eines Teils war schließlich besser, als alle Teile hinter Stacheldraht zu bringen, zu liquidieren, in Rauch aufgehen zu lassen, unter den Rasen zu bringen.
So waren theoretisch die Bratoks die Unterdrücker nur eines Bevölkerungsteils, während sich vor den Ariern alle zu fürchten hatten, denn diese erkannten nur sich selbst an, die anderen beurteilten sie nach einer von ihnen erdachten Voll- bzw. Minderwertigkeitstabelle. Den Bewohnern dieses Landes kam darin kein sehr ehrenwerter Platz zu – vielleicht war das die Rache für die wirklichen krivisch-vaidilutischen Von-Meer-zu-Meer-Zeiten[3], denn hinsichtlich Blondheit, Blauäugigkeit und Langköpfigkeit waren die Einheimischen dem arischen Ideal nicht fern und überboten es manchmal sogar.
So hatte der überwiegende Teil der Bevölkerung aus dem Tannenbergland der Kriven und Vaidiluten, selbst die Blonden, Blauäugigen, Langköpfigen unter ihnen, gar nicht zu reden von den Dunkelhaarigen, Krummnasigen und Braunäugigen, theoretisch von den Ariern nichts zu hoffen, und so gesehen waren die Bratoks vielleicht doch besser.
Aber in der Zeit vor der Ankunft der Arier hatten die Ankömmlinge, die ihre Neue Ordnung einführten, so viel Schlimmes angerichtet, dass, als die Arier sich der Grenze näherten und bald darauf ihr Feuerwerk losließen, die Schüler es irrtümlich für einen Fingerzeig Gottes gehalten hatten. Die trügerische Güte der Bratoks war längst vergessen, sie wurden hinausgejagt aus dem Tannenbergland der Kriven und Vaidiluten, innerhalb weniger Tage, fast allein von örtlichen Einwohnern mit weißen Armbinden, denjenigen, die sie zuvor, ohne einen Schuss abzugeben, hereingelassen hatten und die ihnen nun enthusiastisch, mit allem, was sie gerade zur Hand hatten, hinterher ballerten. Als wollten sie sich dafür entschuldigen, zuvor absolut keinen Schuss abgegeben zu haben.
Gründe dafür gab es genug. Die Bratoks hatten jene, die besonders frech grinsten, ans Eismeer verfrachtet, zum Fischfang zusammen mit den weißen Bären, sie hatten den arroganten Militärs deren Platz gezeigt, hatten sich nicht um billiges Eisengerät für die Bauern gekümmert, ihnen aber dafür den ausländischen Markt verschlossen, obendrein erhoben sie Pflichtabgaben, um den Bedürfnissen anderer Bewohner ihres Landes gerecht zu werden. Die eingesessenen Bauern hatten sich, so schien es, ein wenig geirrt, denn nach der Neuen Ordnung der Bratoks waren sie zuerst einmal auf gleiches Niveau zu bringen mit den vorerst bescheidener lebenden Menschen im Osten, und erst danach war ein allen gemeinsames Wohlergehen geplant. Diejenigen, die das nicht verstanden, politisch also nicht ausreichend gebildet waren, reisten ebenfalls in ihr kaltes Land zur Umerziehung, genauso wie auch die von den Ariern gehassten Braunäugigen. Aber die hatten auch nichts anderes erwartet.
So wurden also die ohne einen Schuss empfangenen Bratoks mit vielen Schüssen hinausbegleitet, mit Zustimmung eines überwiegenden Teils der Bewohner. Es trauerte wahrscheinlich nur der von den Ariern nicht geliebte Teil, von dem einige Vertreter sofort, noch vor der Ankunft der Arier, in eine Garage gepfercht und getötet wurden. Offenbar als Rache dafür, dass sie sich seinerzeit über die Ankunft der Bratoks gefreut hatten. Das können sie bis heute dem Großteil der Tannenbergland-Bewohner nicht verzeihen.
Damals erschienen die theoretisch schlimmeren Arier dem größeren Teil der Einheimischen als nicht sehr schlimm. Sie sollten sich erst später in ihrer ganzen Scheußlichkeit zeigen, nachdem sie mit den Bratoks aufgeräumt hatten, die sie anfangs ziemlich erfolgreich bis vor die Tore ihrer Hauptstadt gejagt hatten, um dann, als die Bratoks sich erholten und zum Gegenschlag ansetzten, selbst langsam den Rückzug anzutreten. In diesen Zeiten des Hin und Her, des Vordringens und Zurückweichens, spürten die Tannenbergland-Menschen, wie man so schön sagt, den Stiefel der Okkupanten. Doch nach dem Stiefel der Bratoks war der ziemlich erträglich, besonders für Juozas und Judita, junge Lehrer, die dazu neigten, vaterländische Hymnen zu singen, ein Vergehen, für das die Bratoks einen umgehend nach Norden zur Abkühlung schickten.
Sie lebten ruhig in dem Dorf ihrer ersten Bestimmung in diesen drei Arierjahren, zwar nicht wie die Maden im Speck, aber ohne Hunger zu leiden, indem sie die Dorfjugend und dazu noch die eines Waisenhauses lehrten, was diese in ihrer Zukunft benötigte. Aber in welcher Zukunft? In einer von den Ariern beherrschten, wieder von den Bratoks besetzten, zum Wohle eines abermals unabhängigen Tannenberglandes der Kriven und Vaidiluten? Nein, so weit dachten sie nicht, und wenn sie es dachten, dann sagten sie es nicht. Oder sie dachten unbewusst, das heißt, ohne es selbst zu begreifen, aber sie taten so, als ob sie es begriffen. Und sie sprachen und dachten sehr einfach. Juozas zum Beispiel freute sich jeden Morgen, wenn er aufwachte, dass er sein Brot nicht mit Ackern und Pflügen verdienen musste, im Frühjahr und im Herbst Heu, Getreide, Grummet mähen, Heu, Getreide, Grummet in den Stall fahren, Getreide, Erbsen, Bohnen, Flachs dreschen, täglich dreimal Schweine, Kühe, Schafe, Pferde füttern, überall ausmisten, Kühe, Ziegen und andere Milch gebende Tiere melken, Butter schlagen, um daraus Quark, Käse und Rahm herzustellen, zwei, dreimal in einer Saison pflügen, jäten und eggen, im Frühjahr pflanzen und im Herbst die Ernte einbringen, sie den Winter über umsortieren und zittern, dass sie nicht fault. Da gab es landwirtschaftliches Gerät zu reparieren, aus Hanf Seile zu flechten, Brennholz zu transportieren, um sich dann abermals den Frühjahrsarbeiten zu widmen. So wie das die meisten Menschen seiner Umgebung taten, unter ihnen auch sein Vater, der vom Hosennähen und der Anfertigung von Loden- und Lammfelljacken allein nicht leben konnte und zusätzlich noch sechs Hektar Land bearbeitete. Gar nicht zu reden von Juditas Vater, der seinen Lebensunterhalt mit dem Fällen von Bäumen verdiente, was ewiges Sägen und Axtschwingen bedeutete, Wegrennen vor Tannen und Fichten, die nach Lust und Laune umfielen, die entästet und zersägt werden, auf einer Kleinbahn gestapelt und transportiert werden mussten, hinunter zum Vater der Flüsse[4], wo man sie zu Flößen zusammenband und auf dem Wasserweg beförderte.
Juozas freute sich, dass er all das nicht zu tun brauchte, dass er sich ernähren und anständig kleiden konnte und ein Dach über dem Kopf hatte. Dass er Stundenpläne zusammenstellte, bei seinen Kollegen hospitierte, selbst Biologie und Erdkunde unterrichtete und nach dem Unterricht Hefte korrigierte, das hieß vergleichsweise unabhängig zu sein vom Zustand der eigenen Muskeln und den Launen der Natur. Anders ausgedrückt: Er erfreute sich der Vorzüge der, wie es damals hieß, »Ersten Generation nach dem Pflug«, und er verkündete es gleichsam mit seinem ganzen Sein: »Seht mich an. Ich habe mich gehörig angestrengt und brauche jetzt nicht zu schwitzen und im Mist, im Dreck zu waten. Ich laufe herum mit blitzblanken Lederstiefeln, im Anzug und mit Schlips, jeden Tag mit einem sauberen Hemd und ich benutze Rasierwasser. Die Stiefel putze ich täglich, nicht, wie andere Dorfbewohner, nur an Sonn- und Feiertagen. Ich bin einer von den ersten Leuten im Ort und spiele Patience mit dem Priester. Und meine Frau, seht sie euch nur an. Ich habe die schönste Frau aus dem Dorf und der ganzen Umgebung geheiratet, das tollste Mädchen im Seminar. Die ist mir zugefallen. Und zwar deshalb, weil ich... ja, weshalb eigentlich? Deshalb, weil ich unbedingt der sein wollte, der ich jetzt bin.«
Er war gleichsam eine lebende Reklame für den Nutzen der Wissenschaft. Eine stumme Reklame, denn wenn etwas war, dann zuckte er nur mit den Schultern, als wollte er sagen: »Seht mich an und tut, was zu tun ist, wenn euch das Resultat gefällt.«
War Juozas wirklich völlig zufrieden? Ja, wenn wir von seiner Arbeit und seiner gesellschaftlichen Stellung reden, denn vorerst gab ihm weder das eine noch das andere Anlass sich zu ärgern. Er verstand sehr gut, was ihm erspart geblieben war. Sapientis sat. Es gab Dinge, die musste man nicht erst ausprobieren, nur um zu sagen: »Das liegt mir nicht, ich will das nicht!« Um zu wissen, was er nicht wollte, reichte es ihm zu sehen, wie physische Arbeit leistende Menschen sich abmühten, und dazu noch die Arbeit während der Ferien auf dem Hof seiner Eltern. Mit anderen Worten, er mochte den Pflug nicht, der zum Symbol seines Volkes geworden war, er wollte, dass etwas anderes, ein Zirkel etwa, eine Lyra oder ein Buch für ihn Symbolwert hatten. Ein Volk konnte doch nicht ewig nur pflügen. Und er sah sich von seinen Eltern unterstützt, die ihn etwas lernen ließen. Seine Schwestern waren stolz auf ihn, die Mädchen im Dorf ihm geneigt, allenfalls die Burschen mochten ihn nicht, aber auch die hätten gern mit ihm getauscht.
Er war zufrieden mit seiner Familie, seiner Heirat mit Judita, jenem anfangs prächtigsten Mädchen im Seminar, mit madonnenhaftem Gesicht und langem, schwarzem Zopf, später der schönsten Frau weit und breit, Lehrerin in der von ihm geleiteten Schule, die der Jugend des Dorfes die Kunst des Schreibens und Rechnens beibrachte, Tochter eines Holzfällers. Und offenbar mit einem guten Viertel besseren oder sogar blauen Blutes, denn die Frau des Holzfällers war die uneheliche Tochter einer gräflichen Bediensteten – der Grafensohn wurde, bevor die Frau des Holzfällers geboren wurde, nach London geschickt, von wo er nicht zurückkehrte, die sitzen gelassene Schwiegermutter des Holzfällers bekam in der Nachbarschaft des Gutes ein Häuschen zugesprochen, mit einem schönen Blick auf den majestätisch dahinfließenden Vater der Flüsse. Dieses etwaige Viertel besonders kostbaren Blutes hatte Judita, möglicherweise, zu der gemacht, die sie war, zu der ersten unter den Mädchen des Seminars und auch der Damen ihrer Umgebung, obwohl sie sich, was ihre offizielle Herkunft betraf, nicht im Entferntesten mit denen messen konnte. Und Juozas wusste das zu schätzen. Obwohl er kaum Erfahrungen hatte, begriff er den Unterschied zu dem, was er das eine oder andere Mal auf dem Heuboden seines Heimatdorfes erlebt hatte.
Auch Juozas und Judita taten in den düsteren Jahren der arischen Okkupation das, was junge Menschen interessiert, die sich aneinander erfreuen. Sie entdeckten ihr persönliches Kamasutra, machten die Sache schnell, dann wieder absichtlich langsam, nicht nur Gesicht zu Gesicht, sondern auch gänzlich anders, ohne zu wissen, ob das nun gut sei oder nicht. Und natürlich wagte nicht einer den Priester zu fragen, der, wie gesagt, mit Juozas Patience spielte und gern zu ihnen zu Besuch kam, aber kaum in der Lage gewesen wäre, etwas Ernstes zu dieser Frage beizusteuern, verstehen doch katholische Priester wenig davon, erkennen es nur als Mittel der Fortpflanzung an und nicht als Vergnügen... Außerdem war er nicht irgendein Weltweiser, sondern nur, wie Juozas, eine lebende Reklame für seinen Berufsstand.
War Juozas’ und Juditas Liebe ohne jeden Schatten, einfach nur heiß, rein, schamlos, unversiegbar, schön und treu? Wenn wir davon absehen, dass Judita Juozas zuweilen mit ihren Fingernägeln Brust, Rücken und Gesicht zerkratzte, weil sie ihm die paar Abenteuer in der heimatlichen Scheune nicht verzeihen konnte. Dass sie ihn nicht gern allein dort hinließ, wo es passiert war, als hätte Juozas nicht begriffen, dass er nicht diese Damen brauchte, sondern jemanden wie Judita. Als wären diese ersten Damen nicht selbst schon verheiratet und Juozas und die eigenen Jugendsünden im Heu nicht längst vergessen. Juditas kompliziert gemischtes Blut geriet mitunter in Wallung, wenn sie sich an das dumme Bekenntnis erinnerte, gedacht zur Beruhigung, dass alles gut werde, dass er ja die Sache schon versucht habe und etwas davon verstehe, und es bei ihnen klappen würde. Dann beharkte Judita, sobald sie sich wieder an dieses Bekenntnis erinnerte, Juozas die Brust, den Rücken und das Gesicht, aber das war später ihrer Liebe nur von Nutzen. So kann man sagen, dass ihre Liebe in den Zeiten der arischen Okkupation und der Rückkehr der Bratoks heiß, rein, schamlos, beständig, schön und treu war. Bis zu dem Tag, an dem man Juozas dreimal mit der Polutorka überfuhr.
Wäre es eine Jahrhundertliebe, eine Jahrtausendliebe geworden – wer kann das sagen? So wurde Juozas’ und Juditas Liebe nur eine Siebenjahresliebe mit eigenem Kamasutra, mit ihren Entdeckungen und mit Blut, dem Salz ihrer heißen Leidenschaft. Man kann nur vermuten, dass sie ziemlich lange gedauert hätte, vielleicht bis zum Lebensende des einen oder anderen, und man hätte von dem Bengel, den Judita gebar, Kinder, Enkel und selbst Urenkel erwarten können. Über diesen Zeitraum hinweg hätte alles passieren können. Zum Beispiel hätte Judita ihr kompliziertes Blut nicht mehr im Zaum halten und irgendeine entscheidende Dummheit begehen können, und dann wäre Juozas... Doch das ist schon der Bereich der Möglichkeiten, Vermutungen, Variationen –nur glaubwürdig, wenn wir uns an lange Liebesgeschichten erinnern, zu Papier gebracht oder uns anderweitig bekannt, bei denen man am Ende nicht weiß, ob es sich für die Partner überhaupt gelohnt hat, sich in diesem Tal der Tränen zu treffen, ob ihr Leben in solcher Nähe nicht ein einziges 25, 30, 50 Jahre dauerndes Elend gewesen sei, und wozu das überhaupt alles gut war. Aber die abgebrochene Liebe der beiden finden wir bedauerlich, wie jede von irgendjemandem brutal unterbrochene Leidenschaft, die vielleicht hätte ein anderes Beispiel geben können.
So beklagte sich Juozas im Allgemeinen nicht über seine gesellschaftliche Stellung und seine Familie, er war dem Dorf eine wandelnde Reklame für den Nutzen der Wissenschaft und vielleicht auch für ein glückliches Familienleben in den dennoch düsteren Jahren der Okkupation der Arier und des Kriegs mit den Bratoks. Immerhin, die Arier forderten von ihm als Lehrer keinerlei Tribut, beriefen ihn nicht in ihre Armee, befahlen ihm nicht, gegen die Bratoks oder an irgendeiner anderen Front zu kämpfen, zahlten ihm sogar ein bescheidenes Gehalt, und ließen sich selbst gar nicht blicken in dem Dorf mit den dutzend Häusern. Aber gefielen deshalb Juozas die Arier und deren Herrschaft?
Juozas gefiel es, der erste in seiner Verwandtschaft zu sein, der sein Brot nicht mit körperlicher Arbeit verdiente und der, während irgendwo weit weg der Krieg wütete, mit Judita zu leben, der ersten Dame aus dem Dorf und der Umgebung. Und vorerst gefiel ihm keine Macht und Herrschaft – weder die eigene, die ihm in den Ohren gelegen hatte mit ihrem Patriotismus, mit Reden über die Pflicht gegenüber Tannenbergland, über die Burg Pilenai und die Selbstopferung ihrer Verteidiger im Kampf gegen die Ordensritter[5], über die tapferen Flieger Darius und Girenas[6], über die Kriven und Vaidiluten. Die arrogant war und unzugänglich, nur um dann, als die Bratoks kamen, umgehend Fersengeld zu geben. Auch nicht die global gleichmacherische Herrschaft der Bratoks, die alles dermaßen auf den Kopf gestellt hatten, dass Juozas nicht enttäuscht war, als sich herausgestellt hatte, dass das Geflacker in der Nacht ihres Studienabschlussfestes kein Zeichen Gottes war, sondern das Herannahen der Arier ankündigte. Auch nicht die rassistisch programmierte Herrschaft der Arier, die ihm vorläufig nichts getan, aber schon gezeigt hatte, wozu sie fähig war, indem sie diejenigen fabrikmäßig vernichtete, die es in ihren Augen verdient hatten, vernichtet zu werden. Nichts Gutes erwartete er auch von jeglicher Nachkriegsordnung (der Krieg würde ja irgendwann zu Ende sein). Wie wird sie sein: arisch, bratokisch, abermals völkisch oder irgendwie kombiniert?
Darmowy fragment się skończył.