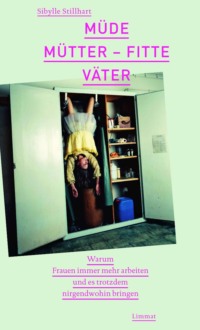Czytaj książkę: «Müde Mütter - fitte Väter»

Sibylle Stillhart, geboren 1973, arbeitete als Journalistin und Redaktorin für diverse Zeitungen und Zeitschriften sowie als Pressesprecherin in der Bundesverwaltung. Sie ist verheiratet, hat zwei Söhne und schreibt heute als freischaffende Journalistin und Autorin.
Sibylle Stillhart
Müde Mütter – fitte Väter
Warum Frauen immer mehr arbeiten und es trotzdem nirgendwohin bringen
Mit Gesprächen mit Barbara Hochstrasser, Remo Largo,
Roland A. Müller und Mariam Tazi-Preve
Limmat Verlag
Zürich
Prolog
Das Kind ist da
Mein Leben als berufstätige Mutter
Das bisschen Haushalt
Auf der Suche nach gleichberechtigten Paaren
Männer mit Babys
Auf der Suche nach den «neuen Vätern»
«Väter machen vom Vaterschaftsurlaub nur wenig Gebrauch»
Ein Gespräch mit Mariam Tazi-Preve
Endstation Burnout
Theorie und Praxis der sogenannten Vereinbarkeit
«Man macht sich wohl schon Illusionen, was Kinder betrifft»
Ein Gespräch mit Barbara Hochstrasser
Von der herzlosen zur fürsorglichen Mama
Kleine Kulturgeschichte der «Mutterliebe»
Und nun?
Auf der Suche nach Hoffnung
«Wer soll das bezahlen?»
Ein Gespräch mit Roland A. Müller
«Frauen, wehrt euch!»
Ein Gespräch mit Remo Largo
Prolog
Kürzlich habe ich mich mit einem Freund unterhalten. Er meinte, dass es heute doch problemlos möglich sei für Frauen, Karriere zu machen und gleichzeitig Kinder zu haben. Vor fünf Jahren war ich auch dieser Meinung. Seither habe ich zwei Kinder auf die Welt gebracht, daneben gearbeitet, gleichzeitig die Kinder versorgt und den Haushalt geschmissen. In dieser Zeit war mein Mann aus beruflichen Gründen ziemlich oft abwesend, derweil ich von der Kita ins Büro und vom Büro wieder in die Kita hetzte und in der Nacht dreimal aufstand, um eines der Kinder zu beruhigen. «Ich glaube nicht, dass es möglich ist», entgegnete ich meinem Freund. «Es sei denn, die Frau hat einen Hausmann zu Hause.»
Der Freund blickte mich erstaunt an. Er meinte, dass doch heute die Männer zu Hause mit anpacken würden, gerne einmal auch den Kochlöffel schwängen. Und weil sie die besseren Väter sein möchten, als es ihre waren, würden sie sich auch lieber mit ihren Kindern abgeben. Er nannte mir Beispiele aus seinem Bekanntenkreis und zählte auf, wie problemlos diese Paare Beruf und Familie nebeneinander auf die Reihe kriegten. Auch meinte er, gäbe es doch moderne Arbeitgeber, die etwa Kader-Teilzeitstellen auch männlichen Angestellten ermöglichten.
Ich weiss nicht, ob mein Freund recht hat, ob es wirklich so problemlos ist, wie er schilderte. Meine eigenen Erfahrungen, Job und Familie unter einen Hut zu bringen, brachten mich an den Rand meiner Belastbarkeit. Möglicherweise liegt das ja nur an mir. Kann gut sein. Es gibt Leute, die sagen, ich hätte den falschen Mann geheiratet, weil er angeblich zu viel arbeite. Ich hingegen zweifle, ob das alles so einfach ist und es mit einem anderen Mann besser wäre. Und doch staune ich, wenn ich mein Umfeld betrachte, wie Frauen – es sind praktisch nur Frauen – heute ihren Beruf an den Kindern vorbeijonglieren, während ihre Männer Vollzeit arbeiten. Sie sind enorm beschäftigt, haben kaum Zeit, aber klagen höre ich sie kaum. Manchmal sagt eine, sie sei ein bisschen erschöpft, aber das sei nicht weiter schlimm.
Ich fragte meinen Freund: Wie war das denn damals bei deiner Mutter – war sie ausgelastet mit dir und deinem Bruder, dem Haushalt? «Klar war sie mit uns ausgelastet», erwiderte er. «Sogar mehr als das.» Obwohl sie, wie damals üblich, keinen Job nebenher gehabt hat. Sich «nur» um die Familie gekümmert habe. Er sagte «nur» und machte das Anführungszeichen mit den Fingern in die Luft.
Was ja heute undenkbar wäre. Eine Frau, die heute «nur» wegen ihrer Kinder den Beruf an den Nagel hängt, ist gesellschaftlich verpönt. Dummerweise hat sich aber viel weniger verändert, als es scheint – selbst wenn man auf dem Papier von Gleichberechtigung spricht. Das merkt man aber erst dann, wenn ein Kind auf der Welt ist. Mütter stehen – trotz guter Ausbildung – nach wie vor am Herd. Auch dann, wenn sie wieder einer Erwerbsarbeit nachgehen. Zugleich zählen in der Arbeitswelt immer noch dieselben starren Mechanismen wie vor fünfzig Jahren: Noch immer gilt als produktiv, wer von frühmorgens bis spätabends an seinem Arbeitsplatz ausharrt, egal wie effizient er tatsächlich ist. «Karriere in Deutschland», hat der Trendforscher Matthias Horx einmal geschrieben, «ist ein Wettbewerb um Anwesenheitszeiten, um kommunikative Präsenz. Wer führt, muss nach dem Acht-Stunden-Tag noch für Meetings und Absprachen an der Bar zur Verfügung stehen. Kann sein Wochenende vergessen. Muss immer erreichbar sein.»1 In der Schweiz ist das nicht anders.
Ich kenne keine Mutter mit kleinen Kindern, die es sich zeitlich leisten kann, zwölf Stunden bei der Arbeit zu sein oder am Feierabend mit ihren Kollegen an einer Bar abzuhängen. Auch traf ich während meiner beruflichen Laufbahn kaum auf flexible Arbeitsstrukturen. Eher erntete ich feindliche Blicke, wenn ich meinen Arbeitsplatz erst nach neun Uhr erreichte oder die «Frechheit» besass, um fünf Uhr auszustempeln, um in die Kita zu eilen. Für mich würden familienfreundliche Strukturen aber bedeuten, dass die Arbeitstage kürzer wären, die Möglichkeit für Home-Office bestünde oder projektbezogene Arbeiten zu Hause ausgeführt werden könnten, was in vielen Dienstleistungsberufen problemlos möglich ist. Mein Chef jedoch hielt nichts von diesen Ideen, offenbar war ihm meine Anwesenheit im Betrieb mehr wert als mein Output.
Ebenfalls herrscht eine Doppelmoral, was Kinder betrifft. Einerseits werden sie heute wie Prinzen und Prinzessinnen auf Händen getragen, und es wird penibel darauf geachtet, dass dem Nachwuchs sämtliche Steine aus dem Weg geräumt werden. Andererseits sollten Kinder heute möglichst in eine Kita abgeschoben werden, am besten gleich drei Monate nach der Geburt, damit die Mutter ihre Karriere nahtlos weiterverfolgen kann. «Normal» aber müsste sein, dass erwerbstätige Mütter von zeitraubenden Haushaltspflichten befreit werden und Familienväter tatsächlich Teilzeit arbeiten.
Niemand will zurück in die steife Zweigeschlechterwelt, die Schüler nur noch vom Hörensagen kennen. Doch an der sogenannten Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss noch viel gearbeitet werden, solange sich Mütter bis zum Umfallen verbiegen müssen, wenn sie das tun, was mittlerweile von ihnen erwartet wird. Denn wirklich geändert hat sich in den letzten zehn, zwanzig Jahren allein das Anforderungsprofil an die «moderne Mutter», das zu einer noch grösseren Gesamtbelastung der Frau führt. Alles andere ist mehr oder weniger beim Alten geblieben.
Das Kind ist da
Mein Leben als berufstätige Mutter
Ein Wimmern dringt aus dem Kinderzimmer. Es ist 3.52 Uhr, ich bin sofort ganz Ohr. Noch hoffe ich – wie jedes Mal – dass Linus von allein weiterschlafen wird, aber das Geräusch schwillt an, wird Lärm. Ich zwinge mich aus meinem Bett, taste ins Kinderzimmer, nehme den Kleinen auf, bringe ihn zu mir ins Bett. Dort ist alles schon vorbereitet: Warmes Wasser in der Thermoskanne, Milchpulver in der Trinkflasche. Mechanisch schütte ich das Wasser in das Fläschchen, drücke es dem knapp Einjährigen in die Hände und falle zurück in die Federn. Ein paar Augenblicke später schläft Linus wieder.
Nun schwebe ich in einem türkisblauen Swimmingpool, es ist angenehm warm, die Sonne scheint. Ich tauche auf, hole Luft und fliege erneut hinab zum Grund, fühle mich so schwerelos wie ein Vogel, wunderbar, alles ist schön und gut. Doch plötzlich stört etwas. Es ist kein Schmerz, aber trotzdem unangenehm. Es wird lauter, unerträglich. Ein Presslufthammer? Nach quälenden Sekunden komme ich zur Besinnung. Ach. Das Presslufthämmern entpuppt sich als Gejammer meines dreijährigen Sohns, der je länger desto lauter brüllt. Die Uhr zeigt 5.36 Uhr, draussen ist es stockdunkel. Trotz der lähmenden Müdigkeit, hetze ich in die Küche. Jede Bewegung schmerzt. In Sekundenschnelle giesse ich Milch in die Trinkflasche, stelle sie in die Mikrowelle. Während ich wartend mit den nackten Füssen auf dem Küchenboden stehe, bete ich, dass nicht auch Linus erwachen möge. Zu spät. Auch der Kleine macht sich bemerkbar. Guten Morgen allerseits! Keine Chance, nochmals ins Bett zu kommen, um für ein paar Stunden oder lieber Tage zu schlummern.
Ich kehre mit zwei Milchflaschen ins Schlafzimmer zurück. Beide Buben liegen in meinem Bett. Sie greifen nach der Milch, und ich husche erneut in die Küche, um Kaffee für mich aufzusetzen, den ich dringend benötige. Danach nehme ich Linus auf, der strahlt wie ein Maikäfer – «Wenigstens du …» –, hieve ihn auf den Wickeltisch, ziehe ihm den Pyjama aus, wechsle die Windeln, ziehe Body, Strumpfhose, «Halte doch mal still, ja?», Pulli und Hosen an, trage ihn auf meinen bleischweren Armen in die Stube, versuche ihn auf den Boden zu setzen, mit einem Kuschelhasen, aber er weigert sich, will, dass ich ihn halte. Inzwischen ist mein Mann aufgestanden. Er hat auf dem Sofa geschlafen. Er begrüsst die zwei Buben und mich. «Gut geschlafen?», flötet er, bevor er sich unter die Dusche stellt. «Wunderbar», schnurre ich. Das ist natürlich gelogen. Von Schnurren kann keine Rede sein.
Es duftet angenehm, der Kaffee köchelt in der Mokkakanne, doch gerade als ich die Tasse ansetzen möchte, ruft es aus der Stube ziemlich barsch:
«Mama! Wo ist meine Schere?! Mama!»
Arturs Befehlston macht deutlich, dass ein Ausweichmanöver zwecklos ist. Jede Sekunde zählt, damit er nicht die Beherrschung verliert und in ein minutenlanges Toben verfällt. Schnell eile ich ins Kinderzimmer, Linus immer noch seitlich auf meiner Hüfte, gucke in der Malschachtel nach, knie mich hinunter, um unters Bett zu schauen, Linus lacht dabei, sehe die Kinderschere dann Gott sei Dank auf dem Weg in die Stube in meinem Schuh stecken. Phu! Gefahr gebannt.
«Hier Artur, alles in Ordnung.» Gleichzeitig erinnere ich ihn, dass wir etwas später in die Kita gehen werden.
«Nein, ich will nicht in die Kita!»
«Ach, komm, dort kannst du mit Flurin spielen – das ist doch viel lustiger als hier zu Hause.»
«Ja, aber nur, wenn Flurin da ist. Sonst bin ich den ganzen Tag traurig und warte, bis du mich wieder holen kommst.» Ich schlucke leer.
Inzwischen ist mein Mann angezogen, verabschiedet sich von den Kindern und mir. Sein Zug fährt in einer Viertelstunde. «Tschüss, macht’s gut!»
Ich bin gerade sehr neidisch auf meinen Mann.
Nun ziehe ich mich in Windeseile an, während Artur in der Stube schneidet und mir Linus vom Bett aus zuguckt. Dann schnell ins Badezimmer, um mich fürs Büro ein bisschen aufzumotzen, nach dieser Nacht, die vielleicht sechs, vielleicht sieben Stunden gedauert hat und drei – oder waren es viermal? – unterbrochen war. Ich platziere Linus sehr bestimmt auf dem Boden, gebe ihm eine Gummiente zum Spielen, beginne mich zu waschen, schminken, kämmen. Es beunruhigt mich, dass es in der Stube, wo Artur schneidet, so ruhig ist. Hastig beende ich die Schminkerei, die Wimperntusche verschmiert, kehre mit Linus zu Artur zurück. Artur zerschnippelt die Zeitung von gestern.
«Nun aber anziehen», fordere ich ihn auf, doch er weigert sich. Ich setze Linus auf den Boden, verfolge Artur – nun als Monster mit Grabesstimme – durch die ganze Wohnung. Endlich gelingt es mir, ihn zu packen, er lacht, wir gehen ins Kinderzimmer. Linus, der bereits zu reklamieren begonnen hat, hole ich eine Sekunde später nach. «Keine Sorge, ich hab dich nicht vergessen!»
Es ist halb neun, als wir drei samt Kinderwagen und Like-a-bike vor dem Haus stehen. Ich bin trotz Minus-Temperaturen nassgeschwitzt, weil ich Arturs Handschuhe in der Wohnung vergessen hab – «Wartet kurz hier, ich komme gleich wieder!» – und zuvor seinen Nuggi – «Ich will den Blauen!» – unter meinem Bett in voller Montur (Mantel, Schleife, Kappe, Schuhe) hervorklauben musste. Die Wohnung sieht aus, als ob ein Wirbelsturm darin gewütet hätte: Das Frühstücksgeschirr unter dem Tisch, tausend Playmobil-Teilchen und Zeitungsschnipsel auf dem Stubenboden zerstreut; zum Glück hat Artur die Pistole für seinen Playmobil-Polizisten innert nützlicher Frist gefunden, ohne die wir die Wohnung sonst nicht hätten verlassen können. Für die hundert Meter zur Tramstation benötigen wir zehn Minuten, weil Artur auf seinem Like-a-bike Ameisen sucht, die er überfahren will. Er findet zum Glück keine. In der Kita ziehe ich den beiden Buben Handschuhe, Kappen, Jacken und Schuhe aus, die Pantoffeln an – und ermutige sie, indem ich mich sagen höre:
«Mama kommt euch früh holen! Habt Spass!»
Artur heult, seit wir die Kita betreten haben. «Ich will bei dir bleiben, Mama!» Linus lächelt, als ihn die Erzieherin aufnimmt. Immerhin er.
Neun Uhr. Ich haste erneut total verschwitzt an die Haltestelle, steige ins nächste Tram, um dann, endlich im Büro, es ist Viertel nach neun, genervte Blicke zu ernten. Guten Morgen allerseits! Schon wieder fünfzehn Minuten später, als ich wollte – wie soll ich die Zeit bloss wieder aufholen?
Ich starte in meinem Einzelbüro den Computer, checke die Mails – nichts Besonderes, zum Glück. Ich atme das erste Mal, seit ich heute auf den Beinen bin, durch, es ist wunderbar ruhig hier im Büro, beinahe schon freudig beginne ich den Brief zu redigieren, den mir meine Kollegin auf den Tisch gelegt hat. Ich kann mich konzentrieren, ohne dass ich alle zwei Sekunden aus meinen Gedanken gerissen werde, um ein Bedürfnis eines meiner Kinder zu stillen.
Später, in der obligaten Kaffeepause, unterhalte ich mich mit meinen Bürokollegen. Wir bemühen uns, nett miteinander zu sein, dafür kommt es unterschwellig zu Sticheleien. «Ich glaube, dass heute auch Mütter mit Kindern problemlos Karriere machen können – also, ich meine, wenn sie das auch wirklich wollen», meint etwa die Sekretärin mit einem Blick auf mich. Sie ist kinderlos, fiebert ihrer Pension entgegen. Ich verschlucke mich beinahe an meinem Macchiato und überlege kurz, ob ich ihr den Kaffee auf die Hose schütten soll. Ich tu es nicht, natürlich.
Die Sache mit der Krippe
Zurück in meinem Büro, denke ich an meinen älteren, dreijährigen Sohn. Weshalb weigert er sich jedes Mal, in die Kita zu gehen? Ich erinnere mich an das Interview mit Jesper Juul, das ich in der «Zeit» gelesen habe.2 Jesper Juul ist ein dänischer Buchautor und Erziehungsberater, sehr populär, weil unkonventionell. Er wagt es, Unangenehmes, das nicht gerade dem Mainstream entspricht, auszusprechen. «Um es gleich vorab zu sagen», schreibt Jesper Juul: «Kinderkrippen wurden geschaffen, um die Bedürfnisse von Familien zu erfüllen, in denen beide Elternteile arbeiten wollen oder müssen, und sie dienen zugleich dem wachsenden Bedarf der Gesellschaft und der Wirtschaft an Erwerbstätigen. Sie wurden nicht eingerichtet, um die Bedürfnisse der Kinder zu erfüllen.»3 Ich gebe zu, dass ich solche Sätze nicht gern lese. Auch erwähnte er, dass die letzte grosse qualitative Untersuchung in Dänemark gezeigt habe, dass es 24 Prozent der befragten Jungen zwischen drei und sechs Jahren nicht gut gehe in der Kita. Bei den Mädchen waren es 10 Prozent. «Ein tägliches Arbeitspensum von sechs bis acht Stunden, das aus verbindlicher Teilnahme und Kooperationsbereitschaft mit den Begebenheiten der Tageseinrichtung besteht, stellt hohe Anforderungen an kleine Kinder», so Juul.
Ächz. Ich war, bevor ich Kinder hatte, überzeugt, dass es nichts Besseres für Kinder gebe als Kinderkrippen. Alice Schwarzers Worte klingen noch immer in meinen Ohren: Man habe früher versucht, den Müttern einzureden, dass Kinder erst mit drei Jahren eine Krippe besuchen sollten. Warum erst mit drei Jahren? Untersuchungen hätten gezeigt, dass Kinder schon im Säuglingsalter gut in einer Krippe aufgehoben seien, ohne dass sie Schaden nähmen.
Genau!, fand ich damals. Diese «Untersuchungen» habe ich später, trotz intensiver Suche, nirgends gefunden. Gefunden habe ich hingegen eine Studie4 aus dem Jahr 2012, die besagt, dass die Qualität in Schweizer Kitas «durchzogen» sei. Es fehle an Personal und finanziellen Ressourcen, um eine qualitative Betreuung zu gewährleisten. Positive Erkenntnisse lieferte einzig eine Langzeitstudie aus Amerika, die belegt, dass für Kinder aus bildungsfernen Familien eine Betreuung ausser Haus nützlich sein kann. Was man heute als «gefestigtes Wissen» bezeichnet, obwohl Langzeitstudien zumeist fehlen, haut mich auch nicht gerade um: «Kinder, die in einer guten oder zumindest mittelmässigen Krippe unterkommen, erleiden keinen Schaden, sondern profitieren zumeist.» Und: «Stille Kinder laufen Gefahr, in einer personell schlecht ausgestatteten Krippe längere Zeit zu leiden.»5
Was ist mir eigentlich wichtiger: Ist es mein Chef oder sind es meine Kinder?
Seit seinem fünften Lebensmonat besucht mein älterer Sohn Artur während zwei Tagen die Krippe – heute nennt man sie Kita. Es war für mich und meinen Mann immer klar, dass unser Junge, sobald mein Mutterschaftsurlaub nach vier Monaten zu Ende war, in der Kita betreut würde. Dass ich auf meine Stelle, auch wenn ich sie gar nicht so mochte, verzichten würde, konnte ich mir nicht vorstellen. Schon mal was von Emanzipation gehört?, dachte ich jeweils, wenn ich hörte, dass eine Frau ihren Beruf aufgab, sobald sie Mutter wurde.
Heute sehe ich das differenzierter. Als Krippenkind hatte Artur bereits mit sechs Monaten eine Mittelohrentzündung, die mit Antibiotika behandelt werden musste. Husten, Schnupfen, Fieber, Bindehautentzündungen folgten im Monatstakt. Häufig blieb ich mit ihm zu Hause, oder die Oma reiste an, um sich um ihren kranken Enkel zu kümmern, damit ich ins Büro gehen konnte. Als zwei Jahre später Linus auf die Welt kam, landete er bereits mit fünf Wochen auf der Intensivstation des Kinderspitals. Sein älterer Bruder hatte ihn mit dem sogenannten RS-Virus (Respiratorisches Synzytial-Virus), den er aus der Kita heimschleppte, angesteckt, der zwar für ältere Kinder ungefährlich ist, aber einem Säugling wegen Husten und angegriffenen Bronchien Atemnot beschert. Erst nach ein paar Tagen konnten wir das Spital wieder verlassen.
Auch über das Kita-Wesen hatte ich inzwischen einiges gelernt. Dachte ich zuvor, dass die Qualitätsstandards in etwa dieselben seien und bestimmt von den Behörden strengstens überwacht würden, wurde ich eines Besseren belehrt. Erst jetzt weiss ich, dass es zwischen den einzelnen Kindertagesstätten immense Unterschiede gibt.
Es begann mit Arturs Eingewöhnung, als er fünf Monate war. Sie dauerte gerade einmal eine halbe Stunde und war für mich ein Schock. Ich musste meinen Sohn das erste Mal wildfremden Menschen anvertrauen, durfte nicht einmal die Räumlichkeiten der Kita betreten, die ich Monate zuvor, hochschwanger und total ahnungslos, für meinen Sohn auserwählt hatte. Als ich Artur der Erzieherin auf der Türschwelle übergab, wurde ich ziemlich barsch hinauskomplimentiert. «Bis später», sagte sie, und zu war die Tür. Total verwirrt lungerte ich eine halbe Stunde in der Stadt herum. Nachdem die Zeit um war, eilte ich zurück, wo ich meinen Sohn schreiend antraf. «Er vermisst die Mama», sagte die Erzieherin und drückte mir Artur in die Arme. Tief verunsichert verliess ich die Kita, obwohl mir die sogenannte Kita-Tauglichkeit meines Sohnes bestätigt worden war.
Doch ich hatte keine andere Wahl. Drei Tage später musste ich ins Büro zurück. Am Morgen meines ersten Arbeitstages zog ich meinen Sohn an und brachte ihn schweren Herzens in die Kita. Es war mir schleierhaft, wie ich acht Stunden ohne ihn überleben konnte. Offenbar ging es ihm allerdings besser als mir, jedenfalls beteuerte mir das abends eine Erzieherin. «Kann das sein?», fragte ich mich. Doch gewöhnte ich mich sehr schnell daran, den Kleinen abzugeben – zumal er bei der Übergabe kaum weinte – und freute mich umso mehr, wenn ich abends ein strahlendes Kind in Empfang nehmen durfte.
Was mich störte, war, dass meine Anwesenheit nicht gefragt war, ich meinen Sohn jeweils in der Garderobe abgeben musste und das Haus unverzüglich zu verlassen hatte. Ich wusste nicht, wo mein Sohn schlief, was er den ganzen Tag über machte. Wenn ich danach fragte, wurde ich misstrauisch beäugt und mit Schulterzucken abgespeist. Als ich mich einmal telefonisch erkundigte, wie es Artur ginge (er kränkelte zu Hause), beschied mir die Kita-Leiterin, doch künftig nicht mehr anzurufen. Sie würden sich schon melden, falls etwas nicht in Ordnung sei. Ich schluckte. Bin ich überbesorgt? Allerdings hatte ich doch ein Recht zu wissen, was sie mit meinem Kind den ganzen Tag über machen? Was, wenn der Junge schrie? Nicht essen wollte? Die vagen Antworten, die ich jeweils erhielt, behagten mir ganz und gar nicht.
Ich schaute mir zum Vergleich eine andere Kita an. Ich war beeindruckt, wie freundlich und offen das Personal war und wie umfassend meine Fragen beantwortet wurden. Die Kita-Leiterin führte mich herum, zeigte mir ihr pädagogisches Konzept – das gibt es? – und informierte mich darüber, dass sie nur Bio-Produkte zum Kochen verwenden würden und Fleisch nur selten auf dem Speisezettel stehe. Noch am selben Tag meldete ich meinen Sohn an. Als er knapp ein Jahr alt war, vollzogen wir den Wechsel. Die Eingewöhnung dauerte nicht – wie zuvor – eine halbe Stunde, sondern zog sich über mehrere Wochen hin. Das sei enorm wichtig, beschied mir die neue Erzieherin, sonst fühle sich Artur überrumpelt. Trotzdem behagte meinem Sohn der Wechsel nicht so sehr wie mir. Er brauchte etwas länger, bis er sich an die neue Umgebung gewöhnt hatte. Arturs Startschwierigkeiten liessen natürlich auch mich nicht unberührt. Hatte ich richtig entschieden? Zumal die ehemalige Kita-Leiterin Tränen in den Augen hatte, als ich mich mit Artur definitiv von ihr verabschiedete.
Doch je grösser Artur wurde, desto mehr Freundinnen und Freunde fand er in der Kita, mit denen er zu spielen begann. Auch schloss er einzelne Betreuerinnen ins Herz, die ihm das Ankommen wesentlich erleichterten. Diese spürbaren Fortschritte liessen auch mich allmählich ruhiger werden, und mein permanent schlechtes Gewissen nahm ein wenig ab.