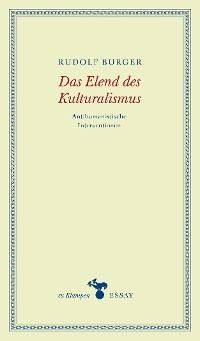Czytaj książkę: «Das Elend des Kulturalismus»
RUDOLF BURGER
Das Elend des Kulturalismus
Antihumanistische Interventionen

Reihe zu Klampen
Essay Herausgegeben von
Anne Hamilton
Rudolf Burger,
Jahrgang 1938, ist Professor emeritus für Philosophie an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Nach Abschluss seines Studiums der Technischen Physik (Promotion 1965) war er u. a. am Battelle-Institut in Frankfurt am Main und im Planungsstab des Bundesministeriums für Forschung und Technologie in Bonn tätig. 1987 wurde er als Professor für Philosophie an die Universität für angewandte Kunst berufen, deren Rektor er von 1995 bis 1999 war. Mit seinen Schriften zur politischen Situation sorgte er mehrmals für landesweite Kontroversen in Österreich. Bei zu Klampen sind bereits erschienen: »Ptolemäische Vermutungen«. (2001), »Re-Theologisierung der Politik?«. (2005) und »Im Namen der Geschichte. Vom Missbrauch der historischen Vernunft«. (2007).
Inhalt
Cover
Titel
Der Autor
Zitat
Was ist Bildung?
Der Triumph des Liberalismus Ein Nachruf
Das Elend des Kulturalismus
Die Sehnsucht nach dem Unendlichen Über das romantische Rezidiv
Vom Willen zum Erhabenen
Willensfreiheit als semantischer Effekt
Nachweise
Impressum
Fußnoten
WER nur Erbauung sucht, wer die irdische Mannigfaltigkeit seines Daseins und des Gedankens in Nebel einzuhüllen und nach dem unbestimmten Genusse dieser unbestimmten Göttlichkeit verlangt, mag zusehen, wo er dies findet; er wird leicht selbst sich etwas vorzuschwärmen und damit sich aufzuspreizen die Mittel finden. Die Philosophie aber muß sich hüten, erbaulich sein zu wollen.
G. W. F. Hegel
Was ist Bildung?
I.
WAS immer »Bildung« sein mag – der deutsche Begriff von ihr ist jedenfalls, so lautet die Auskunft gebildeter Leute, in andere Sprachen nicht wirklich übersetzbar. Die Wörter »education«. (engl.) oder »éducation«. (fr.) haben bei weitem nicht jenen Umfang – gebildet ist, wer »allgemein« gebildet ist – und jene Bedeutungsschwere, die der sehr deutsche Begriff »Bildung« als subjektive Inkorporation von »Kultur« seit dem Deutschen Idealismus, seit Johann Gottfried v. Herder, dem ersten Theoretiker und Stichwortgeber eines spezifisch deutschen Bildungsbegriffs, und Wilhelm v. Humboldt, dem großen Reformprogrammatiker der preußischen Universitäten, mit sich schleppt. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts ist der Bildungsbegriff, über den das Bildungsbürgertum sich lange Zeit kulturell definierte, idealistisch imprägniert; und zwar nicht nur durch die Philosophie und die Literatur der deutschen Klassik und Romantik, sondern vor allem durch einen Neuhumanismus, der in der griechisch-römischen Antike sein kulturelles Ideal erblickte und im humanistischen Gymnasium sowie in der neuorganisierten Universität seiner vermeintlich unpraktischen »Bildungsreligion« als notwendiger Grundlage jeder akademischen Fachausbildung eine praktisch folgenreiche Normgeltung verschaffte:
»Bildung« hieß fortan (und heißt zumindest unterschwellig bis heute) musisch-literarische, im Kern humanistische Bildung, und humanistische Bildung hieß im Idealfall am Studium der klassischen antiken Autoren gewonnene und verinnerlichte Kultur. Naturwissenschaftlich-technische Schulung galt ihr gegenüber als kulturell zweitrangig – man sprach auch von »Kulturschulen« und »Zivilisationsschulen«. Dieses Bildungsideal hat sich durch die lange Zeit hegemoniale Stellung der deutschen Kultur in ganz Kontinentaleuropa verbreitet. Der »Erwerb« einer solchen »Bildung« verschaffte seinem Besitzer einen gesellschaftlichen Distinktionsprofit gegenüber dem »Ungebildeten«, auch wenn dieser vielleicht über mehr praktische Kenntnisse, Geld, Macht und Eleganz verfügt haben sollte. Wäre man boshaft, so könnte man sagen, der Bildungsbürger ist der kontinentaleuropäische Ersatz für den Gentleman in Form des Großmaturanten.
Die Herauflobung des humanistischen Bildungs- und Kulturbegriffs, die bis heute die inoffizielle Rangordnung der Curricula bestimmt (ein Lateinlehrer gilt gemeinhin immer noch für »gebildeter« als ein Bauingenieur), hat erst jene binären Codierungen und Juxtapositionen ermöglicht, die seit Jahrzehnten jede Schul- und Hochschulreform ideologisch vergiften und als »semantisches Gefängnis« (Bollenbeck) fungieren. Sie haben ihren Ursprung in den beiden Grunddichotomien Bildung (zur Veredelung des Menschen) und Ausbildung (zum Beruf), Kultur versus Zivilisation, die erst mit dem Idealismus und der Romantik virulent geworden sind. Es ist bemerkenswert, daß in Immanuel Kants berühmter Schrift »Was ist Aufklärung?« von 1784 die Begriffe »Bildung« und »Kultur« nicht ein einziges Mal vorkommen. (Und auch nicht, wenn ich nichts übersehen habe, im »Streit der Fakultäten« von 1794.) Der kritische Transzendentalphilosoph Kant schreibt noch ganz im cartesianischen Geist der Tabula rasa, für den Philosophie zunächst und vor allem nicht ein Bildungsunternehmen zur Bereicherung der Kultur, sondern ein Abbruchunternehmen darstellt. Genau das ist ja, wenn man so sagen darf, der erkenntnispolitische Sinn des radikalen cartesianischen Zweifels: nämlich den gesamten scholastisch angehäuften Bildungsmüll abzuwerfen, um auf epistemisch gereinigtem Boden empirisch gesichertes und technisch brauchbares Wissen produzieren zu können; dem gleichen purifizierenden Impuls folgt die antimetaphysische Transzendentalphilosophie Kants, die zugleich den Höhe- und Kippunkt der Verstandesaufklärung darstellt. Geistesgeschichtlich ist die Emphatisierung von »Bildung« und »Kultur« also nicht in der Aufklärung, sondern erst in der neuhumanistischen Reaktion auf die Systemdenker des Deutschen Idealismus, auf Fichte, Schelling und Hegel, zu verorten, wobei die Rolle Hegels wie immer ambivalent ist. Denn bei ihm erscheinen »bilden« und »Bildung« als konstitutive Momente einer weltgeschichtlichen Höherentwicklung des objektiven Geistes, die mit der Arbeit beginnt und in ihr ihre beständige Basis hat. Damit durchbricht Hegel die klassenspezifische Enge des neuhumanistischen Bildungsbegriffs, wird doch die Vorstellung vom »Tätigwerden des Geistes« mitten in der beruflichen Praxis angesiedelt – eine geschichtsphilosophische Gedankenfigur, an die der junge Marx anknüpfen wird.
Damit hatte der Neuhumanismus, der schon zu Hegels Zeiten die reformpädagogische Bühne beherrschte, freilich nichts im Sinn. Mit ihm und seiner Kritik der Verstandesaufklärung werden die Formeln von der »wahren Bildung« geboren, die sich bis heute wiederholen und in der Polemik gegen »bloß« berufspraktische Ausbildung immer wieder neu anreichern. »Geist« steht dann gegen »Brauchbarkeit«, die »Bildung des Menschen« gegen seine »Abrichtung zum Beruf«; »freie Bildung« steht gegen Nützlichkeit und Verwendbarkeit, die »Brodwissenschaften«, wie Schelling verächtlich sagte, stehen gegen das »wahre Wissen« und die »Philosophie«.
Dieser Topos hält sich durch von Friedrich Schillers »Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen« aus dem Jahre 1795 bis zu Friedrich Nietzsches Vorträgen »Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten« von 1872. Als der Gewährsmann und Repräsentant des neuhumanistischen Bildungsideals aber gilt nicht Schiller, und schon gar nicht Nietzsche, der in späteren Jahren ganz andere Positionen vertreten hat als der damals neuberufene 27jährige Altphilologe, sondern Wilhelm v. Humboldt, und zwar sowohl inhaltlich als auch und vor allem bildungspolitisch. Wie kein anderer verkörpert er eine ganz bestimmte bildungspolitische Tradition, ja sein Name wurde geradezu zur Kampfparole in hochschulpolitischen Auseinandersetzungen. Zwar wird man bei ihm die später notorisch werdende Abwertung der Berufsausbildung – der »speziellen Bildung«, wie es bei ihm heißt – zugunsten der »allgemeinen Bildung« nicht finden, aber das persönlichkeitsveredelnde Ideal schöner Innerlichkeit, die sich harmonisch in entfremdende Verhältnisse fügt und diese verklärt, bestimmt ab ovo sein pädagogisches Programm. So schreibt er schon in seiner fundamentalen »Theorie der Bildung des Menschen« von 1794/95: »Hier kommt es nun darauf an, daß der Mensch in dieser Entfremdung nicht sich selbst verliere, sondern vielmehr von allem, was er außer sich vornimmt, immer das erhellende Licht und die wohltätige Wärme in sein Inneres zurückstrahle.« Und in einer späten Schrift vom Beginn der 1830er Jahre heißt es: »Die Zivilisation ist die Vermenschlichung der Völker in ihren äußeren Einrichtungen und Gebräuchen und der darauf Bezug habenden inneren Gesinnung. Die Cultur fügt dieser Veredlung des gesellschaftlichen Zustandes Wissenschaft und Kunst hinzu. Wenn wir aber in unserer Sprache Bildung sagen, so meinen wir damit etwas zugleich Höheres und Innerliches, nämlich die Sinnesart, die sich aus der Erkenntnis und dem Gefühle des gesamten Geistigen und sittlichen Strebens harmonisch auf die Empfindung und den Charakter ergießt.« Als »Bildung« in einem emphatischen Sinn kann daher nur gelten, was der erbaulichen Selbststeigerung der Persönlichkeit dient. Das Studium der alten Sprachen, der klassischen Literatur und Kunst, überwölbt von idealistischer Philosophie, schafft das »Gut« dieser Bildung, die die Persönlichkeit formt, weil dem Neuhumanismus ein ästhetisch idealisiertes Griechenland als der historische Ort geglückter Bildung erscheint: Die Griechen gelten dieser Pädagogik als Verkörperung des »wahren Menschentums«, und das Studium des klassischen Altertums stellt daher das Muster aller wahren Bildung dar. So wurde das humanistische Gymnasium zum Gral des Bildungsbürgertums. (Wie sehr dieses Muster allerdings literarisch-ästhetisch verzerrt ist, wird schon daraus ersichtlich, daß etwa für Platon selbst nicht der Mythos und die Tragödie, sondern die Mathematik das Erkenntnisideal darstellte – er verbannte die Dichter als Lügner aus seinem Idealstaat, und eine Inschrift über der Akademie versagte jedem den Zutritt, der keine mathematischen Kenntnisse besaß: Die Griechen der klassischen Zeit, und erst recht der Archaik, waren gerade keine »Humanisten«!)
II.
In seiner Studie »Der Niedergang der bürgerlichen Denk- und Lebensform« charakterisiert Panayotis Kondylis die Denkformen des liberalen Bürgertums des 19. Jahrhunderts, die allen seinen geistigen Äußerungen gemeinsam sind, als synthetisch-harmonisierend, um sie von den analytisch-kombinatorischen Denkfiguren, die für unser massendemokratisches Zeitalter charakteristisch sind, kontrastierend abzusetzen. Bürgerliches Denken, sagt Kondylis, war grundsätzlich bestrebt, das Weltbild aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Dingen und Kräften zu konstruieren, die zwar, isoliert betrachtet, sich im Gegensatz zueinander befinden können, doch in ihrer Gesamtheit ein harmonisches und gesetzmäßiges Ganzes bilden, innerhalb dessen Friktionen oder Konflikte im Sinne übergeordneter Zwecke aufgehoben werden. Der Teil existiert innerhalb des Ganzen, und er findet seine Bestimmung, indem er zur harmonischen Vollkommenheit des Ganzen beiträgt, nicht aber durch Verleugnung, sondern durch Entfaltung der eigenen Individualität. Insofern werden die Dinge zwar von ihrer Funktion her gedacht, ihre Substanz geht dabei aber nicht verloren, auch wenn diese nicht oder nicht ganz erkannt werden kann; und eben die Annahme von der Substantialität der Dinge gestattet ihre objektive Bewertung und ihre Einordnung in diese oder jene Stufe des harmonischen Ganzen. Wesentlich anders verhält es sich bei den analytisch-kombinatorischen Denkfiguren. Hier gibt es keine Substanzen und keine festen Dinge, nur letzte Bestandteile, Elemente, die durch konsequente Analyse ermittelt werden und deren Wesen und Existenz eigentlich nur in ihrer Funktion besteht, zusammen mit anderen Elementen immer neue Kombinationen einzugehen. Daher kann hier von Harmonie, die auf mehr oder weniger festen Beziehungen zwischen Teilen und Ganzem beruht, nicht die Rede sein; es kommen nur Kombinationen vor, die ständig durch neue und prinzipiell gleichwertige ersetzt werden. Alles kann und darf im Prinzip mit allem kombiniert werden, denn alles befindet sich auf derselben Ebene, und es gibt keinen ontologischen Hintergrund, der den Vorrang bestimmter Kombinationen vor anderen sicherstellen würde.
Es ist klar, daß beide Denkweisen – die synthetisch-harmonisierende und die analytisch-kombinatorische – zu jeder Zeit bei verschiedenen Denkern, sozialen Klassen und intellektuellen Feldern, in Kunst, Philosophie und Wissenschaft, miteinander koexistent sein können; aber es ist ebenso klar, daß jeweils nur eine der beiden zu ihrer Zeit hegemonial sein kann. (So war z. B. die resolutiv-kompositorische Methode des Materialisten Thomas Hobbes im 17. Jahrhundert eine ausgesprochene Minderheitenposition.) Und klar ist vor allem auch, daß das humanistische Bildungsideal des liberalen Bürgertums in geradezu idealtypischer und konzentrierter Weise die synthetisch-harmonisierende Denkweise verkörperte und daß jenes Ideal daher im gleichen Augenblick in die Krise kommen mußte, als diese Denkweise ihre gesellschaftlich hegemoniale Stellung mit dem atemberaubenden Fortschritt der exakten Naturwissenschaften, der Industrialisierung der Produktion und dem Heraufkommen einer postliberalen Massengesellschaft an die analytisch-kombinatorische Denkweise abgeben mußte.
Angesichts dieser Entwicklung erscheint die normativ idealisierende Wiederbelebung und pädagogische Indoktrinierung antiker Kultur- und Denkformen, die sich einem letzten Endes noch mystisch-religiösen Naturverhältnis und einer noch schroffen Standesgesellschaft verdanken, als durchaus fragwürdige Poetisierung der »Prosa der modernen Welt«. (Hegel), die ihr in ihren geistigen Repräsentanten Glanz und Würde verschaffen sollte; die humanistische Bildungsmaskerade wurde jedoch in dem Maße überflüssig und störend, ja sogar peinlich, als die industrielle Moderne ihr eigenes Selbstbewußtsein, ihre eigene wissenschaftliche Sprache und ihren eigenen geschichtlichen Stil fand.
Mit der Ausdifferenzierung einzelner naturwissenschaftlicher, technischer, sozialwissenschaftlicher und geisteswissenschaftlicher Disziplinen, die je eigenen Logiken gehorchen, wird die Humboldtsche Idee einer Einheit der Wissenschaften im Medium philosophischer Reflexion obsolet. Der Altphilologe wird mit dem Historismus zu einem Fachgelehrten neben anderen auch, und damit wird die Idee einer allgemeinen Bildung im Medium der Humaniora durch die Notwendigkeit der Spezialisierung sogar auf deren eigenem Gebiet in der Praxis widerlegt – das mußte selbst Nietzsche in seiner Auseinandersetzung mit Wilamowitz-Moellendorff leidvoll erfahren.
Schon in den 1870er Jahren machte das böse Wort vom »Bildungsphilister« die Runde, und etwa zur gleichen Zeit kritisierte der große Physiologe Du Bios-Reymond das humanistische Bildungsideal mit dem trockenen Hinweis, daß die antike Wissenschaft nicht technikerzeugend gewesen sei und daher als methodisches Vorbild in modernen Zeiten nichts mehr tauge. Diese Diagnose ist seither oft wiederholt worden, und das nicht nur von Naturwissenschaftlern, wie etwa von Werner Heisenberg, der einmal bemerkte, daß »die Behauptungen der modernen Physik gewissermaßen sehr viel ernster gemeint sind als die der griechischen Philosophie«, sondern gerade auch von geisteswissenschaftlichen Fachgelehrten. So hat der englische Graecist Eric Dodds in seiner Studie »The Greeks and the Irrational« darauf aufmerksam gemacht, daß die Stoa, die später im römischen Imperium immensen Einfluß erringen sollte, schon in ihrer mittleren Periode die Durchsetzung des heliozentrischen Weltbildes, das die griechische Astronomie bereits entwickelt hatte, aus religiösen Gründen verhinderte (der Stoiker Cleanthes strebte gegen Aristarchos sogar einen Asebie-Prozeß an, einen Ketzerprozeß, wie die katholische Kirche fast zwei Jahrtausende später gegen Galilei), und Theodor Mommsen läßt in seiner »Römischen Geschichte« an Cicero, dem Säulenheiligen des gymnasialen Humanismus, kein gutes Haar. Er bezeichnet ihn als »großmäuligen und langweiligen Pharisäer«, spricht vom »terminologischen Geklapper und hohlen Begriffen der stoischen Weisheit« und schreibt: »Wer immer in geistiger Frische sich regte, opponierte der Stoa oder ignorierte sie […] für ernste Männer predigte der Epikureer lukretius mit dem vollen Accent der innigen Überzeugung und des heiligen Eifers gegen den stoischen Götter- und Vorsehungsglauben und die stoische Lehre von der Unsterblichkeit der Seele; für das große lachbereite Publikum traf der Kyniker Varro mit den flüchtigen Pfeilen seiner vielgelesenen Satiren noch schärfer zum Ziel.« So also sah es mit der Wertschätzung des großen Rhetors, der das Bildungsideal des Humanismus verkörpert, schon im spätrepublikanischen Rom aus; mit den Zynikern und materialistischen Epikureern aber, die damals schon die intellektuelle Avantgarde darstellten, hatte dieser, wie schon die gesamte christliche Epoche vor ihm, selbstverständlich nichts am Hut.
Als kulturelles und damit als soziales Distinktionsmerkmal hat der humanistische Bildungsbegriff sich bis in unsere Tage erhalten, wenn auch der griechische Traum schon spätestens Ende des 19. Jahrhunderts ausgeträumt war und die Lebenswelt des Bildungsbürgertums in der massendemokratischen Industriegesellschaft des 20. Jahrhunderts bis auf wenige subventionierte Inseln untergegangen ist; als kleinbürgerliches Persönlichkeitsideal wird er weiter gepflegt, obwohl er ironischerweise gerade von jenen am heftigsten attackiert wurde, die ihn nach gängiger Vorstellung am reinsten verkörperten: von den Mandarinen der deutschen Philosophie. So hatte Nietzsche schon in »Die Zukunft unserer Bildungsanstalten« die klassische Bildung eine »anspruchsvolle Illusion« genannt, die als »eine Art von Zauberei angesehen« werde, die aber »nichts bewirke außer Befreiung vom Militärdienst und Doktortitel«, und in der Spätschrift »Morgenröte« von 1886 heißt es im Aph. 195, unsere Erzieher führten uns der sogenannten klassischen Bildung anstatt der Erkenntnis der Dinge entgegen; er nennt dort die klassische Bildung eine »Vergeudung unserer Jugend«. Für Karl Löwith hat der Begriff »Bildung« einen »mystisch verblasenen Charakter«, und nach Helmuth Plessner zeichnet ihn eine »trächtige Fülle und ein seelenhaftes Pathos« aus. Für den jungen Carl Schmitt ist die Rede von »Bildung« und »Kultur« eine epigonale Erscheinung des verflossenen liberalen Zeitalters, und er mokiert sich schon vor 1914 über die geistige Atmosphäre des Fin de siècle, das heute als Bildungsparadies der »Welt von Gestern«. (Stefan Zweig) glorifiziert wird, in der nach seinen Worten »die Luft voll ist von bedeutsamen Redensarten und große Worte wie Kultur, Kritik und Leben einem von allen Seiten um die Ohren schlagen. Aber es geht den meisten mit diesen wichtigen Dingen wie Don Ottavio (in Mozarts Don Giovanni) mit seiner Ehre und seiner Kraft: Die Ehre erkennt man nur daran, daß er beständig schwört; die Kraft läßt sich nur aus den zahlreichen Gebeten um Kraft erschließen«.
Daß es sich bei dieser Kritik am humanistischen Bildungsideal nicht allein (wie bei diesem selbst) um ein Phänomen des deutschsprachigen Raumes handelt, sondern daß sie mit gleicher Vehemenz sich etwa auch in Frankreich äußerte, das mit den Grandes écoles nicht in einer wie immer modifizierten Humboldt-Tradition steht, möchte ich nur an Äußerungen zweier französischer Denker deutlich machen, die ansonsten verschiedener nicht sein könnten:
Unter dem Stichwort »Erziehung« notierte Paul Valéry in seinen »Cahiers« Mitte der 1930er Jahre: »Die Bezeichnung ›Humaniora‹ versetzt mich in Wut. Die Anmaßung, die darin steckt; die Vagheit, mit der man sie definiert; die offenkundigen Auswirkungen des Wertes, den man ihr beimißt, sind schuld an meiner Reaktion […] Latein, Griechisch, Geschichte – Vergangenes – tot. – Die Allgemeinbildung, die ›allgemeinen Ideen‹ haben zur Folge, daß man keinen Kohl mehr von einer Rübe unterscheiden kann.« Und Michel Foucault sagte in einem Interview im Jahre 1968: »Das am meisten belastende Erbe, das uns aus dem 19. Jahrhundert zufällt – und es ist höchste Zeit, uns dessen zu entledigen –, ist der Humanismus. […] Der Humanismus ist ein Verfahren gewesen, das mit Begriffen wie Moral, Wert und Versöhnung Probleme löste, die zu lösen man überhaupt nicht imstande war. […] Den Menschen zu retten, den Menschen im Menschen wiederzuentdecken […] all diese geschwätzigen, zugleich theoretischen und praktischen Unternehmungen […] die vor lauter Humanismus seit Jahren die gesamte geistige Arbeit zur Sterilität verdammt haben. […] Unsere Aufgabe ist es, uns endgültig vom Humanismus zu befreien. […] All diese Herzensschreie, all diese Ansprüche der menschlichen Person, der Existenz sind abstrakt: d. h. abgeschnitten von der wissenschaftlichen und technischen Welt, die nämlich unsere wirkliche Welt ist. Was mich gegen den Humanismus aufbringt, ist der Umstand, daß er nur noch der Wandschirm ist, hinter den sich reaktionärstes Denken flüchtet, hinter dem ungeheuerliche und undenkbare Bündnisse geschlossen werden. […] In wessen Namen? Im Namen des Menschen! Wer würde es wagen, Schlechtes über den Menschen zu sagen!«
III.
Trotz all dieser Kritik hat das humanistische Bildungsideal als rhetorische Pathosformel in akademischen Festreden und in der Formelsprache der Bildungspolitik sich bis auf unsere Tage erhalten. Und mit dieser Pathosformel erhalten hat sich eine ganze Familie bildungspolitischer Termini, die alle Reformdebatten der Schul- und Hochschulpolitik ideologisch überformt. Zu dieser Familie gehört das Dual Bildung versus Ausbildung ebenso wie die Einheit von »Forschung und Lehre« sowie ganz allgemein die Berufung auf Humboldt und sein berühmtes Plädoyer für »Einsamkeit und Freiheit«; zu der schon älteren Unterscheidung zwischen allgemeinbildenden höheren Schulen und berufsbildenden Schulen kommt neuerdings die zwischen Universitäten und Fachhochschulen, nachdem alle ehemaligen Hochschulen, gleichgültig welcher Richtung und wie fachkonzentriert sie immer sein mögen, ob künstlerisch, technisch, merkantil oder agrarisch, zu Universitäten promoviert worden sind; die ehrwürdigen medizinischen Fakultäten wurden sogar als einzelne zu ganzen Universitäten erklärt; der Sache nach sind sie natürlich reine Fachhochschulen. Zwischen den Fachhochschulen und den Universitäten spielt sich heute auf tertiärer Ebene das gleiche Status- und Prestigegerangel ab wie seinerzeit zwischen den berufsbildenden Schulen und den Gymnasien, was staatliche Berechtigungen und soziales Ansehen betrifft. Letztere zehren dabei immer noch von einem lange schon semantisch entleerten Bildungsversprechen, während ersteren die ideologisch geringer valorisierte Ausbildungsfunktion zugeschrieben wird. Diese Rangordnung wird sich allerdings sehr rasch ändern, die Positionen werden sich nicht nur angleichen, sondern invertieren, und zwar nicht nur deshalb, weil die Fachhochschulen aus organisatorischen Gründen die besseren Studienbedingungen zu bieten in der Lage sind, sondern vor allem auch, weil sie bildungsideologisch viel weniger belastet und daher wesentlich flexibler sind; das war letztlich sogar das Motiv für ihre Gründung: Sie werden, wenn man so sagen will, die künftigen Eliteeinrichtungen sein und nicht die Universitäten; so wie es heute schon die berufsbildenden höheren Schulen im Sekundarbereich sind. Tatsächlich wird ja auch an den Universitäten nichts anderes als »Ausbildung« betrieben, nur unter schlampigeren Verhältnissen und auch in Fächern, nach denen nicht notwendigerweise eine ökonomische Nachfrage besteht; und geforscht wird auch schon an den Fachhochschulen. Wenn heute von Universitäten ein Bildungskanon in Anspruch genommen wird, von dem kein Mensch mehr sagen kann, worin er eigentlich besteht, so widerspricht dieser Anspruch sogar den ursprünglichen Humboldtschen Ambitionen, denn nach diesen hätte der institutionell vermittelte Bildungsprozeß mit dem Abitur bzw. der Matura abgeschlossen sein sollen; die damals neue Philosophische Fakultät hatte ihre vormalige propädeutische Funktion an die reformierten Gymnasien abgegeben, und was danach folgte, war Ausbildung in den neuen Wissenschaftsdisziplinen, wie an den vor-Humboldtschen Universitäten die Ausbildung der Theologen, der Juristen und der Mediziner in den drei klassischen Fakultäten. Das meistzitierte Prinzip der sogenannten Humboldtschen Universität, die Einheit von Forschung und Lehre, findet sich gar nicht in den Schriften Humboldts, sondern es ergab sich vielmehr als Parole aus der umwälzenden allgemeinen Wissenschaftsentwicklung im 19. Jahrhundert. Entscheidend dafür war deren atemberaubende Dynamisierung und ihre zunehmende Ausdifferenzierung in Disziplinen, was die Aufrechterhaltung statischer Lehrbestände unmöglich machte. Ein ähnlicher Prozeß hin zum »forschungsgeleitenden Lernen«, das als charakteristisches Monopol universitären Studiums gilt, wird sich auch an den Fachhochschulen durchsetzen und ist auch schon im Gang. Von einer »Einheit von Forschung und Lehre« allerdings kann, wenn sie denn jemals Realität war, schon lange nicht mehr die Rede sein. Allenfalls finden beide sich vereint unter einer gemeinsamen organisatorischen Klammer, sind aber curricular aufgespalten in eine berufsausbildende Lehre und eine forschungsorientierte Phase für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Universitäre »Bildung« aber in einem nichtideologischen Sinn ist, insofern sie überhaupt institutionell vermittelt werden kann, ein Kollateraleffekt von »Ausbildung« – sie ist eine Funktion von deren Intensität, d. h. von dem Maß der Versenkung in eine Sache als Problem, die über ihre bloße Aneignung als Stoff hinausgeht; das zwingt nolens volens oft genug zu »Interdisziplinarität«, die als solche keineswegs ein Wert an sich ist. (Tatsächlich leidet heute ein Großteil der universitären Qualifikationsarbeiten, insbesondere in den Geisteswissenschaften, daran, daß sie nicht ein Problem traktieren, sondern ein Thema besprechen, was nicht selten zu einer leeren Geschwätzigkeit führt. Die Bologna-Reformen mit ihrer Verbilligung von akademischen Erstabschlüssen und ihrer ECTS-Monetarisierung von Qualifikationsnachweisen werden diesen Zug zur »Entproblematisierung« des Studiums nur weiter verstärken – durch Modularisierung und äußerliche Vereinheitlichung der Curricula, die alle Eigenwilligkeiten abschleift und die Formierung konkurrierender »Schulen« diskreditiert.)
Die Hochschulhistoriker verweisen darauf, daß der eigentliche Humboldt ein ideologisches Produkt der 1960er Jahre ist. Um diese Zeit wurde der »Mythos Humboldt«, den Eduard Spranger 1910 zur Hundertjahrfeier der Berliner Universität kreiert hatte, gegen die unmittelbar bevorstehende Massenuniversität mobilisiert, und zwar pikanterweise sowohl von linker studentischer als auch von konservativer professoraler Seite. Verteidigten letztere eindeutig definierbare Standesinteressen, so verfolgten erstere vage gesellschaftspolitische, jedenfalls antikapitalistische Ideen und Ideale und lehnten daher jede Ökonomisierung und Orientierung der Universitäten an wirtschaftlichen Zielen ab; eine der Konsequenzen dieser »gegenstrebigen Fügung«, wie Jacob Taubes sich ausgedrückt hätte, sind, wie schon gesagt, die Fachhochschulen.
Dabei war die Vorstellung von der Einheit der Wissenschaften unter einem gemeinsamen philosophischen Dach, wie der Humboldt-Mythos sie beschwor, schon für Humboldts eigene Zeit realitätsfremd – das traurige Schicksal etwa von Hegels Naturphilosophie angesichts der Erfolge der empirisch-mathematischen Naturwissenschaften beweist das zur Genüge. Jeder Versuch einer synthetisch-harmonisierenden Vereinheitlichung in ein »System« kann auf die Eigendynamik analytisch-kombinatorischer Denkweisen, die die modernen Wissenschaftsdisziplinen auszeichnen und diese in oft durchaus divergierende Richtungen treiben, nur erkenntnishemmend wirken. Und was die sogenannten philosophischen bzw. erkenntnistheoretischen Grundlagen der Einzelwissenschaften betrifft, so hat sich gezeigt, daß diese ihre epistemologischen Krisen immer noch selbst am besten lösen können. So hatte z. B. die Schulphilosophie zur Revolutionierung der Raum-Zeit-Metrik durch die Allgemeine Relativitätstheorie praktisch nichts zu sagen, und die Kopenhagener Deutung der Quantenmechanik haben Physiker ausschließlich untereinander ausgemacht; ein Hilferuf an die akademisch etablierte Philosophie ist nicht bekannt geworden – und dies, obwohl es dabei doch um ihre kategorialen Kernbestände ging: Raum, Zeit, Materie, Kausalität. Eine analoge Situation haben wir heute bei den Debatten um »Willensfreiheit«; da stehen die Erkenntnisse der Neurophysiologie gegen die Einsprüche notorischer Wertebewahrer und humanistischer Menschenbildretter. Wenn das so weitergeht, verkommt die akademische Philosophie vollends zur Lebensberatung für sinnsuchende Schwiegermütter und zum Themenreservoir für Late-Night-Talkshows auf 3sat und Arte.
Will man einer solchen Entwicklung Einhalt gebieten, so gilt es, hochschulpolitisch einer Einsicht Geltung zu verschaffen, die der Erziehungswissenschaftler Heinz-Elmar Tenorth von der Humboldt-Universität zu Berlin präzise auf den Punkt gebracht hat: »Die universitäre Bildung der Persönlichkeit kann […] nur in der fachlichen Qualifizierung gelingen, nicht außerhalb, auch nicht durch hinzutretende Ethisierung und Politisierung der universitären Lebens- und Berufsform. Wissensbestände aus der Tradition der Humaniora, also gymnasialer Allgemeinbildung, in die Universität einzuführen, um Bildung zu erreichen – das führt zurück in vormoderne Zeiten, verständlich vielleicht als Elitensozialisation, dem Anspruch von Bildung durch Wissenschaft aber nicht angemessen.«
Darmowy fragment się skończył.