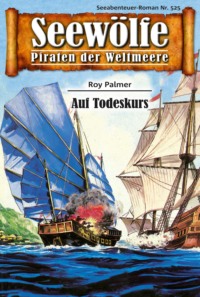Czytaj książkę: «Seewölfe - Piraten der Weltmeere 525»
Impressum
© 1976/2019 Pabel-Moewig Verlag KG,
Pabel ebook, Rastatt.
eISBN: 978-3-95439-933-8
Internet: www.vpm.de und E-Mail: info@vpm.de
Roy Palmer
Auf Todeskurs
Sie sind gefährlicher als Hammerhaie – doch Hasard stellt die gelben Ratten …
Vinicio de Canares wünschte sich, einzuschlafen und nicht wieder aufzuwachen. Das war die beste Todesart. Daß er sterben würde, stand außerhalb jeglichen Zweifels. Wenn ihn aber die Kerle holten, dann würde das Ende gräßlich ausfallen – für ihn und für seine sechs Kameraden.
Die Kerle zeterten und schnatterten wieder über ihren Köpfen. Sie ließen ihren Gefangenen keine Ruhe. Ständig dachten sie sich neue Schikanen aus. Mal bespuckten und beschimpften sie ihre Gefangenen, mal peitschten sie mit dünnen Gerten drauflos oder bearbeiteten ihre Fußsohlen mit Stöcken.
Der Fraß, den die Chinesen ihren Opfern vorsetzten, war nicht zu genießen. In der Suppe schwammen Würmer, das Wasser war schmutzig und stank nach Fäulnis.
Die Hauptpersonen des Romans:
Fong Chen Huan – Der Anführer einer Sekte von Fanatikern hat sich Chimion, dem Affengott, verschrieben und opfert ihm „fremde weiße Teufel“.
Pol Pot – Der Glatzkopf ist die rechte Hand von Fong, was seinen Meister aber nicht hindert, ihm Fußtritte zu verpassen.
Vinicio de Canares – Dem Portugiesen gelingt die Flucht von Bord der Dschunke des Fong Chen Huan.
Philip Hasard Killigrew – Der Seewolf und seine Arwenacks bekommen es wieder mit chinesischem „Feuerwerk“ zu tun und müssen sich ihrer Haut wehren.
Edwin Carberry – Der Profos kontrolliert die Gewürze aus Davao und muß mächtig niesen.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
1.
De Canares blickte im Dunkel des engen Schiffsraumes sein Gegenüber an, den jungen Joan Marinho. Marinho war erst sechzehn. Er litt am meisten unter den Grausamkeiten. Lange würde er nicht mehr durchhalten, das wußte de Canares. Aber wer von ihnen hatte noch die Energie, diesen Teufeln in Menschengestalt zu trotzen?
Lareto sprach kein Wort mehr. Er stierte nur vor sich hin. Toninho war in wenigen Tagen zu einem Wrack geworden. Nicht besser ging es Rodrigo und Costales. Und Barilla, dieser Riese von Kerl? Auch ihn hatten sie an Leib und Seele gebrochen. Zuerst hatte er Widerstand geleistet. Dafür hatten sie ihn grün und blau geprügelt. Jetzt wagte er nicht mehr, sich zur Wehr zu setzen.
„He“, sagte de Canares mit heiserer Stimme. „Von diesem Dreck hat uns keiner was erzählt, als wir auf dem Elendskahn angeheuert haben, was?“
„Hör auf“, erwiderte Joan Marinho. „Ich will von der ‚Sao Paolo‘ nichts mehr wissen.“
„Ja, halt’s Maul, Vinicio“, sagte nun auch Barilla.
„Ich will aber nicht schweigen“, sagte de Canares. „Und ich möchte, daß ihr euch immer wieder auf das eine besinnt. Wir müssen hier raus. Wir müssen de Norimbergo fassen. Koste es, was es wolle. Und wenn wir ihn um die ganze Welt jagen müssen.“
„Fängst du wieder mit der Leier an?“ murmelte Costales.
„Alles Quatsch“, brummte Toninho. „Den Capitán sehen wir nicht wieder. Wir verrecken hier wie die Ratten.“
„Laßt mich weitersprechen“, sagte de Canares.
„Tu, was du willst“, entgegnete Barilla. „Aber es nutzt nichts. Wir sollten den Tatsachen ins Auge sehen.“
„Das tue ich auch“, entgegnete de Canares. „Ich bin noch nie im Leben von einem Kerl so angeschissen worden wie von de Norimbergo. Er hat uns alle verraten und verkauft.“
„Als wir ihn in Lissabon getroffen haben, hätten wir nicht so gutgläubig sein sollen“, sagte Costales mit müder, brüchiger Stimme. „Er hat uns beschwatzt. Es ist unsere eigene Schuld.“
Barilla schnaufte zornig. „Da bin ich aber anderer Meinung. De Norimbergo hat uns allen was vorgegaukelt. Auch die älteren Seeleute an Bord des verfluchten Seelenverkäufers haben nicht gewußt, was eigentlich los war.“
Marinho seufzte. „Als uns die Augen aufgingen, war es zu spät.“
„Im ersten Sturm soff der Kahn fast ab“, sagte de Canares, vor dessen geistigem Auge die Geschehnisse noch einmal abliefen. „Wir haben Glück gehabt, daß wir überhaupt lebend hier in China angekommen sind.“
„Besser wär’s gewesen, wenn wir abgesoffen wären“, meinte Toninho. „Oder an der Ruhr krepiert wie die fünf armen Schweine, die wir in die See geworfen haben.“
„Einer hatte Skorbut“, sagte Barilla. „Und Skorbut kriegt man, wenn die Bordverpflegung nicht reichhaltig genug ist. Alles die Schuld von de Norimbergo, diesem Hundesohn!“
„Der Teufel soll ihn holen“, zischte Rodrigo. „Dem Drecksack wünsche ich die Pest an den Hals!“
„Wer konnte auch ahnen, daß er die verrottete ‚Sao Paolo‘ in Macao hinter unserem Rücken verhökert, von dem Geld ein kleineres Schiff kauft und mit nur drei Mann wieder abhaut, ohne uns die Heuer zu zahlen“, sagte de Canares. „Ich hätte es ihm nicht zugetraut. Trotz allem schien er ein ordentlicher Kapitän zu sein.“
„Ein Blender!“ stieß Barilla aufgebracht hervor. „Das sind die Schlimmsten! Wenn ich ihn kriege, drehe ich ihm ganz langsam den Hals um!“
„Da saßen wir nun in Macao“, murmelte Joan Marinho. „Ohne Geld, ohne Arbeit. Ohne Schiff. Keiner wollte uns haben. Wir haben es ja überall versucht. Kein Kapitän wollte uns in seine Musterrolle aufnehmen.“
„Und die Gardisten“, sagte Costales. „Habt ihr die vergessen? Die haben uns ja ständig belauert. Wenn man da zu lange herumlungert, sperren sie einen ein.“
„Wenn wir doch bloß eine Heuer auf einer lausigen Gemüse-Dschunke gefunden hätten“, sagte de Canares. „Damit wäre uns ja schon geholfen gewesen. Wir wären nach Shanghai getörnt, und da hätten wir schon eine neue Arbeit gekriegt.“
„Hoffentlich stimmt das überhaupt“, brummte Barilla. „Der Kerl, der uns das in Macao erzählt hat, war wahrscheinlich auch so ein Lügner. Ich glaube keinem mehr.“
„In Shanghai erhält man leichter eine Heuer als in Macao“, sagte Rodrigo. „Das hat mir sogar in Lissabon mal ein alter Seemann verraten.“
Toninho entgegnete: „Vergiß es. Was nutzt es noch? Wir erreichen Shanghai nicht mehr.“
„Ausgerechnet diesen Zopfmännern mußten wir in die Hände fallen“, klagte Marinho.
„Es war schon waghalsig von uns, zu Fuß nach Norden aufzubrechen“, sagte Toninho. „Was haben wir uns denn eingebildet? Na schön, aus Macao kamen wir einfach nicht weg. Aber zu Fuß nach Shanghai latschen? Lachhaft! Das hätten wir nie geschafft. Wir hätten den ersten Kahn, den wir in irgendeinem lausigen Fischernest entdeckt hätten, geklaut, das schwöre ich euch.“
„Deswegen sind wir noch lange keine Galgenstricke“, erwiderte de Canares. „Wir hätten aus einer Notlage heraus gehandelt.“
„Hätten, hätten“, sagte Barilla verächtlich. „Was nutzt das jetzt noch? Die Zopfmänner haben uns geschnappt. Wir sind ihnen regelrecht in die Arme gelaufen.“
„Sie hatten uns eine Falle gestellt“, sagte Costales. „Sie müssen uns schon eine Weile im Dschungel belauert haben. Dann sind sie uns nachgeschlichen und haben uns niedergeschlagen und an Bord ihrer verdammten Dschunke geschleppt.“
„Und da hocken wir nun mehr tot als lebendig“, sagte Rodrigo. „Alles Reden hat keinen Sinn. Die Hunde werden uns abmurksen.“
„Wer sind sie?“ fragte Marinho mit bebender Stimme. „Gehören Sie zur chinesischen Marine? Gibt es hier so was überhaupt?“
„Nicht in dem Sinne wie bei uns“, entgegnete de Canares. „Und die gelben Hurensöhne sind keine Soldaten des Kaisers, da bin ich sicher.“
„Also doch Piraten, wie ich vermutet habe“, sagte Barilla.
„Auch das nicht“, meinte de Canares.
„Was dann, zum Henker? Dämonen? Blutsauger?“
„Ich halte sie für Fanatiker“, erklärte de Canares. „Habt ihr nicht das Bildnis gesehen, das sie oben an die Wand der Hütte gemalt haben?“
„Pfui Teufel“, sagte Toninho. „So was Scheußliches habe ich noch nie gesehen.“
„Was soll das sein?“ fragte Costales. „Ein Ungeheuer.“
„Ein Affe“, erwiderte de Canares. „Ich vermute, sie verehren ihn als eine Art Götzen.“
„Heiden“, sagte Barilla. „Wahrscheinlich sogar Kannibalen. Die fressen uns auf, sage ich euch.“
„O Gott, nein“, flüsterte Marinho. Er bekreuzigte sich.
„Der Anführer heißt Fong Chen Huan“, fuhr de Canares fort. „Ich habe gehört, wie die Chinesen diesen Namen genannt haben. Mehr kann ich aber auch nicht verstehen. Sicher ist aber, daß dieser Fong ein blutrünstiger Fanatiker ist.“
„Der uns allen die Gurgeln durchschneiden wird“, brummte Barilla. „Das ist das Ende vom Lied. Na schön, Vinicio, du bist der schlauste von uns. Nicht umsonst hast du’s zum Bootsmann gebracht. Aber was nutzt es uns noch, zu wissen, daß die Kerle irgendeiner verrückten Sekte angehören? Nichts.“
„Sie sind Fremdenhasser“, sagte de Canares. „Ich glaube, sie verfolgen alle Weißen, die hier auftauchen. Vielleicht wollen sie ihr Land von Ausländern säubern.“
„Wahnsinn“, murmelte Rodrigo. „Aber so, wie du es sagst, könnte es schon sein, Vinicio. Das bedeutet, wir sind nicht die ersten, die von diesen Verrückten verschleppt werden.“
„Und wir werden auch nicht die letzten sein“, murmelte de Canares.
Kurze Zeit darauf stellte sich heraus, daß Vinicio de Canares sich nicht täuschte. Das Gezeter der Chinesen an Oberdeck der dreimastigen Dschunke hatte dieses Mal nicht den Zweck, die Gefangenen zu peinigen.
Fong Chen Huan und seine dreißig Kerle hatten ein Boot gesichtet, das in der See trieb. An Bord befanden sich zwei erbärmliche Gestalten – weiße Männer.
Fong ließ Kurs auf das Boot nehmen.
Fong Chen Huan rieb sich mit höhnischem Grinsen die Hände und entblößte seine weißen Zähne. Sein Blick war auf das Boot mit den Fremden gerichtet. Weiße Teufel, dachte er.
Nur etwas mehr als fünf Fuß groß war Fong. Sein Äußeres wirkte eher schwächlich. Er war mager und schien nur aus Knochen zu bestehen. Selbst sein sichelförmiger Schnauzbart war dürr. Aber der erste Eindruck auf Menschen, die ihn nicht kannten, täuschte über sein wahres Wesen.
Fong steckte voller Willenskraft, suggestiver Macht und Grausamkeit. Er war der Inbegriff des charismatischen Führers. Selbst der größte und wildeste Kerl wagte nicht ihm zu trotzen. Fong brach jeglichen inneren Widerstand bei anderen Menschen. Außerdem beherrschte er die Fähigkeit der Hypnose.
Kein Zweifel, die Fremden in dem Boot waren Schiffbrüchige. Als sie sahen, daß die Dschunke auf sie zusteuerte, hoben sie die Hände und winkten. Ihre Bewegungen waren müde und schwach. Sie mußten schon längere Zeit in ihrer Jolle zugebracht haben.
Fong warf einen langen Blick durch sein Spektiv und erkannte, daß das Boot weder über Riemen noch über ein Segel verfügte. Es trieb in der See. Weit war die Küste nicht mehr entfernt, aber man konnte sie nicht sehen. Die beiden weißen Männer ahnten also nicht, daß die Rettung viel näher war, als sie wahrscheinlich annahmen.
Sie ahnten auch nicht, daß sie an Bord der Dschunke alles andere als Hilfe erwartete. Welcher Pirat zeigte schon Interesse an zwei erbarmungswürdigen Wesen, die kaum noch einen Fetzen auf dem Leib hatten?
Fong ließ das Spektiv sinken und lachte leise. Er kannte das. Die Dschunke wirkte äußerlich so harmlos wie ein Frachtsegler. Das war eine vorzügliche Tarnung.
Kurze Zeit später glitt die Dschunke mit aufgeholten Mattensegeln bei dem Boot längsseits. Hände streckten sich den Schiffbrüchigen entgegen, Fongs Männer hievten die beiden an Bord. Anschließend wurde auch das Boot geborgen. Es befand sich in einem annehmbaren Zustand. Fong Chen Huan war der Meinung, daß er es gebrauchen könnte.
Die beiden Fremden – dunkelhaarige Männer mit struppigen Bärten – hatten gerade noch Zeit, sich an Deck der Dschunke umzuschauen. Sie sahen das Porträt des Affen an der Wand der Hütte – und spürten die Atmosphäre des Hasses und der Feindseligkeit, die sie umgab. Sie waren vom Regen in die Traufe geraten. Aber es war zu spät, zu fliehen.
Schon stürzten sich die Chinesen auf sie.
„Nein!“ stieß der eine Mann hervor. „Laßt mich los!“
„Was wollt ihr?“ keuchte sein Kamerad. „Wir haben euch nichts getan!“
Spanier, dachte Fong. Er trat mit verschränkten Armen auf sie zu. Seine Kerle prügelten mit ihren Peitschen auf die beiden neuen Gefangenen ein. Fong stoppte sie mit einer herrischen Gebärde.
Die Schiffbrüchigen versuchten verzweifelt, sich loszureißen, aber acht Chinesen hielten sie an den Armen fest. Sie hatten nicht die geringste Chance zur Flucht.
„Yang kuei tzû“, sagte Fong, dann übersetzte er es in die spanische Sprache: „Fremde Teufel!“ Er beherrschte sowohl Spanisch als auch Portugiesisch. Fong ging davon aus, daß der Feind am besten zu schlagen war, wenn man seine Sprache und seine Gewohnheiten kannte. „Ihr habt nicht das Recht, in unser Reich einzudringen. Ihr verseucht uns mit eurem stinkenden Atem und euren Krankheiten. Wir werden nicht dulden, daß ihr uns überrennt.“
„Wer bist du?“ schrie der eine Gefangene. „Wir kennen dich nicht! Wir befinden uns in einer Notlage! Das Gesetz der See schreibt vor, daß …“
„Euer Gesetz“, schnitt Fong ihm schroff das Wort ab, „ist das Gesetz der Teufel! Wir verachten und bespucken es. Nach unserem Gesetz seid ihr Dreck, den man vernichten muß.“
„Pedro“, sagte der zweite Gefangene. „Der ist verrückt.“
„Mann, wo sind wir hier nur gelandet?“ flüsterte sein Kamerad.
„Auf der Dschunke der himmlischen Gerechtigkeit“, erklärte Fong grinsend. „Willkommen an Bord. Ich werde euch bevorzugt behandeln lassen, weil ihr so freundlich seid.“
Der zweite Gefangene versuchte es mit einem Appell an Fong Chen Wuans Vernunft.
„Señor“, sagte er. „Mein Name ist Carlos Gerado, und das ist mein Freund Pedro Molina. Wir sind ehrliche Seeleute, keine Schnapphähne oder Plünderer, wie du vielleicht denkst. Wir führen nichts Arges im Schilde. Unser Schiff, die ‚Santa Teresa‘, ging in einem Sturm unter, und zwar südlich von Formosa.“
Fong grinste diabolisch und wies nach Osten, wo sich der Himmel schwärzlich verfärbt hatte. Der Wind hatte an Stärke zugenommen. Er jaulte durch das Riff der Dschunke und pfiff über die Köpfe der Männer.
„Und es gibt wieder Sturm“, sagte Fong. „Es braut sich was zusammen.“
„Wir sind die einzigen Überlebenden“, fuhr Carlos fort. „Unsere Kameraden, alles anständige Männer, ertranken – und mit ihnen der Kapitän.“
„Mir kommen die Tränen“, sagte Fong mit ätzender Stimme.
Pedro Molina wollte sich auf Fong stürzen, aber die Chinesen hielten ihn wie mit Eisenklammern fest. Carlos Gerado gab es immer noch nicht auf, auf Fong einzureden.
„Wir treiben seit vier Tagen in dem Boot“, sagte der Spanier. „Haben die Riemen verloren, haben kein Segel. Nichts zu essen. Unser Trinkwasser ist vorgestern zur Neige gegangen. Wir sind völlig fertig. Ich flehe dich an, Señor, setze uns an der Küste ab. Wir werden nach Macao laufen. Irgendwie schlagen wir uns schon durch.“
„Niemals“, entgegnete Fong. „Ihr würdet unsere Kinder erschlagen und unsere Frauen vergewaltigen. Ihr seid Bestien!“
„Was?“ schrie Pedro Molina außer sich vor Wut. „Du bist hier die Bestie! Du Hund!“ Er trat mit dem rechten Fuß nach Fong, aber Fong brauchte nicht einmal auszuweichen. Die Kerle rissen den Seemann zurück. Fong gab ihnen wieder ein Zeichen, und sie prügelten fluchend und zeternd auf den Spanier ein.
Carlos Gerado trachtete, seinem Freund beizustehen, aber auch er hatte nicht die geringste Chance gegen die Übermacht. Unter Peitschen- und Stockhieben landete er auf den Planken.
Molina blieb keuchend auf dem Rücken liegen. Fong gab seinen Kerlen den Befehl, wieder von ihm abzulassen. Sie hielten den Spanier nur noch an den Armen und Beinen fest, damit er sich nicht rühren konnte. Fong beugte sich über ihn.
Pedro Molina sah Fong haßerfüllt an. Ihre Blicke begegneten sich und verfingen sich ineinander. Plötzlich weiteten sich die Augen des Spaniers. Er fühlte sich davongetragen – weit weg, und er glaubte, zu fliegen. Wie aus großer Ferne vernahm er die hämische Stimme des Chinesen.
„Wer bin ich, du Narr?“
„Mein Herr“, murmelte Molina.
„Und du?“
„Ein fremder weißer Teufel.“
„Wirst du unser Gesetz achten?“ fragte Fong.
„Ich höre auf dein Wort, o Herr“, antwortete der Spanier.
„Endlich bist du vernünftig“, sagte Fong. Er lachte, und auch seine Kerle lachten. „Schafft ihn weg“, ordnete Fong an. „Und versorgt auch den anderen. Ich will sie nicht mehr sehen. Gebt ihnen zu essen und zu trinken.“
Pedro Molina war hilflos wie ein Kind und ließ alles willenlos mit sich geschehen. Carlos Gerado unterdrückte nur mit Mühe ein Stöhnen, als die Chinesen ihn hochhoben und wegtrugen. Er krümmte sich vor Schmerzen. Es flirrte vor seinen Augen. O mein Gott, dachte er, steh mir bei.
Aber Gerado fragte sich auch, was mit seinem Freund geschehen war. Was hatte der Chinese mit ihm angestellt? Hatte er ihn verzaubert? War denn hier alles verhext?
Fongs Spießgesellen warfen die beiden Spanier in einen düsteren Schiffsraum – gleich neben dem, in dem die sieben Portugiesen zusammengepfercht waren. Ein dürrer Chinese eilte kichernd heran und schob den Gefangenen Schalen mit undefinierbarem Inhalt zu. Dann krachte das Schott zu, und Molina und Gerado waren ihrem Schicksal überlassen.
Carlos Gerado beugte sich über die Schalen. Der Gestank, der ihm entgegenschlug, ließ ihn wieder hochfahren. Elendsfraß, dachte er. Wenigstens das Wasser wollte er trinken. Aber es stank wie faule Eier. Trotz seines Durstes rührte er es nicht an.
„Dreck“, sagte Gerado. „Wir sind am Ende.“
Dann hörte er nebenan Stimmen.
Darmowy fragment się skończył.