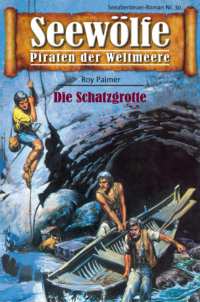Czytaj książkę: «Seewölfe - Piraten der Weltmeere 30»
Impressum
© 1976/2013 Pabel-Moewig Verlag GmbH,
Pabel ebook, Rastatt.
ISBN: 978-3-95439-272-8
Internet: www.vpm.de und E-Mail: info@vpm.de
Inhalt
Kapitel 1.
Kapitel 2.
Kapitel 3.
Kapitel 4.
Kapitel 5.
Kapitel 6.
Kapitel 7.
Kapitel 8.
Kapitel 9.
Kapitel 10.
1.
Der Kutscher atmete ein paarmal tief und heftig durch, dann drang ein Fluch über seine Lippen. Eigentlich war das bei ihm schon etwas Besonderes, denn schließlich hatte er bei Sir Freemont in Plymouth gedient und sich gute Manieren beibringen lassen. Gewöhnlich benahm er sich weniger ungehobelt als die anderen Männer der Seewolf-Crew. Kurzum, es mußte schon ganz dick kommen, um ihn aus dem seelischen Gleichgewicht zu werfen und auf die Palme zu schicken. Heute war das der Fall. Sein Gemütszustand drohte aus der Balance zu geraten. Aber nicht, weil die „Isabella III.“ einen Sturm zu überstehen oder sich gegen eine Übermacht von spanischen Kriegsgaleonen zu behaupten hatte – nein, es ging ihm nur ganz entschieden gegen den Strich, was die Deckskameraden mit ihm vorhatten.
„Stell dich nicht an wie eine Jungfrau“, sagte Blacky. „Wir müssen dich über Bord schmeißen. Je weniger Aufstand du dabei machst, desto besser für dich.“ „Das ist ein dicker Hund“, protestierte der Kutscher. Seine Lippen preßte er zu einem Strich zusammen. Seine blauen Augen funkelten angriffslustig. „Warum immer ich? Ihr wißt genau, daß ich das Schwimmen immer noch nicht gelernt habe. Damals vor der Mocha-Insel mußte ich auch herhalten. Aber das war ja noch was anderes, das hab ich für Matt Davies und Pete Ballie getan. Aber jetzt schon wieder – nee, da müßt ihr euch einen anderen suchen.“
Er schob die Ärmel hoch, griff nach einem auf Deck liegenden Dweil und streckte ihn vor. Das Ding war zum Deckschrubben bereitgestellt worden, aber der Kutscher funktionierte es jetzt in eine Waffe um. Er war ein bißchen schmalbrüstig, aber doch zäh. Im Kampf stand er durchaus seinen Mann.
„Hör doch auf“, erwiderte Blacky. Er stand zwei Schritte vom Kutscher entfernt am Backbordschanzkleid. Neben ihm war Buck Buchanan, der mit zupacken sollte. Buck gehörte zu den ehemaligen Karibik-Piraten an Bord der „Isabella“. Von den Ereignissen auf der Mocha-Insel wußte er wenig. Damals waren er und seine Kameraden noch nicht bei der Seewolf-Mannschaft gewesen, und sie hatten nur ansatzweise in Erzählungen vernommen, auf was der Kutscher anspielte: Pete Ballie und Matt Davies waren seinerzeit von den Araukanern gefangengenommen worden. Ed Carberry und andere „Verschwörer“ hatten einen Unfall fungiert, damit sie einen Vorwand hatten, entgegen Francis Drakes Anweisungen, zur Insel zu gelangen, um Pete und Matt herauszuhauen. Der Kutscher war also mit einem Abfallkübel in die See gestürzt und dann von den Freunden „gerettet“ worden.
„Eben daher wissen wir ja, daß du deine Aufgaben immer gewissenhaft durchführst, selbst, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht“, fuhr Blacky fort. Die Ironie in seiner Stimme war kaum zu überhören. An Bord der „Isabella“ herrschte nicht gerade Idealstimmung, und das verwandelte ihn in eine Art gereizten Stier. „Los, komm jetzt, sei kein Frosch.“
„Warum ausgerechnet ich?“ sagte der Kutscher starrsinnig.
Blacky schaute zur Großmarsstenge hoch, als stünde dort eine präzise Antwort auf die Frage. Mit erzwungener Geduld entgegnete er: „Weil Hasard es so befohlen hat. Weil es so echt wie möglich aussehen soll. Weil man eine verlauste Landratte flinker aus dem Wasser zieht, wenn sie tatsächlich nicht schwimmen kann und jeden Augenblick abzusaufen droht.“
„Verlauste Landratte?“ Der Kutscher zeigte grimmig die Zähne. „Kommt her und holt euch ab, was der Nichtschwimmer euch um die Ohren zu hauen gedenkt.“ Wütend schwenkte er den Dweil hin und her. Die Lappen klatschten bedrohlich.
Buchanan grinste jetzt. „Hör auf, den wilden Mann zu spielen, Kutscher. Du weißt ganz genau, daß der Seewolf immer noch geladen ist und uns deshalb Feuer unterm Hintern macht. Wir tun gut daran, zu kuschen. Ich hab jedenfalls keine Lust, wegen Befehlsverweigerung an der Rahnock aufgebaumelt zu werden oder mir den Kopf abreißen zu lassen.“
„Ha!“ sagte der Kutscher. „Weil der Seewolf auf euch sauer ist, wollt ihr eure aufgestaute Wut jetzt an mir auslassen, wie? Das könnte euch so passen! Geschieht euch ganz recht, daß ihr wegen der Ausschreitungen in Culebra hart herangenommen werdet. Da lernt ihr, was es heißt, sich bei den Weibern zu verausgaben und den Mund zu voll zu nehmen.“
„Jetzt hört aber alles auf“, gab Blacky zurück. „Du verlauster Kombüsenhengst warst doch auch mit auf Landgang und hast eine dralle Hafenhure vernascht, oder? Also, was spuckst du so große Töne? Mitgefangen, mitgehangen. Stell den Dweil weg und ergib dich.“
„Nein. Ich habe in Culebra keinen Streit vom Zaun gebrochen.“
„Wir auch nicht.“
„Nein, aber ...“
„Laß Gordon Watts aus dem Spiel“, sagte Buchanan drohend. „Der liegt auf dem Grund der See und tut keiner Fliege mehr was. Was passiert ist, läßt sich nicht mehr rückgängig machen.“
Der Kutscher blickte verwirrt. Er begriff, daß er einen Schritt zu weit gegangen war. Natürlich wollte auch er einem Toten nichts Schlechtes nachreden, es tat ihm leid, daß er in seiner Empörung die falschen Worte gewählt hatte. Er stand noch unschlüssig mit dem erhobenen Dweil, da turnte Dan O’Flynn vom Quarterdeck, lief quer über die Kuhl und steuerte auf sie zu. Unter den Luvhauptwanten stoppte er. Der handige Nordostwind fuhr in seine blonden Haare und zerzauste sie. Grinsend hob er hoch, was er in den Händen hielt, zielte, rief: „Ho, Kutscher!“ und warf es dem Verdatterten zu.
Der Kutscher handelte instinktiv. Er ließ den Dweil los. Der fiel klappernd auf Deck. Unterdessen fing er Dans Geschoß auf und wog es verdutzt in den Händen. Es war ein Fender, ein dicker, mit Tauwerk bespannter Holzknüppel, der normalerweise zum Schutz der Schiffswand diente.
„Den umarmst du“, sagte Dan. „Holz schwimmt oben, deswegen sind unsere Schiffe auch aus Holz gebaut ...“
„Das weiß ich!“ rief der Kutscher. Er wollte wieder lautstarken Protest erheben, aber plötzlich ging alles sehr schnell. Blacky und Buck Buchanan hatten seine Unschlüssigkeit ausgenutzt und sich näher an ihn herangeschlichen. Jetzt packten sie zu. Der Kutscher schrie auf. Er wollte um sich schlagen, aber das ging nicht, weil die beiden ihn festhielten wie in einem Schraubstock. Er trat ihnen gegen die Schienbeine, aber das ignorierten sie. Flink trugen sie ihn bis ans Schanzkleid, hoben ihn hoch und verschafften ihm einen einmaligen Ausblick auf die tiefblaue Fläche des Stillen Ozeans.
Der Kutscher hielt sich mit den Beinen an einer Rüste fest, aber das nutzte ihm auch nicht mehr viel. Dan O’Flynn kitzelte ihm ein wenig die Füße. Der Kutscher brüllte auf. Er fühlte, wie Blacky und Buck ihn losließen, dann sauste er an den Berghölzern vorbei. Die Schiffswand war eine düstere, abweisende Mauer neben ihm, und er konnte nicht mehr tun, als verzweifelt seinen Fender zu umklammern.
Er klatschte mit dem Hintern zuunterst in die Fluten, tauchte unter, schoß prustend wieder hoch, schüttelte sich wie ein nasser Hund und hielt sich an dem Fender, seiner einzigen Rettung, fest. Damals, vor der Mocha-Insel, war es ein Holzkübel gewesen. Der Fender funktionierte nach dem gleichen Prinzip. Er verhinderte, daß der Kutscher jämmerlich absoff.
Der Kutscher sah, wie die „Isabella III.“ mit prallem Zeug davonzog. Bitterkeit packte ihn. Jemand johlte zum Beifall für seine Bravournummer – es war das dreiste Bürschchen Dan O’Flynn. Na warte, dachte der Kutscher, dich kriege ich noch!
„Mann über Bord!“ brüllte Blacky.
Die Meldung wurde weitergegeben wie im Ernstfall, dann gellten Ed Carberrys Kommandos über Deck. Die Segel wurden backgebraßt. Der Rudergänger Pete Ballie ließ das Schiff über Backbordbug drehen, so daß sie eine Schleife von rund neunzig Grad fuhren und dann mit einem Kreuzschlag gegen den Wind gingen.
Philip Hasard Killigrew hatte die Hände auf die Schmuckbalustrade gelegt, die den Querabschluß des Achterkastells nach vorn bildete. Er beobachtete seine Männer und merkte sich jeden Fehler, der ihnen unterlief. Er nahm sie auf das härteste heran und duldete keine Schwächen. Er verlangte ihnen das äußerste ab, besonders den ehemaligen Karibik-Piraten.
Mitte April 1579 hatten sie Culebra in Nicaragua verlassen. Seitdem schliff er seine Crew erbarmungslos. Tagsüber purrten seine Befehle sie fast pausenlos an die Brassen und Schoten, jagten sie zu kühnsten Segelmanövern in die Wanten und bis unter die Toppnanten hinauf. Reihum wurde an Kanonen und Drehbassen exerziert. Die Zwischenzeiten, sogar die frühen Morgenstunden und die Zeit nach dem Dunkelwerden, füllte der Seewolf mit Manövern wie „Mann über Bord“ oder „Feuer im Vorschiff“ und ähnlichen Dingen aus. Jeder Mann mußte jede Station an Bord der „Isabella III.“ voll und ganz versehen können. „Rollenschwof“ nannten die Seeleute diese Art von Beschäftigung, die ihnen allmählich auf die Nerven ging und sie innerlich zum Kochen brachte.
Smoky, Stenmark, Matt Davies und Patrick O’Driscoll waren dieses Mal mit der Segelpinasse dran. Sobald der ausgesprochen wendige Zweimaster in der Nähe des „schiffbrüchigen“ Kutschers lavierte und durch geschicktes Manövrieren stoppte, fierten sie das Beiboot weg und enterten über Jakobsleitern ab, die Sam Roskill und Bob Grey die Bordwand hinabbaumeln ließen. Auch Roskill und Grey sprangen an Bord der Pinasse. Dann pullten sie auf den Kutscher zu und zogen ihn aus dem Wasser. Er fluchte jetzt, was das Zeug hielt und kümmerte sich keinen Deut mehr um die gute Erziehung, die er bei Sir Freemont genossen hatte. Da er nicht schwimmen konnte und sich im nassen Element folglich außerordentlich tolpatschig benahm, hatten die Männer auf den Einsatz der Segelpinasse nicht verzichten können. Ein guter Schwimmer hätte sich mit ein paar kräftigen Zügen selbst bis an die Bordwand der Zweimastgaleone befördert und die Jakobsleiter erklommen. Aber genau das sollte ja nicht sein – Befehl vom Seewolf.
„Kutscher, schaff dir ein dickeres Fell an“, sagte Smoky in der Pinasse. „So wie ich die Dinge sehe, wirst du noch öfter gegen deinen Willen über Bord gehen. Hasard hat sich in den Kopf gesetzt, uns die Hammelbeine langzuziehen. Und wie ich ihn kenne, gibt er erst Ruhe, wenn wir auf dem Zahnfleisch übers Deck kriechen.“
Das stimmte.
Hasard hatte immer noch eine Mordswut im Bauch – wegen der Geschehnisse in Culebra. Die Männer waren richtiggehend aggressiv geworden, weil sie schon seit Monaten keine Frauen mehr gehabt hatten und sich mal wieder richtig austoben mußten. Hasard hatte ihnen Landurlaub gewährt.
Die Attraktion der „Putas“ an Land war eine Kreolin namens Juana gewesen – ein ausgekochtes, raffiniertes Luder. Gordon Watts hatte Perlen aus den Frachträumen der „Isabella“ gestohlen, um sie bezahlen zu können. Und eben das war für Hasard wie ein Schlag unter die Gürtellinie gewesen! Keiner der Männer hatte ihn bisher hintergangen, keiner hatte es jemals gewagt, auch nur einen winzigen Teil der Schätze an Bord ihrer Galeone anzutasten.
Nun, Gordon Watts war für seine Unvorsichtigkeit bitter bestraft worden. Juana, gierig auf mehr Perlen und Schmuck von Bord der „Isabella“, hatte ihn von einem Zambo umbringen lassen.
Von Culebra aus war der Seewolf mit seiner „Isabella III.“ zunächst nach Westen abgelaufen. Später hatte er dann aber – zum Entsetzen seiner Mannschaft – südlichen Kurs genommen.
„Mon Dieu“, hatte Jean Ribault gesagt. „Mein Gott, Hasard, ich bin wirklich keine furchtsame Natur. Aber was wir hier tun, das bedeutet soviel, wie dem Spanier mitten zwischen die Reißzähne zu segeln.“ Er konnte es sich erlauben, den Seewolf zu kritisieren. Er hatte mit ihm das Landabenteuer im Hafen von Panama bestanden. Sie hatten den dicken Hafenkommandanten Alfonso de Roja, den nicht minder beleibten Gouverneur Diego de Avila sowie den Polizeipräfekten Miguel de Villaneva und dessen Clique das Fürchten gelehrt und die Mäuse im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Tisch tanzen lassen. Beide hatten sie hoch gesetzt und ihr Leben mehrmals in die Waagschale geworfen. Die Erlebnisse hatte ihre Freundschaft gefestigt.
Dennoch, Philip Hasard Killigrew hatte dem intelligenten Franzosen nur geantwortet: „Und wenn schon! Willst du dich vielleicht vor den Dons verstekken?“
Jean hatte es vorgezogen, keinen weiteren Kommentar abzugeben.
Hasard wandte sich um und verfolgte mit wachem Blick, wie seine Männer über das Schanzkleid auf das Achterdeck kletterten und dort von ihren Kameraden in Empfang genommen wurden. Sie holten die Segelpinasse ein und zurrten sie mit Brooktauen fest. Blacky und Smoky prüften den ordnungsgemäßen Sitz der Laschungen, dann erstatteten sie ihrem Kapitän Meldung.
Der Kutscher verzog sich hinter das Kombüsenschott und brummelte dabei irgend etwas Unverständliches. Wenn er gedacht hatte, er könne jetzt einen ruhigen Lenz schieben, so hatte er sich gründlich getäuscht. Schon wenig später tönte ein neuer Kommandoruf des Profos’ über Deck.
„Schiff klar zum Gefecht!“
Zähneknirschend begaben sich die Männer auf ihre Stationen, ihre bloßen Füße trabten über die Decks. Der Kutscher beeilte sich, die Kombüsenfeuer zu löschen. Er übernahm es auch, die Decks mit Sand zu bestreuen, wie das vor jedem Seegefecht unerläßlich war. Unterdessen schwangen die Stückpforten der „Isabella“ hoch, und rumpelnd wurden die Kanonen ausgefahren: je vier Demi-Culverinen, also Neunpfünder, auf jeder Seite der Kuhl sowie sechs Drehbassen, zwei vorn auf der Back, zwei auf dem Achterdeck und zwei auf der Kuhl ganz achtern. Das war im Gegensatz zu den dicken Kriegsgaleonen der Spanier eine geradezu lächerliche Armierung. Doch Hasard hatte den Dons nun schon so oft mit diesem Schiff eingeheizt, daß ihnen das Lachen endgültig vergangen war.
Die „Isabella III.“, die früher „Valparaiso“ geheißen hatte und ein Prisenschiff war, hatte sich als echtes Glücksschiff erwiesen. Sie führte nur Fock- und Großmast – statt des Rahgroßsegels hatte sie ein Gaffelsegel –, aber dank ihrer Bauweise war sie schneller und wendiger als die meisten anderen Galeonen. Aber all das wäre nichts gewesen, wenn Hasard nicht diese Mannschaft gehabt hatte, diese Crew von geradezu unerhört draufgängerischen, fähigen, mit allen Salzwassern gewaschenen Kerlen. Er hätte sich für sie in Stücke schlagen lassen, wie sie für ihn durchs Feuer gingen.
Aber er wußte auch genau abzuwägen, wann er sie loben durfte und wann er sie seine ganze Härte spüren lassen mußte. Hasard wußte, daß die Erfolgsserie ein Ende hatte, wenn er die Disziplin an Bord nicht rigoros wiederherstellte. Sie segelten frech und gottesfürchtig mit einer imposanten Pulverladung und einem noch imposanteren Schatz durch die Weltgeschichte – und er wollte, daß dies noch einige Zeit so andauerte.
Er stieg selbst zur Kuhl hinunter und inspizierte das Zubehör der Geschütze. Kartuschen, Kuhfüße, Handspaken, Schwämme und Keile befanden sich in tadellosem Zustand. Auch die Pulverhörner waren ordnungsgemäß gefüllt. Und was die Justierung der Neunpfünder und Drehbassen betraf, so fand Hasard bei allem Groll nichts zu kritisieren.
Al Conroy blickte von einer der Demi-Culverinen an der Backbordseite der Kuhl auf.
„Wie lange soll das noch so weitergehen, Hasard?“ fragte er. „Wir haben unsere Lektion jetzt zur Genüge gelernt. Alles, was nun noch folgt, kann nur eine Art von Beschäftigungstaktik sein.“
„Genau das, Al.“
„Ja, zum Teufel noch mal, ist denn das wirklich notwendig?“
„Unbedingt.“ Hasard stand mit leicht abgewinkelten Beinen und verschränkte die Arme vor der Brust – ein Riese von einem Mann, den weder die rollenden und stampfenden Bewegungen des Schiffes noch eine jäh aufkommende Bö aus dem Gleichgewicht holen konnte. „Aber wenn es dir besser im Kabelgatt oder in der Vorpiek gefällt, Mister Conroy, dann kann ich dich ohne weiteres zufriedenstellen.“
Al war ein wenig blaß geworden. „Nein, Sir.“
„Noch etwas zu meckern, Mister Conroy?“
„Nein, Sir.“
Dan O’Flynn hockte auf seinem Ausguckposten im Großmars, schaute auf die Männer hinunter und schüttelte den Kopf. Sein einziger Zuhörer war Arwenack, der Schimpansenjunge. Der saß mit trübseliger Miene auf dem Rand der Segeltuchverkleidung und kratzte sich am Kopf.
„Ganz unter uns“, sagte Dan. „Ich frage mich langsam, ob Hasard noch richtig im Kopf ist. Entweder hat er sich in den Kopf gesetzt, uns alle langsam aber sicher weichzuklopfen. Oder er entwickelt sich zu einem bulligen Urviech wie sein Alter, Sir John. Das wäre schlimm, Arwenack.“ Dan legte den Kopf schief. „Oder aber er plant was ganz Bestimmtes, wozu er eine noch bessere und verläßlichere Mannschaft braucht. Die Crew war ja schon immer ein verwegener Haufen, aber jetzt will er sie offensichtlich in eine Kampfmaschine verwandeln, die absolut zuverlässig ist. Na, ich bin mal gespannt, was daraus wird.“
Arwenack nickte ernst, als hätte er wirklich verstanden.
Unten auf der Kuhl wandte sich der Seewolf an Ben Brighton. „Ben, ab morgen früh übernimmst du für vierundzwanzig Stunden Aufgaben und Verantwortung des Kapitäns an Bord dieses Schiffes, während ich mich ausschließlich als Beobachter im Hintergrund halte. Von jetzt an setze ich jeden Tag einen anderen Mann als Kapitän ein, damit jeder von euch Himmelhunden auch das lernt und vor allen Dingen ein unerschütterliches Selbstvertrauen kriegt.“
Ben Brighton und alle anderen blickten Hasard verdutzt an. Was war los? Redete der Seewolf im vollen Ernst? Oder sprach er mit zwei Zungen? Etwas unschlüssig fuhr sich Ben mit der Hand über das Kinn.
„Was ist?“ erkundigte sich Hasard. „Habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt, Mister Brighton?“
„Doch, ehm – aye, aye, Sir!“ erwiderte Ben rasch.
2.
Erst in der vierten Woche der Fahrt ließ Philip Hasard Killigrew die sprichwörtliche Katze aus dem Sack. An diesem bedeutungsvollen Tag führte Ferris Tucker als „Kapitän“ das Oberkommando über die „Isabella“. Erst gegen Abend löste Hasard ihn ab und erteilte den Befehl, alle Männer sollten sich auf der Kuhl versammeln. Ferris Tucker entfernte sich ziemlich verlegen. Ganz geheuer war es ihm nicht gewesen, den Kapitän zu mimen. Gemeinsam mit Ben Brighton, Smoky und Karl von Hutten trommelte er die Crew zusammen. Hasard stand auf dem Quarterdeck, als sie sich am Großmast zusammendrängten und erwartungsvoll zu ihm aufschauten. Er blickte sie der Reihe nach an. Es waren 26 Mann, davon dreizehn Mitglieder der alten Stammcrew, seit auch Ed Carberry die „Golden Hind“ von Francis Drake verlassen hatte und zu dem Seewolf gestoßen war. Zwölf waren ehemalige Karibik-Piraten – mit Gordon Watts waren es dreizehn gewesen. Karl von Hutten, der sechsundzwanzigste, war eigentlich ein Außenseiter, jedoch nur seiner Herkunft nach. Er hatte sich binnen kürzester Zeit tadellos angepaßt und war wie alle anderen ein Mann, auf den Hasard nicht mehr verzichten mochte.
Hasard begann: „Ich glaube, ihr habt es verdient, eine Erklärung zu erhalten. Vorher möchte ich aber wissen, ob sich irgend jemand von euch schon mal präzise Gedanken darüber gemacht hat, warum wir uns auf Südkurs befinden.“
Karl von Hutten meldete sich zu Wort: „Meiner Meinung nach willst du das Schicksal herausfordern, Hasard. Angst habe ich nicht, wenn es darum geht, den verfluchten Philips eins zu verpassen. Nur will ich dir eins zu bedenken geben: Nach unserem Schlag gegen Panama muß bei den Spaniern nun wirklich allerhöchste Alarmstufe herrschen, ganz abgesehen davon, daß ja auch Francis Drake unablässig im Südmeer Beute gerissen hat. So wie ich die Spanier kenne – und ich kenne sie sehr gut –, lassen sie nichts unversucht, um uns zu fassen und zu vernichten. Vielleicht bist du so verwegen, durch die Magellanstraße nach England zurücksegeln zu wollen. Aber ich bin sicher, daß unser Gegner sie bereits abgeriegelt hat und auf uns lauert.“
„Mit anderen Worten“, rief Jean Ribault, „Karl ist der Ansicht, daß ein solcher Plan reiner Wahnsinn ist! Die Männer deiner alten Crew wissen im übrigen doch auch, was da unten für eine Hölle los war. Warum sollen wir unbedingt den Tod suchen?“
„Warum läßt du uns wie Fische am Haken zappeln?“ fragte Stenmark.
Hasard grinste. Es war schon einige Zeit her, daß er nicht mehr in ihrer Gegenwart gelächelt hatte. Manch einem fiel der berühmte Stein vom Herzen. Zum ersten Mal, seitdem sie Culebra verlassen hatten, schien Hasard sich wieder in den alten Seewolf zurückzuverwandeln. Er hatte die Crew fester in der Hand, hatte alle Zweifel ausgeräumt, die ihn wochenlang bewegt hatten. „Erinnert ihr euch noch an die ‚Victoria‘?“ fragte er.
Plötzlich lachten die Männer. Sie stießen sich an, tauschten Blicke aus und rissen Witze über jenen Raid, in dem sie Mitte März vor Panama die Galeonen der Spanier gekapert und ausgeplündert hatten. Und ob sie sich an die „Victoria“ erinnerten! Sie hatten sie um eine stattliche Ladung Perlen erleichtert, den gesammelten Reichtum in den Frachträumen der „Isabella“ verstaut und dann weitere spanische Galeonen versenkt. Die wenigen Besatzungsmitglieder, die sich an Bord befunden hatten, hatten sie auf den Panama vorgelagerten Inseln ausgesetzt.
„Also“„ meinte Ben Brighton, „entweder bin ich ein bißchen schwer von Begriff, oder ich habe heute meinen schlechten Tag – jedenfalls hab ich immer noch nicht kapiert, auf was du hinauswillst.“
Hasard grinste immer noch, in seinen Augen tanzten plötzlich tausend Teufel. Er sah Dan O’Flynn an, aber in dem Gesicht des Bürschchens verriet noch keine Regung, daß er endlich verstanden hatte. Dabei hätte er der erste sein müssen, der begriff!
Hasard sagte gelassen: „Ich habe die ‚Victoria‘ von oben bis unten durchsucht, wie ihr wißt. Was euch nicht bekannt ist: In der Kapitänskammer stieß ich auf einen Mann, der gerade eine Truhe durchwühlte. Der Kapitän Juan Bravo de Madinga war ja nicht an Bord, sondern befand sich auf Landgang mit dem Hafenkommandanten und Konsorten. Ich knöpfte mir also den Eindringling vor. Erst wollte er nicht mit der Wahrheit rausrücken. Aber dann stellte sich heraus, daß er ein Spitzel des Vizekönigs von Peru war. Er hatte den Auftrag, de Madinga zu beschatten. De Madinga stand in dem Verdacht, seit ungefähr zwei Jahren von allen Schatzladungen, die er nach Panama bringen sollte, eine ganz gehörige Portion für sich abzuzweigen.“
„Also ein windiger Hund wie dieser Hafenkommandant de Roja und der Präfekt de Villanueva“, warf Jean Ribault ein. „Gibt es denn keinen Don, der nicht an Unterschlagungen und Betrug denkt? Die kennen keine Loyalität und gegenseitiges Vertrauen, sondern jeder denkt nur an seinen persönlichen Vorteil. Meiner Ansicht nach sind das glatte Dekadenzerscheinungen.“
„Was ist das Dekadenz?“ wollte Nils Larsen wissen.
„Verfall“, gab Karl von Hutten zurück.
„Der Spion heißt Sancho Ortiz“, fuhr Hasard fort. „Ich beutelte ihn ordentlich durch und klopfte noch aus ihm heraus, daß er bereits mehr in Erfahrung gebracht hatte, als er zugeben wollte. De Madinga hatte seine Privatschätze in einer kleinen Bucht südlich von Callao verborgen. Die ‚Victoria‘ hatte als Heimathafen ja Callao, wenn ihr euch erinnert. Das geheime Versteck hatte de Madinga auf einer Seekarte mit einem Kreuz bezeichnet.“
„Ha!“ stieß Dan mit einem Mal aus. „Jetzt geht mir ein ganzer Kerzenleuchter auf! Ich war ja dabei, als du diesen Ortiz aushorchtest, Hasard. Wir haben ihn zusammen mit den anderen Besatzungsmitgliedern auf der Insel Taboga ausgesetzt, wo er noch schmort, wenn ihn keiner gefunden hat.“
„Ich untersuchte die Truhe und fand eine braune Mappe aus Schweinsleder“, sagte Hasard. Er sah, wie sich die Augen der Männer weiteten, wie hier und dort Münder aufklappten. Geradezu genüßlich berichtete er weiter: „Darin steckte eine Küstenkarte des Gebietes um Callao. Etwa neun Meilen südöstlich von der Stadt ist eine Bucht mit einem Kreuz markiert. Die Bucht liegt oberhalb von Chorillos, einem winzigen Hafenort – etwa zwei Meilen davon entfernt.“
„Mannmann!“ rief Dan O’Flynn. „Du hast also vor, hinzusegeln und den Schatz zu heben? Daß ich nicht eher darauf gekommen bin!“
Hasard zog etwas aus der Tasche hervor: die Schweinsledermappe. Er rollte demonstrativ die Küstenkarte auf. Seine Männer begannen zu jubeln. Die Stimmung an Bord war vollends wiederhergestellt. Die Aussicht auf neue Beute brachte die Crew wieder ordentlich in Schwung.
„Das wird eine glatte Sache“ sagte Jeff Bowie. „Wir segeln in aller Ruhe dorthin, suchen den Schatz, reißen ihn uns unter den Nagel und hauen ab, ohne daß uns jemand in die Quere gerät.“
„Fast zu schön, um wahr zu sein“, meinte Matt Davies.
Hasard hob die Rechte, und die Männer verstummten sofort wieder. „Tut mir leid, aber ich muß euch einen Dämpfer aufsetzen. So einfach ist die Angelegenheit nun auch wieder nicht. Immerhin sind nicht nur wir allein auf den Schatz erpicht.“
„Wer denn noch?“ rief Dan. „De Madinga ist von mir im Duell getötet worden, als deine große Komödie beim Festbankett des Gouverneurs von Panama platzte und der Capitan euch den Weg verstellen wollte. Und dieser Sancho Ortiz wird seinem Auftraggeber wohl kaum bereits Bericht erstattet haben.“
Der Seewolf zog die Augenbrauen hoch. „Da würde ich mal nicht so sicher sein. Ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber es könnte sein, daß der Schatz bereits gefunden worden ist. Unser einziger Trumpf ist die Karte, denn Ortiz hatte sie noch nicht betrachtet, als ich ihn in der Kapitänskammer der ‚Victoria‘ erwischte. Er weiß also nicht genau, wo der Schatz liegt.“
Ben Brighton trat neben ihn. „Dann also nichts wie nach Callao. Wir klüsen, was das Zeug hält, damit wir nicht aus der Übung kommen.“ Mit flüchtigem Grinsen blickte er auf Ferris Tucker. „Also, Männer, wer ist von jetzt ab wieder der Kapitän auf der ‚Isabella‘?“
„Hasard!“ brüllten die Männer. „Es lebe der Seewolf!“
Das einmastige Fischerboot dümpelte in Sichtweite der Küste rund zwanzig Meilen südlich von Callao dahin. Der einsame Mann an Bord hatte die Netze ausgeworfen, aber das nur zum Schein. Im Grunde war es ihm völlig gleichgültig, ob er etwas fing oder nicht. Denn seine Existenz hing nicht von ein paar armseligen Fischen und den Launen des Meeres, sondern von weitaus bedeutsameren Dingen ab.
Er war ein schlanker, dunkelhaariger Mann. Er hatte es sich gemütlich gemacht, indem er sich zwischen zwei Duchten gesetzt und mit dem Rücken gegen die Backbordwand gelehnt, die Beine nach Steuerbord ausgestreckt hatte. Seine Kleidung ähnelte der derben Kluft eines Fischers, doch auch sie war nur Tarnung. Seine Hände waren nicht schwielig und grob wie die eines an harte körperliche Arbeit gewöhnten Mannes. Sie waren feingliedrig und weich. Wer seine Gesten beobachtete, wußte, daß er nicht in den Spelunken winziger, unbedeutender Dörfer, sondern in vornehmen Kreisen verkehrte.
Seine Name war Sancho Ortiz.
Ortiz lauschte dem sanften Schmatzen, mit dem die Wellen des Ozeans an den Bordwänden des Einmasters entlangleckten, und gab sich dabei seinen Überlegungen hin. Er wußte nicht, wie der bärenstarke Mann hieß, der ihn an Bord der „Victoria“ überwältigt und zur Preisgabe seines Geheimnisses gezwungen hatte. Das einzige, was er über ihn wußte, war, daß er ein Engländer und damit in seinen Augen ein gottverfluchter Hundesohn war.
Ortiz wollte diesen Engländer überraschen, sich an ihm rächen und verhindern, daß ihm der Schatz des Juan Bravo de Madinga in die Hände fiel. Er war überzeugt, daß sie sich irgendwann treffen würden – Erzfeinde, die sich gegenseitig zu überlisten und umzubringen trachten würden. Ortiz’ Handeln seit dem Überfall auf die „Victoria“ wurde von diesen Gedanken bestimmt.
Manchmal führte er Selbstgespräche. Dann sagte er: „Warte nur, Ingles, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben“ oder „Wir haben noch eine Rechnung miteinander zu begleichen“.
Was geschehen war, konnte jener verhaßte englische Freibeuter nicht einmal ahnen. Ortiz grinste bei dem Gedanken, daß jener vielleicht meinte, die Besatzungsmitglieder der versenkten Galeone säßen noch auf den Inseln vor Panama fest. Aber sie hatten sich schon bald nach ihrer unfreiwilligen Landung auf Taboga durch Rauchzeichen bemerkbar gemacht. Eine Galeone aus Guayaquil war aufgekreuzt und hatte sie nach Panama gebracht, wo sie den Überfall in allen Einzelheiten geschildert hatten. Sie hatten auch von dem Aufruhr vernommen, den es dort wegen der verdammten Engländer noch gegeben hatte – daß der Hafenkommandant und der Polizeipräfekt entführt worden waren zum Beispiel.
Er, Sancho Ortiz, hatte all diesen Dingen nur noch relativ wenig Bedentung beigemessen. Er war verschlagen, skrupellos, wendig und nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Dank seiner blendenden Umgangsformen hatte er es verstanden, sich sehr schnell aus der ganzen Affäre zu ziehen, überflüssige Vernehmungen zu vermeiden und sich als Geheimagent des Vizekönigs von Peru auszugeben.
Von da an hatte ihn praktisch niemand mehr aufhalten können. Er hatte sich an Bord der Galeone zurückbegeben und war mit ihr nach Guayaquil gesegelt. Von dort aus war er auf dem Landweg nach Callao gereist. Anfang Mai war er eingetroffen, hatte sich aber nicht bei Don Francisco de Toledo, dem Vizekönig von Peru, zurückgemeldet, sondern einen kühnen Entschluß gefaßt.
Er wollte allein nach dem versteckten Schatz de Madingas suchen! Weshalb sollte er dem Vizekönig überbringen, was mit ein bißchen Geschick durchaus ihm allein zufallen konnte? In Panama hatte Ortiz erfahren, daß de Madinga tot aufgefunden worden war. Folglich waren die verborgenen Reichtümer also „herrenlos“ geworden.
Darmowy fragment się skończył.