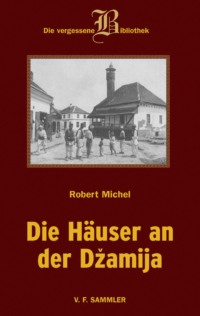Czytaj książkę: «Die Häuser an der Dzamija»
Robert Michel
Die Häuser an der Džamija

Umschlaggestaltung: DSR-Digitalstudio Rypka, Graz; Thomas Hofer
Umschlagfoto sowie alle übrigen Fotos entstammen der photographischen Reise des k.u.k Oberleutnants Emil Balcarek durch Bosnien-Herzogowina 1907/08.
In: Helmut Friedrichsmeier (Hg.): Das versunkene Bosnien, Graz 1999.
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Hinweis:
Dieses Buch wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.
Die zum Schutz vor Verschmutzung verwendete Einschweißfolie ist aus Polyethylen chlor- und schwefelfrei hergestellt. Diese umweltfreundliche Folie verhält sich grundwasserneutral, ist voll recyclingfähig und verbrennt in Müllverbrennungsanlagen völlig ungiftig.
ISBN 3-85365-208-5
eISBN 978-3-85365-310-4
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger jeder Art, auszugsweisen Nachdruck oder Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art, sind vorbehalten.
© Copyright by V. F. SAMMLER, Graz 2004
Printed in Austria
Layout: Klaudia Aschbacher, A-8111 Judendorf-Straßengel
Gesamtherstellung: Druckerei Theiss GmbH, A-9431 St. Stefan
Inhalt
Einleitung
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Glossar
Einleitung
Was du arbeitest, geht aus diesem so üppigen feuchtwarmen Weltgefühl hervor; aus einer solchen Lebensatmosphäre, daß du von Natur wohl bewahrt bist, etwas von der trockenen Häßlichkeit des Metiers zu empfinden.
(Hugo von Hofmannsthal über Robert Michel)
Die These eines „österreichischen Schriftstellers“ läßt sich vom Beginn bis zum Ende des Schaffens Robert Michels vertreten. Stärker als vom Literaturgeschehen seiner Zeit wurde Michel von der Zeit selbst geprägt. Von der Balkankrise zur bosnischen Annexionskrise, vom Ersten Weltkrieg zur Ersten Republik, vom Zweiten Weltkrieg zur Wiederherstellung der Republik und dem Staatsvertrag hat der Autor fast ein Jahrhundert durchlebt.
}
Robert Michel hat in Einzelheiten seiner Erzählweise eine unverkennbare und erinnernswerte Eigenheit. Sein Stil ist, von wenigen Ausnahmen abgesehen, sehr homogen und weist kaum Varianten auf. Die Betonung der Landschaft und des beschreibenden Elements sind in den erzählerischen Werken charakteristische Stilzüge. So betrachtet, war Robert Michel der österreichischen Literaturtradition vor der Jahrhundertwende verpflichtet. Seine kosmopolitische Einstellung zeigt sich in der Vielfalt der von ihm herangezogenen Stoffe und Schauplätze, in welchen er seine Figuren agieren läßt. Als Offizier hatte er die Möglichkeit, sich, unabhängig von finanziellen Erwägungen, der schriftstellerischen Tätigkeit zu widmen, als freier Schriftsteller war er genötigt, Literatur auch im Zusammenhang mit ihren kommerziellen Möglichkeiten zu sehen.
Robert Michel, der am 24. Februar 1876 in Chaberiće in Böhmen geboren wurde, wuchs in einer kleinbürgerlichen deutsch-böhmischen Familie auf. Der Vater war Beamter im Dienst des Landadels. In Prag besuchte Michel zuerst das deutsche Gymnasium und dann die Kadettenschule. In seinen autobiographischen Schriften legt der Autor das Hauptgewicht auf Theater und Theaterbesuche in Prag. Der Übertritt zur Kadettenschule war nicht die Folge einer besonderen Neigung zum Offiziersberuf, sondern geschah aus finanziellen Gründen. Nebenbei versuchte er sich mit einigen Veröffentlichungen in Lyrik und Prosa im „Prager Tagblatt“. Zum Nationalitätenkampf zwischen Deutschen und Tschechen nahm er die für einen österreichischen Offizier typische „übernationale“ Haltung ein. So setzte sich Michel in seinen Dichtungen aus Südslawien für die Erhaltung südslawischer Eigenart und südslawischen Wesens ein. Er versuchte sich aber auch als Vermittler zwischen der deutschen und der slawischen Welt. In Prag arbeitete er auch an seinem ersten Roman, der jedoch nie veröffentlicht wurde.
Als Michel im Herbst 1895 als Leutnant nach Wien kam, war sein wohl wichtigstes Erlebnis das erste Treffen mit Leopold von Adrian-Werbung. Dieser ersten Begegnung sollte eine lange Freundschaft folgen. Über Adrian lernte Robert Michel auch Hugo von Hofmannsthal kennen. Im Café Griensteidl folgten dann die Bekanntschaften mit Arthur Schnitzler, Richard Beer-Hofmann, Hermann Bahr, Felix Salten und Karl Kraus. Die meisten Literaten des „jungen Wiens“ stammten aus begüterten Häusern, und finanzielle Sorgen waren ihnen fremd, Robert Michel hingegen diente weiter als Offizier: „Man wüßte außer dem Beruf des Landmannes, des Jägers und Seefahrers keinen anderen zu nennen, der einen so vielfältig mit der Natur verbindet und dabei so mannigfach mit dem Leben verknüpft.“ (Michel in „Aus eigener Werkstatt“)
Hofmannsthal stand Robert Michel in der Folge als Förderer zur Seite. Unter anderem verhalf er ihm zur Veröffentlichung der Novellen „Die Verhüllte“ (1907), indem er seine Schriften wiederholt den Lektoren des S. Fischer Verlags empfahl. Hofmannsthal war ein sehr kritischer Leser, so waren auch die Briefwechsel zwischen Michel und Hofmannsthal meist literarischer Natur. Leopold von Adrian: „Abgesehen von George, erkannte Hofmannsthal sehr wenige unter den Autoren seiner Zeit, insbesondere deutscher Zunge, als seinesgleichen an.“
1898 wurde Robert Michel mit der politischen Wirklichkeit direkt konfrontiert, indem er nach Mostar versetzt wurde. Der Mittelpunkt der Herzegowina wurde zentraler Ort in zahlreichen Werken Robert Michels, wie zum Beispiel in „Hercegovinische Hirten“. In den Beschreibungen wird das fremdländisch ungewohnte Milieu dem Leser nahegebracht. Der Leser soll durch die Exotik des Raums in Bann gehalten werden. Geprägt sind diese Novellen auch durch Wörter aus der militärischen Fachsprache und Wörter, welche die südslawische Welt in ihren ethnologischen und folkloristischen Momenten beschreiben.
Durch die wechselseitige Beeinflussung der beiden Berufe, Soldat und Schriftsteller, formte Michel das geistige Antlitz der österreichischen Armee, wie auch Karl von Torresani, Rudolf Hans Bartsch, Franz Karl Ginzkey und Ferdinand von Saar. Diese Klasse, die eng mit der historisch-kulturellen Tradition Österreich-Ungarn zusammenhing, beeinflußte sein Schaffen bis zu seinem Tod. Auch wenn Michel 1918 den Beruf des Offiziers verließ, blieb er dieser Welt mit ihren Themen und Motiven verbunden.
Robert Michels Darstellungen der Landschaft und des Raums sind wie bei den meisten Schriftstellern an menschliche Situationen, Perspektiven und Reaktionen gebunden und stehen nicht für sich allein. Sie sind durchaus mit den Natur- und Landschaftsschilderungen von Adalbert Stifter zu vergleichen. Es ließen sich aber auch zu anderen Schriftstellern und Dichtern der deutschen und österreichischen Literatur Parallelen aufstellen.
Die Jahre 1900 bis 1907 verbrachte Michel in Innsbruck. Hier heiratete er 1903 Eleonore Sniźek, welche ihm drei Kinder schenkte: Leopold, Adalbert und Agathe. In dieser Zeit entwickelte sich auch eine intensive Freundschaft mit Ludwig von Ficker, die aus der Zusammenarbeit bei der Tiroler Zeitschrift „Brenner“ hervorging. Ihre Briefwechsel reichen bis ins Jahr 1955. Ab 1914 erkennt man allerdings eine gewisse Abkühlung des freundschaftlichen Verhältnisses, welche von ihren unterschiedlichen Einstellungen zum Weltkrieg geprägt wurde.
1909 erschien Michels erster Roman, „Der steinerne Mann“, mit einem sehr autobiographischen Kontext und 1911 der Sammelband „Geschichten von Insekten“.
Am 10. 12. 1913 präsentierte Michel das erste Mal öffentlich bei einer „Brenner“-Vorlesung einen Teil aus seinem noch unveröffentlichten Roman „Die Häuser an der Džamija“. Die Lesung verhalf Michel zum Prestige einer breiteren Tiroler Öffentlichkeit.
Von sämtlichen Werken Robert Michels wurden der Novellenband „Die Verhüllte“ (1907), der Roman „Die Häuser an der Džamija“ (1915), die „Briefe eines Hauptmanns an seinen Sohn“ (1916) und die „Briefe eines Landsturmleutnants an Frauen“ (1917) mehrmals aufgelegt. Dies war zur damaligen Zeit überraschend, da die Konkurrenz am literarischen Markt sehr groß war.
Zu Propagandazwecken wurde 1914 in der österreichisch-ungarischen Armee als Sondereinrichtung des Armeeoberkommandos ein „Kriegspressequartier“ (KPQ) gegründet, das die Aufgabe hatte, der Presse Berichte über das Kriegsgeschehen in Wort und Bild zu liefern. Zur so genannten „literarischen Gruppe“ des Kriegsarchivs zählten neben Robert Michel unter anderem Hans Rudolf Bartsch, Karl Ginzkey, Stefan Zweig, Alfred Polgar, Leopold Schönthal, Felix Salten, Paul Wengraf und für kurze Zeit auch Rainer Maria Rilke.
Die vielfältige Produktion Michels während des Ersten Weltkriegs reicht von der Erzählung bis zum Brief, vom Kriegsbericht bis zur Regimentsgeschichte. Neben dieser „Kriegsliteratur“ schrieb Michel aber auch Werke, die ihm große schriftstellerische Ehren einbrachten. Der Roman „Die Häuser an der Džamija“, der in Südslawien spielt, wurde eines der bekanntesten Werke des Autors und brachte ihm den begehrten „Kleistpreis“ ein. Eine äußerst positive Reaktion von Oskar Loerke in der „Neuen Rundschau“ von 1915 hebt die Ursprünglichkeit und Echtheit der Charaktere im Roman hervor. „Die Häuser an der Džamija“ gilt als Höhepunkt seiner atmosphärischen Poetik. Seine Schilderung der Bräuche dieses neu gewonnenen österreichischen Volkes, dessen als arm und rückständig empfundenes, aber geliebtes Land wird von Michel zur neuen Heimat der Sehnsucht auserkoren. Robert Michel bezeichnet einen Brief von Hugo von Hofmannsthal zum Erstentwurf des Romans als seinen „Ritterschlag“ – einen wichtigen Wendepunkt in seinem Leben:
Mein lieber Robert,
Deine hercegovinische Dorfgeschichte habe ich mit einem wahrhaft seltenen Vergnügen gelesen. Ich glaube wohl, sie ist dein Meisterstück. Wie schön die sinnliche Anschaulichkeit, mit der alles Geschehen sich zu kleinen Katastrophen der äußeren Welt verdichtet: der Unfall Božkos, […], die Schlangenabenteuer, […], die Entführung.
Wie ist das Geschehen zugleich ungewöhnlich und gewöhnlich, fremd und zugleich heimlich und Zutrauen erweckend, und wie schön ist das Naturhafte dieser Menschenwelt, die Reinheit, die nur reine Spiegel eines dichterischen Gemütes so rein zurückstrahlen konnte. Hier zum ersten Mal fühle ich in [Dir] (und nun auf immer) nicht nur den dichterisch begabten Menschen, sondern den Dichter.
Meine Freude war groß und wird nachhaltig sein, mein guter Robert, denn was ist woltuender als ein reines Wollen und Gelingen bei einem Mitlebenden, Befreundeten, dem man in die Augen sehen kann! […]
(Hugo von Hofmannsthal an Robert Michel, 1913)
Michel war in erster Linie Epiker und nicht Dramatiker. Dennoch wurden einige seiner epischen Arbeiten als dramatische Fassungen aufgeführt – so auch „Die Häuser an der Džamija“ unter dem Titel „Muharrem der Christ“.
Am 27. August 1918 setzte Leopold von Adrian, Generalintendant der Hoftheater, ein Dreierkollegium zur Führung der Geschäfte am Burg- und Akademietheater in Wien ein: Hermann Bahr, Max Devrient und Robert Michel, der als „Vertreter für die Generalintendanz“ tätig war. Dieses Kollegium bestand jedoch nur bis 2. November 1918 – also ungefähr zwei Monate. Als im Herbst 1918 die Monarchie aufgelöst wurde und eine „Deutsch-Österreichische Provisorische Nationalversammlung“ die Regierungsgeschäfte übernahm, wurden auch die Hoftheater aufgelöst. Nach dieser Tätigkeit gab Michel seinen Offiziersberuf auf und arbeitete von nun an als freier Schriftsteller mit großen finanziellen Sorgen.
Daß nach 1918 die südslawische Thematik immer seltener Inhalt seiner Werke ist, hat seine Ursache darin, daß diese Gebiete Österreich verlorengingen und somit der aktuelle Bezug fehlte. Nach dem Ersten Weltkrieg versuchte sich Michel mehr beim Film. Michels Ruf als Prosaist war jedoch nicht verklungen, was zahlreiche Literaturpreise belegen. Die letzten Romane und ihre Thematik dienen als Beweis für Michels nostalgisches Festhalten an der Welt der k.u.k.-Monarchie: „Jesus im Böhmerwald“ (1927), „Die Augen des Waldes“ (1946) und „Die allerhöchste Frau“ (1947).
1933 übernahm Michel einen Feuilletonvertrieb – R.O.M.I. (= Robert Michel) – und vermittelte erzählende Prosa österreichischer Schriftsteller an Tageszeitungen und Zeitschriften, wie zum Beispiel Josef Friedrich Perkonig, Max Kammerlander, Cäcilie Tannings, Paul Anton Keller und Hermann Hesse. 1946, als seine rechte Hand Cäcilie Tandler starb, gab Michel den Vertrieb auf. Einige Wochen, nachdem das Bundesministerium für Unterricht Robert Michel den Titel „Professor“ verliehen und ihn die Stadt Wien mit einer Ehrenmedaille geehrt hatte, erlitt der Schriftsteller 1951 einen Schlaganfall. Robert Michel starb am 12. Februar 1957 in Wien.
Hans Heinz Hahnl zählt Robert Michel zu den „Verschollenen“ der österreichischen Literatur. Selbst das Verdienst, die bosnisch-herzegowinische Landschaft und ihre pittoresken muslimischen Bräuche für die österreichische Literatur entdeckt zu haben, wurde über den engeren Kreis der Gönner und wenigen Leser hinaus substanziell nie wahrgenommen. Ziel dieser Neuauflage des Romans „Die Häuser an der Džamija“ soll es sein, dem Vergessen ein wenig entgegenzuarbeiten – die Konturen dieser am Rande der österreichischen Literaturgeschichtsschreibung gebliebenen Figur wieder zum Leben zu erwecken.
Mag. Sabine Wimmer
Erstes Kapitel
„Mu-har-rem!“ – Die Silben klangen hoch und schmetternd wie aus dem metallenen Schlund einer Trompete. Mit dieser Stimme hätte man eine ganze Heerschar befehligen können; so heldenhaft sicher war ihr weitschallender Klang. Der Steinmetz Nurija Sekirija, der gerufen hatte, hielt zu einer Pause inne. Als dürfe er diese Augenblicke nicht ungenützt verstreichen lassen, schnellte er mit den Fingerspitzen von der roten Gürtelschärpe und von den dunklen Pluderhosen die Steinsplitter ab, die bei der Arbeit dort haften geblieben waren. Auch stampfte er mit jedem Fuß einmal auf den harten Boden, daß der steinige Staub von den Opanken fiel. Dann richtete er seinen Körper hoch auf, schob mit den Handflächen die langen grauen Schnurrbartspitzen seitwärts, und durch den Schalltrichter der hohlen Hände klang es noch einmal mit gleicher Kraft: „Mu-har-rem!“ Dieses unsichtbare Lebendige, das Nurijas Brust und Kehle und Mund ausgestoßen hatten, lief beschwingt über die flachen Steindächer des unteren Dorfes und über die ganze stille steinige Landschaft hin, ohne sich an den spitz aufragenden Steinblöcken zu zerreißen. Es lief auch bergwärts und nach allen anderen Seiten des Hanges; es sprang aber nicht über die verschluchteten Einrisse hinweg, sondern schmiegte sich in klingenden Wellen in jede einzelne Falte, bis er endlich von dem eiligen Tun entkräftet rings in der Ferne ins Nichts verzitterte.
Muharrem hatte sich mit der Schafherde zur Mittagsruhe in eine felsige Schlucht zurückgezogen. Freilich brannte auch dorthin die hohe Mittagssonne ebenso heiß wie auf den steinigen Hang, aber da war es leichter, ein Plätzchen zum Niederlegen zu finden als draußen zwischen den Steinen. Muharrem lag auf dem Rücken und schlief; er hatte den einen Arm auf das Gesicht gelegt und schützte sich so vor dem grellen Licht und den brennenden Strahlen. Die Schafe hatten sich zur Ruhe nicht niedergelegt, weil es ihnen auf dem Boden zu heiß war; sie standen schlafend aufrecht, und jedes hielt den Kopf tief in den Schatten unter den Bauch eines benachbarten Schafes. Nur ein Mutterschaf, das am selben Morgen ein Junges zur Welt gebracht hatte, war auf dem Boden hingestreckt.
Als Nurijas Ruf das erstemal bis hierher klang, hob ein Widder seinen Kopf aus dem Schatten empor und blinzelte in die Sonne; dabei schlug der Klöppel seiner Glocke einmal an die metallene Wand. Muharrem zog den Arm von seinem Gesicht und mußte ihn gleich wieder vorhalten, so grell war das Licht für die Augen. Als sein Name zum zweitenmal erklang, wurde sich Muharrem dessen bewußt, daß ihn sein Herr rief. Er streckte seine jungen Glieder weit von sich, daß es in den Gelenken knackte, dann zog er die Füße ein wenig näher, stemmte sich gegen die Sohlen und wölbte den Körper mit durchgebogenem Rücken wohlig empor wie einen Brückenbogen. Schließlich aber sprang er so heftig auf, daß sich die Köpfe der Schafe erschreckt empor richteten. Muharrem beschwichtigte die Tiere mit einigen trauten Zurufen, so daß ein Kopf nach dem anderen wieder den Schatten aufsuchte. Dann trat er seitwärts, wo seine Jacke lag. Erst zog er eine Kürbisflasche unter ihr hervor und tat einen langen Schluck. Hieraufhängte er sich die Flasche um, und nun wickelte er aus der Jacke vorsichtig ein junges Lamm. Die Jacke warf er über die Schulter und das Junge nahm er in einen Arm, und so ging er. Die Schafe waren mittlerweile wieder eingeschlafen; nur der Widder mit der Glocke und das liegende Mutterschaf schauten dem Hirten mit schläfrig zwinkernden Augen so lange nach, bis er plötzlich ihren Blicken entschwand, als hätte ihn die mittagheiße Erde eingesogen wie einen Tropfen Wassers.
Muharrem galt als Mohammedaner, obwohl er von christlichen Eltern abstammte und die heilige Taufe empfangen hatte. Durch Aberglauben bestimmt, hatten ihn die Eltern von klein auf mit dem mohammedanischen Namen Muharrem gerufen. Als kleiner Waisenknabe wurde er dann von Nurija Sekirija als Hirte in Dienst genommen und dem Namen gemäß für ein mohammedanisches Kind gehalten. Damals ließ es Muharrem in kindlicher Sorglosigkeit geschehen, daß ihn sein Dienstherr als einen Glaubensbruder aufnahm. Später paßte sich Muharrem in Sitte und Brauch seiner Umgebung an und hielt es weiterhin geheim, daß er einer anderen Religion angehörte.
Muharrem stieg quer über den steinigen Hang dem Dorfe zu. Er kam nur langsam vorwärts, weil der Weg durch das Gewirre der großen und kleinen Steine, zwischen denen hin und wieder dorniges Buschwerk wuchs, sehr beschwerlich war. Er konnte sich den Weg nicht wie sonst erleichtern, indem er immer von einem hohen Stein auf den andern sprang; denn diesmal trug er doch ein junges Lamm, das er nicht gefährden durfte. Mit der freien Hand stützte er sich manchmal hangwärts gegen einen Stein, um den Füßen die Arbeit zu erleichtern, oder er bog mit ihr das hinderliche Gestrüpp beiseite. Schon sah er die Dächer des unteren Dorfes, die nur durch das Grün der kleinen Gärten aus dem allgemeinen Grau des Karsthanges kenntlich wurden; denn auch sie waren grau, da ihre großen, schweren Steinplatten aus dem Gestein des Hanges gewonnen waren. Vom oberen Dorfteil, auf der hohen vorspringenden Terrasse, die von starken Felsensäulen gestützt war, sah Muharrem nur die graue Spitze des steinernen Minaretts und die Wipfel der schlanken Pappeln, die neben der Džamija in das Himmelsblau ragten. Noch der Sprung über einen Steinriegel, dann stand Muharrem auf dem schmalen, steilen Weg, der vom unteren Dorf zu den Häusern an der Moschee führte. Nach dem beschwerlichen Übersetzen des Steinhanges wurde auf diesem Wege Muharrems Gang leicht und elastisch, als schritte er auf einem ebenen, geglätteten Weg. Er begann trotz der drückenden Hitze ein Lied zu singen; indessen dämpfte er den Gesang allmählich, so daß er nur noch als ein tönendes Summen ihm allein vernehmlich war.
Bald war Muharrem bei dem ersten Haus des oberen Dorfteiles angelangt. Da wohnte der wohlhabende Moslem Jašarbegović mit seiner Tochter Aiša, die Muharrem, seit sie erwachen war, nie zu sehen bekommen hatte. Das Nachbarhaus war das einzige christliche unter den Häusern an der Džamija. Es gehörte dem Bauer Mitar Boro; aber die Felder, die er bebaute, gehörten ihm nicht, die zählten zum Eigentum des Jašarbegović, und Mitar Boro war sein Kmet. Das nächste Haus war von der Familie Škeho bewohnt. Hier versäumte Muharrem im Vorübergehen nie, zu den Erkern des Fensters hinauf zu schauen. Denn wenn sich auch das Holzgitter vor seinen Blicken verschloß, so war er doch sicher, dahinter werde sich die rothaarige Zahida so nahe zeigen, daß er zwischen den Gitterstäben hindurch das Schimmern des Haares und der weißen Wangen und das Leuchten der dunklen Augen erkennen würde. Auch heute hatte sie das Gitterfenster lärmend zugeschlagen, drückte aber nun das Gesicht dicht an das Holz des Gitters. Muharrem verlangsamte den Schritt und sagte mit leiser, spottender Stimme: „Heute muß man die Blumen in den Schatten stellen.“ Und Zahida zahlte ihm den Spott zurück: „Aber die Disteln können in der Sonne bleiben.“ Er wäre wohl auch ein Weilchen stehen geblieben, aber vom Hofe her hörte er die Stimme Hassans, des jüngeren Bruders der Zahida; so ging er lieber weiter. Nach einigen Schritten klopfte er an das Tor seines Herrn, des Steinmetz Nurija Sekirija.

Szene aus Bosnien zur Zeit der österreichisch-ungarischen Herrschaft
Nachdem Nurija Sekirija den Muharrem ein zweites Mal gerufen hatte, ging er zum Haus zurück. Vor seiner Werkstatt im Schatten einer Weinrebe hockte er sich wieder zu dem Grabstein, an dem er schon früher gemeißelt hatte. Mit kraftvollen Schlägen hieb er mit dem Hammer auf den Meißel, dessen Schärfe aus einer Längsseite des Grabsteines Splitter um Splitter herausbrach; die ausgeschonten Stellen zeigten die verschnörkelten Züge einer türkischen Inschrift. Es lagen auch noch andere größere und kleinere halbfertige Grabsteine umher und einige lehnten seitlich an dem Steinriegel, jenseits dessen sich der Vorhof der Moschee breitete.
Aus diesem Hof der Džamija herüber hörte Nurija zwischen seinen Hammerschlägen das leise Plätschern des Bachwassers, das durch eine steingefaßte Rinne dorthin geleitet war. Er hörte aber nicht, daß sich über den Vorhof der Hodža Adem Jazvin näherte; denn Adem hatte weiche Saffianschuhe, und seine Schritte waren nicht so laut, daß sie das Plätschern des Wassers übertönt hätten.
Adem Jazvin war ein alter Mann mit weißem Bart und Haar, aber seine blauen Augen waren wie aus einem Kindesantlitz. Er war aus seinem Hause jenseits der Moschee gekommen. Der Hodža lebte da ohne Weib und Kind, denn der Vakuf, aus dem diese Dorfdžamija erhalten wurde, war sehr gering, so daß sein Ertrag kaum einen Menschen allein ernähren konnte. So kam es auch, daß Adem alle Dienste der Moschee in eigener Person versehen mußte; er hatte niemanden, der ihm die Gläubigen zu den Andachten herbeirief, er war Hodža und Muezzin zugleich. Man sah aber Adem Jazvin die Armut nicht an; sein grüner, ausgebleichter Kaftan war zwar geflickt, aber er war rein, und sein Aussehen war der geistlichen Würde nicht abträglich; und die weiße Turbanbinde um seinen Fes war wie frisch gefallener Schnee. Bei aller Armut war Adem so reich, daß er noch viel an andere abgeben konnte, wenn auch nicht in klingender Münze. Sein Rat war im Dorfe von jedermann gesucht und geschätzt. Für seine Bedürfnisse genügte ihm ein kleiner Raum zum Wohnen; alle übrigen Räumlichkeiten des Hodžahauses hatte er als Schule eingerichtet, und er selbst war der Lehrer. Die Kinder des Dorfes hätten bis nach Mostar zur Schule gehen müssen; der Weg dorthin war aber beschwerlich und für einen Erwachsenen in nicht viel weniger als drei Stunden zu bewältigen; so wäre ohne das verdienstliche Wirken des Hodžas den Kindern des Bergdorfes die Kenntnis des Schreibens und Rechnens zeitlebens schwerer erreichbar geblieben als etwa die Bekanntschaft mit dem Grabe des Propheten.
Adem Jazvin lehnte sich vorsichtig auf den Steinriegel und schaute der Arbeit Nurijas zu. Endlich sagte er: „Gott grüß dich, Nurija!“
Nurija hielt in der Arbeit inne und blickte auf Adem. Dabei sänftigte sich der Ausdruck seines Gesichtes, dessen Furchen und Falten während der Arbeit so tief und starr waren, als hätte sie selbst der Meißel eines Bildhauers eingegraben; und er erwiderte den Gruß: „Gott grüß dich, Adem, ich habe dich gar nicht bemerkt. Wie geht es dir?“ Er sprach dies mit einer tiefen, weichen Stimme, von der man nicht vermutet hätte, daß sie sich zu hohem und schmetterndem Rufe wandeln könne.
Adem vergaß auf die höfliche Frage zu antworten; er blickte vor sich hin und hatte die verlegene Miene eines, der sich nicht entschließen kann, davon zu sprechen, was seinen Geist eben beschäftigt. Endlich begann er zögernd: „Ob du erraten könntest, Nurija, woran ich denken mußte, als ich dich vorhin den Muharrem rufen hörte?“
Nurija verneinte nur stumm, indem er den Kopf ein wenig hob und dazu leise mit der Zunge schnalzte.
Adem setzt fort: „Wenn ich mir jemals die Stimme des Engels Džebrail vorstellte, so war es eine Stimme von solcher Kraft und solchem Klang, wie du sie hast. Ich kannte vor Jahrzehnten eine solche Stimme; wenn die rief, so kamen aus allen Weltgegenden bewaffnete Männer, als hätte sie diese Stimme aus dem kahlen Steinboden hervorgezaubert. Aber auch im Frieden braucht eine so vortreffliche Stimme nicht ungenützt in der Brust verschlossen zu bleiben. Ich möchte geradezu sagen, eine solche Stimme ist ein Schatz, den man nicht geizig für sich bewahren darf, sondern als rechtlicher Moslem irgendwie zum Nutzen der Allgemeinheit verwenden muß – weißt du noch immer nicht, wohin ich ziele, Nurija?“
„Bei Gott, ich weiß es nicht.“
„So höre mich an, Nurija, es gibt eine Möglichkeit, deine Stimme täglich für das Wohl der anderen zu nützen. Du bist zwar alt, obschon noch einige Jahre bis zu meinem Alter fehlen, aber deine Stimme ist ganz jung geblieben. Bei vielen Menschen bleibt etwas von dem Lauf der Zeit unberührt und wie für alle Ewigkeit jung. Bei einem ist es das Herz und beim andern das Auge, bei manchem die männliche Kraft und bei manchem wieder die Art seiner Rede; bei dir aber ist es die Stimme, die nicht ihresgleichen hat an Kraft und Schönheit. Diese Stimme muß schon ihrer Jugend wegen Gott wohlgefällig sein. Siehst du, wenn ich mir denke, daß du einmal mit dieser Stimme dort von der Brüstung des Minaretts zum Gebete riefest, das müßte eine rechte Verherrlichung Allahs sein.“
Nurija Sekirija wehrte bescheiden mit den Händen ab.
Adem suchte ihn weiter zu überreden: „Du weißt ja selbst, daß von unserer Džamija kein irdischer Gewinn zu holen ist; meine Bezüge sind gering – ich klage nicht darüber – aber sie sind so gering, daß ich zur Erhaltung des Gotteshauses und zur Bestreitung meiner eigenen Bedürfnisse noch an die Wohltätigkeit der anderen Glaubensbrüder angewiesen bin. Trotzdem würde ich gerne noch einen Teil abgeben, wenn du das Amt des Muezzins übernehmen wolltest.“ Nurija Sekirija wehrte nun auch mit Worten ab: „Mich macht es bange, an ein solches Amt zu denken. Schau, mein Leben ist so angefüllt, daß kaum mehr etwas Neues darin Platz finden kann. Hier mit meinen Steinen habe ich ehrlich viel Arbeit; und wenn ich auch ohne Weib und Kind bin, ich habe doch meine alte Mutter und den Muharrem; und dann hab ich mein Haus und meine Schafe.“
„Ich weiß, daß du deine Zeit nicht vergeudest; dieses neue Amt würde dich nur wenig an Zeit kosten, aber es brächte dir dereinst viel an Lohn.“
„Deine Worte klingen mir ans Ohr, aber aus meinem Innern höre ich keine Zusage. Sei nicht ungehalten, Adem, daß ich so zu dir rede. Aber ich habe noch nie im Leben etwas Wichtigeres unternommen, zu dem mir nicht eine innere Stimme geraten hätte. Noch nie sagte mir mein Inneres, daß ich berufen wäre, beim Gottesdienst mitzuwirken.“
„Ich habe den Samen in dich gelegt, und wir können abwarten, ob er aufgehen wird. Schwer wäre das Amt nicht für dich; du müßtest nicht einmal hinaufsteigen aufs Minarett. Du könntest hier von der Einfriedung des Hofes aus zum Gebet rufen. Deine Stimme ist so stark, daß sie nicht eines erhöhten Ortes bedarf, um rings in der Ferne vernommen zu werden. Ich höre es im Geiste, wie von deiner prächtigen Stimme der Gebetruf erklänge. Du riefst nicht bloß die Bewohner unseres Dorfes, dein Ruf würde über das ganze Tal erschallen bis jenseits zu den Bergen; auch andere Dörfer würden ihn hören und dazwischen wäre überall dein Ruf vernehmbar, in den unzugänglichsten Klüften, wo scheue Tiere hausen, und bis hinauf zu den Vögeln in der Luft. Es wäre wahrhaft erhebend, so zum Gebete rufen zu hören.“
Über Nurijas Gesicht ging ein kaum merkliches Lächeln der Freude: „Mich hat Allah nicht eitel erschaffen. Wahrhaftig, ich finde es unvergleichlich erhebender, wenn du selbst dort oben dich über die Brüstung neigst und dein Antlitz mit dem weißen Haar und Bart so verklärt herniederschimmert, als ginge den Gläubigen ein neues Gestirn auf.“
„Ja, mein weißer Bart – siehst du, Nurija, ich scheue keine Mühe, wenn es gilt, Gott zu dienen. Aber manchmal vermag ich kaum mehr die vielen Stufen da hinauf zu bewältigen. Und hinauf muß ich, denn anders würde es bei meiner schwachen Stimme denen dort unten nicht kenntlich, daß es Zeit sei zur Andacht. Auch meine Augen werden schon schwach. Ich sehe dort oben nicht mehr, wohin ich rufe. Das untere Dorf findet mein Blick nicht, ja nicht einmal die Häuser hier neben der Džamija. Es ist so, als stünde ich über einer grauen Wolke und riefe irgendwo in das Weltall hinein.“
„Vielleicht solltest du dir unter den Jungen einen wählen, den du dir zum Muezzin erziehen könntest.“
„Ich dachte schon manchmal an Muharrem, dessen Stimme zwar nicht so kraftvoll ist wie die deine, die aber beim Gesang dem Ohre sehr angenehm ist. Freilich ist Muharrem nicht von hier; und dann hinge es von deiner Zustimmung ab, da er doch in deinem Dienste steht.“