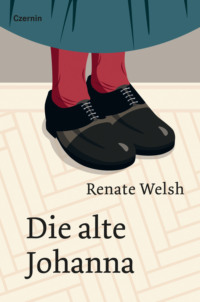Czytaj książkę: «Die alte Johanna»
Renate Welsh
DIE ALTE JOHANNA
Roman

Gedruckt mit Unterstützung der Stadt Wien, Kultur
Welsh, Renate: Die alte Johanna / Renate Welsh
Wien: Czernin Verlag 2021
ISBN: 978-3-7076-0724-6
© 2021 Czernin Verlags GmbH, Wien
Lektorat: Karin Raschhofer-Hauer
Autorinnenfoto: Christopher Mavrič
Umschlaggestaltung und Satz: Mirjam Riepl
ISBN Print: 978-3-7076-0724-6
ISBN E-Book: 978-3-7076-0725-3
Alle Rechte vorbehalten, auch das der auszugsweisen Wiedergabe in Print- oder elektronischen Medien
Inhalt
Vorwort
Die alte Johanna
Vorwort
Sie wurde meine Nachbarin, als mein Vater 1965 das völlig verwahrloste alte Bauernhaus bei einer Versteigerung kaufte mit dem Auftrag »Machts was draus«. Es ging ihm vor allem um einen Ort, wo seine Enkel barfuß herumlaufen konnten. Ich stürzte mich voll Begeisterung, aber ohne die geringste Ahnung und ohne die nötigen Mittel in die neue Aufgabe und war mehr als dankbar, wenn die Nachbarin herüberkam und mir einen Handgriff zeigte oder einen Rat gab.
Sie war so ungeheuer kompetent in allen Dingen, es ging eine Sicherheit von ihr aus, die ich nur bewundern konnte. Es schien mir, dass ihr jeder Zweifel fremd und sie völlig eins war mit ihrer Rolle als Mittelpunkt einer großen Familie, und ich beneidete ihre Töchter um diese Mutter.
In meiner Erinnerung haben Gespräche lange Zeit vor allem auf den Besen gestützt beim Straßenkehren stattgefunden – in unserem Dorf musste jahrelang jede Hausfrau vor der eigenen Tür kehren, genauer gesagt den eigenen Gartenzaun entlang. Als ich noch neu im Dorf war, machte ich einmal den Vorschlag, die zwei Nachbarinnen könnten doch zu mir ins Haus auf einen Kaffee kommen, nachdem wir bestimmt schon eine Viertelstunde lang jede auf ihren Besen gestützt getratscht hatten. Das wurde jedoch entrüstet abgelehnt, dafür hätten sie nun wirklich keine Zeit.
Es muss im Frühsommer 1968 gewesen sein, dass ich meine Nachbarin fragte, ob sie mit mir nach Gloggnitz einkaufen fahren wolle. Da müsse sie sich erst anziehen, sagte sie. Ich hatte es eilig, meinte, das sei doch nicht nötig, ich würde mich sicher nicht umziehen, sondern fahren, wie ich war. Sie musterte meine Arbeitsjeans und den labbrigen Pullover. »Sie können sich das leisten, ich nicht«, sagte sie mit einer Endgültigkeit, die keinen Widerspruch duldete.
An den Satz und an mein Erschrecken erinnere ich mich genau, ich sehe sie und mich vor ihrer Haustür stehen, sehe, wie sie sich abwendet.
Der Satz zwang mich darüber nachzudenken, warum sie ihre Fenster öfter putzte als andere Frauen, warum sie nie anders als mit sauberer Kleiderschürze durchs Dorf ging, warum ihr Hof immer makellos gefegt sein musste. Seltsam ist, dass ich keine Erinnerung daran habe, wann sie mir zum ersten Mal ihre Geschichte erzählte, obwohl alle Einzelheiten dieser Geschichte in mein Gedächtnis eingeschrieben sind.
Sie war das uneheliche Kind einer Bauernmagd, die das uneheliche Kind einer Bauernmagd war, die das uneheliche Kind einer Bauernmagd war, aufgewachsen bei Pflegeeltern, die gut zu ihr, aber selbst arm waren. Nach Beendigung der Schulpflicht wollte sie eine Lehre machen, am liebsten als Schneiderin, die Gemeinde teilte ihr mit, das wäre nur dort möglich, wo ihre Mutter »zuständig war«. Im Glauben daran, dass etwas lernen vielleicht so gut wäre wie etwas haben, entschied sie sich wegzugehen, obwohl sie Angst davor hatte. Die Fürsorgerin lieferte sie im Gloggnitzer Armenhaus ab, wo der Armenrat ihre Zähne inspizierte, ihre Armmuskeln betastete und zufrieden feststellte: »Mager, aber zäh. Du bist also meine Dirn.« Sie versuchte sich zu wehren, erklärte, man hätte ihr doch versprochen, hier könne sie eine Lehre machen. »Das wäre ja noch schöner«, entrüstete er sich, »wenn ledige Kinder schon was wollen dürften!« Seit dieser Satz sie verletzt hatte, waren mehr als dreißig Jahre vergangen, dennoch war die Narbe noch nicht völlig zugeheilt.
Ich schnappte nach Luft. Gleichzeitig mit meiner Nachbarin sah ich meine acht Jahre ältere Schwester, die es nie verwunden hatte, dass mein Vater sich zwar zu ihr bekannt, ihr aber nicht seinen Namen gegeben hatte, die sich ihrer Mutter geschämt, sie verleugnet und später verzweifelt versucht hatte, dafür Abbitte zu leisten.
Wenn ledige Kinder schon was wollen dürften. Wenn man einem Menschen das Recht abspricht, etwas zu wollen, was bleibt da übrig? Ich begann zu ahnen, was meine Nachbarin zwang, sich und der Welt etwas zu beweisen. Wenn jemand Grund hatte, etwas zu beweisen, dann ganz gewiss nicht sie.
Dieser starken Frau, die ich bewunderte, von der ich so viel gelernt hatte, saß ihre Geschichte als Last im Nacken. Langsam entstand der Wunsch, ich könnte ihr das, was ihr widerfahren war, so zurückgeben, dass sie erkannte, wie stolz sie sein musste auf das, was sie aus dem Rohmaterial ihrer Erfahrungen gemacht hatte.
Ich begann zu recherchieren, erfuhr bald, dass ihre Geschichte auch die vieler anderer Frauen ihrer Generation war. Nie werde ich vergessen, wie mir eine Sechsundsiebzigjährige mit perfekt sitzenden drei weißen Locken links, drei weißen Locken rechts, hellgraues Twinset, die Füße genau parallel nebeneinander, die Hände im Schoß gefaltet, erzählte, wie sie mit 14 Jahren zu Fuß aus ihrem Heimatdorf in Niederösterreich zum Verein Christlicher Hausgehilfinnen in Wien gegangen war, wo ihr eine vornehme Dame eine Stellung angeboten hatte. Gleich in der ersten Nacht war der Sohn des Hauses in ihrer Kammer neben der Küche gestanden, es war ihr gerade noch gelungen ihn abzuwehren. Am Morgen hatte sie vor Scham und Verzweiflung stotternd die Dame des Hauses um einen Schlüssel gebeten. Die war empört gewesen: Was sie sich einbilde, warum stelle man überhaupt ein braves Mädel vom Land an? Irgendwo müssten die jungen Herren doch lernen!
Ich fragte meine Nachbarin, ob sie damit einverstanden wäre, wenn ich ein Buch über sie zu schreiben versuchte. Sie schüttelte den Kopf, zeigte auf die Bilder meiner Vorfahren in unserem Wohnzimmer. »Wer aus einer solchen Familie stammt, kann nie verstehen, wie es einer geht, die da herkommt, wo ich herkomme.« Ich war tief gekränkt, glaubte ich doch sehr gut zu wissen, wie es ist, sich nirgends zugehörig zu fühlen, immer anzuecken, ich wollte nicht daran erinnert werden, dass ich letztlich doch privilegiert war.
Einmal erzählte sie, dass die Dienstmägde die Kühe bis Allerheiligen barfuß hüten mussten. Kurz danach kam der Rauchfangkehrer sehr zeitig am Morgen zu mir. Wir hatten noch einen schliefbaren Kamin und nur eine wackelige Leiter. Ich hatte die halbe Nacht an einer Übersetzung gearbeitet und verschlafen, meine Hündin hatte wieder einmal sowohl meine Schuhe als auch meine Pantoffel versteckt, also musste ich in Socken die Leiter halten. Die Kälte tat weh, nicht nur in den Fußsohlen, der Schmerz stieg bis hinauf in die Zähne und in die Kopfhaut. Wenn die Mädchen damals gesehen haben, wie ein Kuhfladen in der kalten Luft dampft, dann war Ekel sicher ein Luxus, den sie sich nicht leisten konnten, dachte ich, sie sind bestimmt hineingestiegen und haben es genossen, die Zehen wieder bewegen zu können. Sobald der Rauchfangkehrer gegangen war, machte ich mir eine Notiz. Noch am selben Nachmittag kam meine Nachbarin herüber, weil ihr der Essig ausgegangen war. Ich hatte gerade Kaffee gekocht und bot ihr eine Tasse an. Plötzlich lachte sie. »Wenn Sie wüssten, was wir beim Hüten getan haben, würden Sie nicht die Füße mit mir unter einen Tisch stecken. Da würde Ihnen ja grausen vor mir.« Ich sprang auf und holte meinen Notizzettel.
»Wer hat Ihnen das gesagt?«
»Niemand.«
»Woher wissen Sie’s dann?«
»Ist mir logisch vorgekommen.«
Sie sah mich zweifelnd an. Wir schwiegen beide. »Na gut«, sagte sie, »wenn Ihnen das logisch vorkommt, dürfen Sie auch ein Buch über mich schreiben.« Von da an war sie bereit, alle meine Fragen zu beantworten.
Als ich versuchte, die private Geschichte in einen größeren Zusammenhang zu stellen, wurde mir klar, dass die zwanzig Jahre zwischen 1918 und 1938 so gut wie totgeschwiegen wurden, weil eine ehrliche Auseinandersetzung damit den Mythos von Österreich als unschuldigem ersten Opfer Hitlers infrage gestellt hätte. Ich recherchierte, las Zeitungen aus der Zeit. Bald erkannte ich, wie sinnlos es war, meine Nachbarin nach Ereignissen zu fragen, die nicht in der unmittelbaren Umgebung geschehen waren. Sie hatte keine Zeitung lesen, kein Radio hören dürfen, Nachrichten drangen nur durch den Filter des Dorftratsches zu ihr durch. Also musste ich Lokalnachrichten suchen und fand schließlich im Keller eines Heimatmuseums in den Blättern von Pfarren, Gewerkschaften, Brieftauben- und Kaninchenzüchtern sowie Lokalzeitungen nicht nur Material für meine Arbeit an Johannas Geschichte, sondern zu meinem Erstaunen in einem Fahndungsblatt mit dem Titel »Gritzner, auch deine Stunde kommt!« auch einen unerwarteten Gruß von meinem eigenen Ururgroßvater, der 1848 als Revolutionär in absentia zum Tode verurteilt worden war.
»Ich hätte so gern was gelernt«, sagte meine Nachbarin oft. Vielleicht war das der Unterschied zwischen ihr und vielen anderen. Sie war hungrig nach Wissen und neugierig bis zuletzt. Darüber hinaus hatte sie eine ganz erstaunliche Menschenkenntnis und aus dieser heraus einen untrüglichen Sinn für Anmaßung. Wenn wir beispielsweise Gäste hatten, die sie auch nur kurz gesehen hatte, gab sie Kommentare ab, die sich spätestens im Nachhinein als mehr als treffend erwiesen, selbst wenn ich sie zunächst als allzu kritisch abgelehnt hatte.
Bevor ich das Manuskript im Verlag ablieferte, wollte ich es meiner Nachbarin zeigen. Sie lehnte ab. »Ich hab es leben müssen, was soll ich es lesen auch noch!«
Ihre Familie las das Buch sehr bald nach Erscheinen und sie freute sich, als sie erlebte, wie ihre Enkeltöchter ihre Geschichte verstanden und ihr Mann zu mir sagte: »Vor dreißig Jahren hätten Sie das schreiben müssen, da wäre ich ihr ein besserer Mann gewesen.«
Sie blieb bei ihrer Weigerung. Erst nach dem Tod ihres Mannes sah ich sie eines Tages mit dem Buch in der Hand im Hof sitzen. Wie eine trächtige Katze schlich ich um sie herum, traute mich nicht sie anzusprechen. Schließlich hatte ich darin auch eine Protagonistin erfunden, weil ich sie brauchte als Gegengewicht zu einer anderen. Ihr einziger Kommentar war: »Ich weiß nur nicht, wieso du auch das geschrieben hast, was ich dir nicht erzählt habe.« Ein paar Jahre später sagte sie dann: »Wir müssten einen zweiten Band schreiben, der hört ja auf, noch bevor meine Älteste auf die Welt gekommen ist.«
Wir müssten ihn schreiben. Nicht: Du müsstest ihn schreiben. Ich zögerte, Fortsetzungen sind gefährlich, auch war ich in andere Projekte verstrickt.
Vor zehn Jahren ist sie gestorben, das Dorf hat seine Mitte verloren, eine Mitte, die am unteren Rand des Dorfes lag, knapp vor der Kurve, nach der die einzige Straße als Schotterweg über die Felder führt. Wenn ich mit den Nachbarn rede, fällt sehr bald ein Satz, von dem alle wissen, dass er von ihr stammt, jemand fragt, was sie zu dieser oder jener Sache wohl sagen würde, und alle nicken. Sie lebt nicht nur in ihren Kindern und Enkelkindern.
Als ich wieder einmal über sie nachdachte, schrieb ich den Satz: Sie hat bewiesen, dass ein Mensch mehr sein kann als die Summe dessen, was ihm widerfahren ist. Das ist zu kurz gegriffen, wie wahrscheinlich jeder Versuch, einen Menschen zu definieren. Sie war klug, großzügig, lebendig, stur, unbequem, neugierig, offen. Man konnte lachen mit ihr. Nie werde ich vergessen, wie wir nach einem ungeplanten Silvesterfest bei ihr auf dem Betondeckel ihrer Senkgrube Donauwalzer tanzten. Wir waren stolz darauf, dass sie uns mochte.
Ein Kind, das im Herzen seiner Eltern keinen Platz findet, findet auch keinen Platz in der Welt, schrieb Anna Freud. Ich glaube daran, dass es immer wieder Menschen gibt, die nebenbei und ohne zu suchen einen Platz für sich finden, indem sie Platz für andere schaffen. Sie hätte natürlich nur gelacht über eine solche Erklärung und gesagt, dass sie immer nur getan hat, was gerade notwendig war, »Du kannst schließlich Leute nicht wegschicken, wenn sie vor deiner Tür stehen«. An ihrer Selbstverständlichkeit konnten Herausforderungen auflaufen, egal wie unzumutbar sie sich gebärdeten. Ich habe also die Herausforderung angenommen, über die alte Johanna zu schreiben, trotz aller Bedenken. Ich habe versucht zu formen, was in ihren Erzählungen für mich gegenwärtig wurde, was ich beobachtet habe, was ich zu verstehen glaubte. Eine chronologische Ordnung habe ich nicht gesucht, Erinnerung geht ihre eigenen Wege. Für die Ordnung war sie zuständig, gegen diese Konkurrenz wäre ich nie angetreten.
Johanna fühlte sich fremd. Nicht, dass ihr etwas fehlte, im Gegenteil, sie hatte, was sie brauchte und mehr, die Tochter kümmerte sich um alles, nie in ihrem langen Leben war sie verwöhnt worden wie jetzt.
Die Tochter hatte ihr ein schönes Zimmer eingerichtet, mit einem dreiteiligen Schrank, in dem sie ihre privaten Dinge genau so verstaut hatte wie daheim in ihrem Haus: die Pullover Kante auf Kante ordentlich gefaltet, Unterwäsche, Nachthemden, Handtaschen, Schals und Tücher in einem eigenen Fach, ebenso die Strümpfe. Blusen, Kleider, Jacken und Mäntel an Bügeln, ebenso die Kittel für die Küche. Alles war schon richtig geordnet gewesen, als sie das Zimmer zum ersten Mal betrat, an der Wand die Fotografie von ihrem achtzigsten Geburtstag mit ihren Kindern, Schwiegerkindern und Enkelkindern und den Kindern der Ziehschwester aus dem Burgenland dazu, und auf dem Nachttisch stand das Bild von ihr und Peter an ihrem 25. Hochzeitstag neben einer schmalen blauen Vase mit einer Rose darin. Martha hatte den Schrank aufgemacht und gefragt, ob alles richtig war, und sie hatte nur nicken können.
Als sie jung war, hätte der Besitz der gesamten Familie in diesen Schrank gepasst und es wäre noch Platz frei geblieben. Zwei Erwachsene, acht Kinder und nur ein Verdiener, das hieß sparen an allen Ecken und Enden, das hieß, alles selbst machen, jedes Brösel einsammeln, jeden Rest verwerten, jeden Flicken aufheben, jeden verbogenen Nagel gerade klopfen, jeden Bleistiftstummel aufheben, jede Hose, jedes Hemd flicken, jeden Pullover auftrennen, die Wolle über ein Schneidbrett gewickelt trocknen lassen, damit sie sich nicht kräuselt, nur nichts fallen lassen, jeden Groschen dreimal umdrehen. Manchmal fragte sie sich, wie sie es geschafft hatte. Acht Kinder, eine kranke Schwiegermutter, eine Kuh, ein Schwein, ein paar Hühner, später eine Ziege, ein Dutzend Kaninchen. Wasser hatte sie vom Brunnen im Hof geholt, manchmal musste sie lange pumpen, wenn die Bauern im Vorübergehen ihre Kühe getränkt hatten. Wie oft hatte sie vor Erschöpfung Mühe gehabt, aufzustehen, um ins Bett zu gehen, wenn sie sich endlich niedergesetzt hatte. Jetzt sollte sie sich zum gedeckten Tisch setzen.
»Ruh dich aus, du hast genug gearbeitet«, sagte die Tochter.
Ausruhen. Wie machte man das? Wahrscheinlich musste man es lernen, so wie man alles lernen musste. Ruhe. Schon das Wort klang seltsam in ihren Ohren. Ruhe sanft! Ruhe in Frieden! stand in goldenen Buchstaben auf Grabsteinen. Gib endlich Ruh’!
Hatte sie nicht immer geklagt, dass sie keine Zeit hatte? Jetzt schien ihr die Zeit wie ein Teig, der an den Fingern klebte, nein, schlimmer, es kam ihr vor als wäre sie in einen Topf voll Kleister gefallen oder an einem Fliegenfänger hängen geblieben.
In den Küchen im Dorf waren früher Klebebänder gehangen voll mit toten Fliegen. Manche Fliegen versuchten noch, mit den Flügeln zu schlagen, um sich zu befreien. Bei ihr hatte es das nicht gegeben. Sie hatte die Fliegen im Flug erwischt mit einer schnellen Handbewegung. Auch jetzt noch entkam ihr selten eine. Es gab aber nicht mehr so viele Fliegen, seit nur mehr ein einziger Bauer Kühe im Stall stehen hatte. Darum sah man auch kaum mehr Schwalben im Dorf.
Der Sohn ihres Ältesten ließ jetzt das Haus renovieren, in das sie geheiratet hatte vor so langer Zeit, das Haus, in dem sie sieben Kinder geboren hatte. Nur die jüngste Tochter war im Krankenhaus zur Welt gekommen. Der Herr Primar war an der Spitze eines Rattenschwanzes von jungen Ärzten in den Kreißsaal geschritten, diese Lehrbuben hatte sie gleich weggeschickt, bei ihr könnten sie nichts lernen, das sei ihr achtes Kind, das schaffe sie ganz allein. Auf dem zweiten Bett hatte sich eine junge Frau die Seele aus dem Leib geschrien und den Mann verflucht, der sie in diese Situation gebracht hatte.
Wie konnte eine Frau so dumm sein, die Kraft zu vergeuden, die sie doch für die Arbeit des Gebärens brauchte? Je älter Johanna wurde, umso öfter stellte sie fest, dass manchen Leuten wirklich nicht zu helfen war. Es gab solche und solche, das hatte sie schon immer gesagt, aber leider mehr solche.
Gebären war Arbeit, ziemlich schwere Arbeit. Sterben übrigens auch. Beim Einen wie beim Anderen taten sich manche schwerer als andere. Am schwersten taten sich die, die immer glaubten, sie müssten überall das Sagen haben, das hatte sie schon oft festgestellt. Man musste lernen, die Dinge geschehen zu lassen, dann wurden sie zwar auch nicht unbedingt leichter, aber erträglich.
Alles hatte sie zurückgelassen, die Möbel, das Geschirr, den ganzen Hausrat, die Jungen hätten einfach einziehen können, aber das wollten sie nicht, natürlich nicht, die Zeiten hatten sich geändert. Sie wollte gar nicht daran denken, wie froh sie über ein solches Angebot gewesen wäre als junge Frau. Manches war besser geworden, vieles sogar, aber nicht alles, alles wirklich nicht. Und das betraf nicht nur sie und die Tatsache, dass sie manchmal drei Anläufe brauchte, um auch nur aus dem Sessel aufzustehen. Manchmal war sie wütend auf diesen alten Körper, der sie vor den Leuten blamierte. Sie hasste es, wenn er sie im Stich ließ. Ihr Leben lang hatte sie sich auf sich selbst verlassen können.
Wie still es hier war. Kein Traktor tuckerte, keine Kreissäge kreischte, kein Rasenmäher röchelte. Kein Hundegebell, keine quietschende Tür, kein Schrittegetrappel vor ihrem Fenster. Selten fuhr ein Auto vorbei.
In ihrer Küche zu Hause hatten sich die Besucher die Klinke in die Hand gegeben. Manchmal war sie auf der Eckbank eingeschlafen und war hochgeschreckt, weil jemand ihr gegenübersaß und ihr beim Schlafen zuschaute.
Wer keine Freunde hat, ist arm.
Dies Haus ist reich.
Der Spruch war, auf Stramin gestickt, in einem Rahmen, den Peters Vater geschnitzt hatte, über der Tür zwischen Vorhaus und Küche gehangen. Peter hatte den Rahmen in Ehren gehalten. Sie hätte ihn mitnehmen sollen. Es wäre nicht recht, wenn er im Müll landete.
In ihrem eigenen Haus hätte sie jetzt Kaffee aufgesetzt. Ihr Leben lang hatte sie gekocht, hatte sie im Herd Feuer gemacht, auch bei Niederdruckwetter, wenn der Kamin nicht ziehen wollte, ihr war es immer gelungen, eine ordentliche Glut zustande zu bringen. Warum sollte sie das jetzt nicht mehr können?
Mehr als einmal hatte Martha ihr den Wasserkessel aus der Hand genommen, sie war wütend in ihr Zimmer gegangen. Was sollte das? Messer, Gabel, Scher’ und Licht sind für alte Weiber nicht, oder was? Die Tochter meinte es gut, das wusste sie, natürlich wusste sie das, nur bedeutete es noch lange nicht, dass sie damit einverstanden sein musste!
Zugegeben, sie war zweimal gestürzt, hatte sich das Hüftgelenk gebrochen. Unfälle passierten eben, passierten auch Jüngeren. Sie hatte sich ja auch drein gefügt, zur Tochter zu ziehen, zu dieser Tochter, die ihr von allen Kindern am ähnlichsten war und doch auch wieder ganz anders. Wie war denn das möglich, ganz ähnlich und ganz anders zugleich? Möglich war es nicht, aber wahr.
Sie hatte nicht gedacht, dass es so schwer werden würde. Es ging ihr gut, sie hatte keinen Grund zur Klage und beklagte sich auch nicht. Jammern und Raunzen war nie ihre Sache gewesen, das hatte sie anderen überlassen, die nichts Besseres zu tun hatten. Sie hatte nur nicht gewusst, wie sehr sie ihr Haus vermissen würde.
Das Haus am Rande des Dorfes, am unteren Ende. Eigentlich lächerlich, dass es bei einem so kleinen Dorf ein oberes und ein unteres Ende geben sollte, und doch war es so. Oberhalb der Hollerstaude gegenüber der winzigen Kapelle waren die Besseren, unterhalb war das rote Gesindel. Heute wollte natürlich keiner mehr davon wissen, dass er das gesagt hatte, oft und oft. »Haben nichts, sind nichts, aber jedes Jahr ein Kind!« Sie straffte sich. Acht Kinder, jawohl, acht Kinder hatte sie geboren, und stolz war sie auf jedes von ihnen. Alle hatten sie ihren Weg gemacht, die Töchter genauso wie die Söhne.
»Aus denen kann nichts werden«, hatte der Direktor der Volksschule gesagt, »bei der Familie! Ich bitte Sie, hat doch keinen Sinn, einen von denen in die Hauptschule zu schicken.« Also waren alle acht Kinder in die Volksschule gegangen, acht Jahre lang. Mehr war nicht drin, mehr konnten sie sich nicht leisten.
Dreißig – oder waren es vierzig, vielleicht sogar fünfzig? – Jahre später bekam ihr ältester Sohn den Titel »Professor« verliehen, und wer stand da unter den Gratulanten, weniger Haare auf dem Kopf, aber immer noch mit durchgedrücktem Steiß? Nicht aufhören konnte er, ihr die Hand zu schütteln. »Ich habe ja immer schon gewusst, dass in Ihrem Sohn etwas Besonderes steckt, und ich bin stolz darauf, sein erster Lehrer gewesen zu sein.« Es war ihr auf der Zunge gelegen, ihn daran zu erinnern, was er wirklich gesagt hatte. Den ganzen Weg nach Hause hatte sie sich geärgert, dass sie es nicht getan hatte. Hatte nur ihre Hand zurückgezogen und sich die Nase geputzt.
Nie hatte er Zeit, der Sohn, kam immer nur für ein paar Minuten, hatte hier eine Probe, dort eine Veranstaltung in der Musikschule oder als Hornist, und seit er nicht mehr im Orchester spielte, hatte er noch mehr zu tun als früher. In seinem großen Haus machte er jede Reparatur selbst, tischlerte, tapezierte, malte, sogar Schmiedearbeiten schaffte er, und seit Kurzem hatte er auch noch die Pflege seiner Schwiegermutter übernommen. Es gab einfach nichts, wo er nicht Hand anlegte, und was immer es war, tat er mit vollem Einsatz, als hinge sein Leben davon ab.
»Nur für seine Mutter hat er keine Zeit«, murmelte sie.
»Hast du was gesagt, Mama?«, rief die Tochter aus der Küche.
»Ich? Nein.«
Das wäre ja noch schöner! Wie hieß es doch? Eine Mutter kann sechs Kinder versorgen, sechs Kinder können eine Mutter nicht versorgen. Nein, dachte sie, ich bin ungerecht. Ich mag mich nicht versorgen lassen. Ich versorge lieber. Es schauderte sie bei dem Gedanken, sie könnte jemals so abhängig werden wie die Schwiegermutter ihres Sohnes, nackt und hilflos daliegen vor einem anderen Menschen.
Wie hatte sie diese Frau beneidet um ihre Stellung, um die Selbstverständlichkeit, mit der sie annahm, dass die guten Dinge ihr gebührten, ihr, der Tochter aus gutem Haus. Es hatte eine Zeit gegeben, da hatte die Frau ihren Schwiegersohn spüren lassen, dass er nicht gerade die erste Wahl für ihre Tochter gewesen war. Jetzt war er es, den ihre flackernden Blicke suchten, der Einzige, der sie beruhigen konnte, wenn die große Angst sie in den Krallen hatte. Es gab weiß Gott keinen Grund mehr, mit ihr tauschen zu wollen. Hilflos sein war ohnehin das Schlimmste, und dazu kam noch, dass ihr einziger Sohn, ihr verwöhnter Liebling, sich nicht blicken ließ, seit er Pleite gemacht hatte. Vielleicht hatte er einen Rest Anstand und schämte sich vor seiner Mutter, dabei war das ohnehin für die Katz, denn die bekam nichts mehr mit und hielt ihn immer noch für den Größten, diesen Trottel, der seine Zigarren mit Hunderternoten angezündet und seine Schulden nicht bezahlt hatte.
Es ist doch komisch, dachte Johanna, meine Schwiegertochter ist aufgewachsen in einem großen Haus, sie hat studieren dürfen und war eigentlich doch ein armes Mädel, die eigene Mutter hat sie nicht gemocht. Wenn sie heute zu ihr ins Zimmer kommt, fragt die, wer die fremde Person ist, und waschen lässt sie sich überhaupt nur von meinem Buben, der ihr nicht gut genug war als Schwiegersohn.
Johanna blickte hinaus in den Garten ihrer Tochter.
Ihr Hof daheim war bestimmt voll von herabgefallenen Blättern. Sicher wuchsen Löwenzahn, Hühnerdarm, sogar Disteln ungestört zwischen den Kieseln. Ihr Hof, den sie Tag für Tag gekehrt hatte, der sauberer war als gewisser Leute Küchenboden. Es juckte sie in den Fingern, aufzustehen und einen Laubrechen in die Hand zu nehmen. Aber die Tochter würde sofort schimpfen, und abgesehen davon war der Garten hier sowieso in bester Ordnung. Das hatten die Töchter von ihr gelernt, eine wie die andere, nicht einmal die ärgsten Schandmäuler hätten ihnen etwas nachsagen können.
Diese Unruhe in ihr, diese schreckliche Unruhe.
Ihr Blick fiel auf das Foto an der Wand, das die Tochter hatte rahmen lassen. Mit sechs Kindern sitzt sie da auf den Balken, die nach dem Brand vom Dachstuhl ihres Hauses übrig geblieben waren. Hätte man das nicht gewusst, würde man glauben, es handle sich um ein Bild von einem vergnügten Sonntagsausflug, eine strahlende junge Mutter mit sechs hübschen blonden Kindern an einem Frühlingstag. Die Frieda, der Thomas, die Bärbel, der Bernhard, der Klaus, die Martha. Die Linda ist noch in ihrem Bauch und die Ulli nicht einmal das. Das Kleid, das sie trägt, hat sie sich von einer Nachbarin für das Foto ausgeborgt, man will sich ja nicht genieren, die Kleider der Mädchen hat die Pürklmutter aus den abgelegten Sachen irgendwelcher Leute gezaubert. Die Haare der Kinder glänzen frisch gewaschen in der Sonne. Wie fröhlich sie aussehen.
Die Pürklmutter. Die kleine, gehörlose Frau wohnte mit ihrem ebenfalls gehörlosen Mann und den vier Töchtern im Hinterhaus. Nachdem ihr Mann gestorben war und die Pürklmutter zu einer ihrer Töchter ins Tal gezogen war, merkte man erst, wie nass die Wände waren. Die Ziegel zerbröselten richtig, wenn man sie nur antupfte. Aber solange Tag und Nacht Feuer im Herd gebrannt hatte, war die kleine Wohnung ein freundlicher Ort gewesen. Der Pürklvater hatte das Schusterhandwerk bei Peters Vater gelernt, so waren sie wohl auf den Hof gekommen. Anfangs war Johanna der große schweigsame Mann fast unheimlich gewesen, doch hatte sie sich bald an ihn gewöhnt, er doppelte die Schuhe ihrer Kinder, auch wenn sie nicht zahlen konnte. Die meiste Zeit zog er sich in das winzige Stübchen zurück, wo er Roseggers Waldheimat in allen Einzelheiten aus Zündhölzchen baute und Roseggers Hut und Spazierstock in hohen Ehren hielt. Frau und Töchter waren ständig bemüht, es ihm in allen Dingen recht zu machen, sie hatten großen Respekt vor seiner Bildung. Die hatte er sich selbst erobert, die war ihm nicht geschenkt worden. Gar nichts war ihm geschenkt worden. Mit sieben oder acht Jahren hatte ihn sein Vater im Suff so lange auf den Kopf geprügelt, erzählten die Leute, bis er sein Gehör verloren hatte. Die Pürklmutter war von Geburt an taub, eine gute Schneiderin war sie, eine vorzügliche Köchin, vor allem aber die Einzige im Dorf, die wirklich zuhören konnte, auch wenn das verrückt klang.
Zuhören, das konnte die Pürklmutter, zuhören mit dem ganzen Körper. Wenn sie zuhörte, veränderte sich ihre Haltung, in ihrem kleinen Gesicht führten die Falten ein eigenes Leben. Es kam auch auf die Tonlage an: Ihre Enkelin, die jahrelang bei den Großeltern gelebt hatte und als Erwachsene Lehrerin für Gehörlose wurde, verstand sie öfter als alle anderen.
Wie oft hatte sich Johanna vorgenommen, die Pürklmutter zu besuchen, nachdem sie ausgezogen war. Nie hatte sie sich aufgerafft, immer war etwas dazwischengekommen, und dann war es zu spät. Schön war das Begräbnis der alten Frau gewesen, so viele Leute, herrliche Blumen. Sterben hatte sie müssen, um so viele Blumen zu bekommen.
Plötzlich stand Marthas Sohn Jakob vor Johanna. »Oma, hast du geschlafen?«
»Wieso?«
Wie ähnlich er seinem Großvater sah, besonders wenn er lachte wie jetzt. Die Tochter brachte Kaffee und Kuchen, später kamen noch die jüngste und die zweitälteste Tochter dazu. Johanna stellte wieder einmal fest, dass die Töchter von Monat zu Monat undeutlicher redeten, aber sie klagte nicht darüber, es störte sie nicht besonders, wenn sie nur zum Teil verstand, was gesagt wurde. Die freundliche Stimmung genügte, hin und wieder ein Wort, das klar aus dem Gemurmel hervortauchte, ein Lachen, das die Runde machte.
»Ob du am Sonntag zu uns kommen magst, hab ich gefragt? Grillen.«
»Nur wenn du mich abholst.«
Mit den Augen seines Großvaters zwinkerte er ihr zu.
Wenn sie den Enkel anschaute, konnte die Trauer um ihren Mann sie überfallen, als wären nicht mehr als zwanzig Jahre seit seinem Tod vergangen, gleichzeitig schob sich die Erinnerung an den hilflosen Kranken, der ihr Mann in seinem letzten Jahr gewesen war, vor den Anblick seines kraftstrotzenden Enkels, und sie legte die Hände ineinander. Es ist gut, wie es ist, murmelte sie tonlos.
Zwischen Schlaf und Wachen sieht sie ihren Mann vor sich. In der sonnigsten windgeschützten Ecke im Hof, zwischen Hausmauer und Schuppen, liegen, auf einem alten Leintuch angeordnet, sämtliche Teile seines alten Mopeds, säuberlich gereinigt und geölt. Wie immer watschelt sein kleiner Schatten mit Windelhintern hinter dem Opa her, natürlich will er wissen, was da los ist. »Das Moped ist krank.« Der Bub marschiert ins Schlafzimmer, so schnell kann sie gar nicht schauen, holt das Babypuder vom Wickeltisch und beginnt, die Teile des Mopeds einzustauben. »Moped wehweh«, erklärt er dazu. Zornbebend hebt Peter den Kleinen am Hosenbund hoch, schleppt ihn in die Küche und überreicht ihn ihr. »Da hast du deinen Enkel!« Sooft das Bild in ihr aufsteigt, muss sie kichern. Die unterdrückte Wut ist ihm ins Gesicht geschrieben, sein Moped ist sein Heiligtum, aber den Enkel würde er nie anrühren.