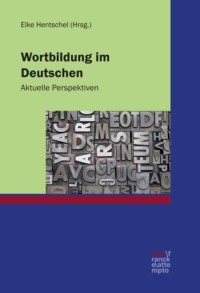Czytaj książkę: «Wortbildung im Deutschen»
Wortbildung im Deutschen
Aktuelle Perspektiven
Elke Hentschel
Narr Francke Attempto Verlag Tübingen

© 2017 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG
Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
www.francke.de • info@francke.de
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
E-Book-Produktion: pagina GmbH, Tübingen
ePub-ISBN 978-3-8233-0008-3
Inhalt
Zu diesem Band
A Allgemeines
Zwischen Verbalparadigma und Wortbildung 1 Fragestellung und Vorgehen 2 Infinitivkonversionen: Beobachtungen 3 Analyse der Belege 4 Infinite Verbalformen im Deutschen 5 Sprachvergleich: Konverben 6 Abschließende Bemerkungen Abkürzungsverzeichnis Literatur Quellen für Sprachbelege: Monographien Quellen für Sprachbelege: Internetquellen
Der Einfluss von Sprachkontakt und Silbenstruktur auf die Wortbildung 1 Einleitung 2 Neue Suffixe durch Entlehnung 3 Entlehnung von Wortbildungsmustern 4 Neue Suffixe durch Einfluss auf der Ebene der Silbenstruktur Literatur
AQ + IS 1 Einleitung: Vorhaben und Vorgehen 2 Akronyme und Kurzwortforschung 3 Die Referenzialisierungen terroristischer Gruppen in deutschsprachigen Medien 4 Kleiner Exkurs zum sogenannten Islamischen Staat (IS) 5 Einige Hypothesen zu Organisationsakronymen Literatur
Ist die Nominalisierung von Partikelverben im Deutschen Argument für deren lexikalische Bildung?1 Einführung2 Verbpartikeln im Deutschen2.1 Das Problem der Kategorisierung2.2 Kopfpositionen im Verbalkomplex2.3 Verbpartikeln als Wortglieder?3 Nominalisierung als Beweis für die lexikalische Bildung von Partikelverben?3.1 Nominalisierung von komm- und ihre Eigenschaften3.2 Nominalisierung vs. Nominalkomposition4 Schluss: Wie werden also Partikelverben nominalisiert?Literatur
B Historisches
Wissensvermittlung durch Substantivkomposita im frühmittelalterlichen Kloster1 Einleitung2 Materialgrundlage und Untersuchungsgegenstand2.1 Das Korpus: Notkers althochdeutsches Übersetzungswerk2.2 Untersuchungsgegenstand: Substantivkomposita3 Theoretischer Rahmen: Kulturanalyse3.1 Was ist Kultur? – Begriffsbestimmung3.2 Kulturtansfer und Rekontextualisierung4 Beispielanalysen4.1 Metaphorische Substantivkomposita zur Bezeichnung theologischer Konzepte4.2 Übersetzung lateinischer Fachbegriffe mit Substantivkomposita5 ZusammenfassungLiteraturPrimärliteraturSekundärliteratur
Wortbildung und Syntax von Abstrakta bei Friedrich Schiller 1 Einführung 2 Statistische Angaben zu ung-Abstraktum vs. substantiviertem Infinitiv 3 Konkurrenz von ung-Abstraktum und substantiviertem Infinitiv 4 Komposita mit ung-Abstraktum und substantiviertem Infinitiv im Vorderglied 5 Der morphologische Wandel 6 Fazit Literatur
C Toponomastisches
Toponymische Komposita in einem schweizerdeutschen Dialekt: vom nichttoponymischen Sprachgebrauch abweichende Wortakzentverhältnisse1 Vorbemerkung2 Zur Fragestellung3 Komposita4 Untersuchungsmaterial5 Erste Auswertung5.1 Erster Erklärungsansatz: Personnennamen im Erstglied5.2 Zweiter Erklärungsansatz: rechts erweiterte/postdeterminierte Namen5.3 Dritter Erklärungsansatz: Übertragung der Finalbetonung auf typisch toponymische Appellative/Topofixe5.4 Vierter Erklärungsansatz: Finalbetonung als verallgemeinerter Marker der Toponymizität?5.5 Zur regionalen Ausbreitung6 FazitLiteratur
Neue Wörter als Grundlage für hessische Flurnamen? 1 Einleitung und Hintergrund der Abhandlung 2 Konzeptionelle außersprachliche und sprachliche Grundlagen 3 Ergebnis 4 Auswertende Zusammenfassung 5 Abschließende Kritik Literatur Anhang: hier behandelte Flurnamen, deren Dorfzugehörigkeiten, Typisierungen, mündliche Nennungsfrequenzen und Sachbezeichnungen
D Dialektologisches
Von Blätterchen und Bäumchen: Die Entwicklung der Plural-Diminutive und Diminutiv Plurale im Deutschen und Luxemburgischen1 Einleitung und Zielsetzung2 Der Plural-Diminutiv in den Varietäten2.1 Deutsch2.2 Moselfränkische Dialekte2.3 Luxemburgisch3 Rückgang im Deutschen und Moselfränkischen – Erfolgsmodell im Luxemburgischen4 Synchrone Interpretation der Plural-Diminutive5 FazitLiteratur
Von Gäul-s-bauer, April-s-narr und Getreid-s-gabel. Die Verwendung und Verbreitung des Fugen-s im Ostfränkischen1 Einführendes2 Die Kompositionsstammform3 Systematik der Fugenelemente des Deutschen4 Zur Funktionalität der Fugenelemente – Überblick über den aktuellen Forschungsstand4.1 Fugenelemente als Kasus- und Numerusmarker4.2 Phonetisch-phonologische Funktionsweisen der Fugenelemente4.3 Morphologisch-funktionale Aspekte des Fugen-s5 Korpusanalyse: Zur Datengrundlage und Methodik6 Untersuchungsergebnisse6.1 Das Fugen-s nach Simplizia6.2 Verfugung und Kontraktion6.3 Fugen-s nach derivationsmorphologisch komplexen Erstgliedern7 Zusammenfassende Darstellung des Analyseergebnisses und AusblickLiteratur
E Sprachvergleichendes
Reduplikationen im Thailändischen und ihre Entsprechungen im Deutschen1 Einleitung2 Reduplikation im Deutschen und im Thailändischen2.1 Reduplikation im Deutschen2.2 Reduplikation im Thailändischen3 Daten und Analysemethode4 Ergebnisse4.1 Übersicht der thailändischen Reduplikationen bei den einzelnen Kurzgeschichten4.2 Funktionen der thailändischen Reduplikationen und ihre Entsprechungen im Deutschen4.3 Deutsche Entsprechungen thailändischer Reduplikationen4.4 Deutsche Wortbildungsmittel als Entsprechungen der thailändischen Reduplikationen5 Schlussbemerkung und AusblickLiteratur
Konstruktionsmorphologie – echt top?1 Einführung2 Zur Etymologie von dt. Top(-)/top(-)3 Die Verwendung von dt. Top(-)/top(-)3.1 Lexikographische Daten3.2 Korpusdaten4 Zum kategorialen Status von dt. Top(-)/top(-)5 Der konstruktionsmorphologische Ansatz6 ‚top‘ im Sprachvergleich6.1 Niederländisch6.2 Schwedisch7 SchlussbemerkungenLiteratur
Das Vollverb fahren mit seinen möglichen Kombinationen mit trennbaren und untrennbaren Präfixen und die Äquivalente im Albanischen1 Einleitung2 Wortbildung des Verbs kontrastiv: Deutsch – Albanisch3 Derivation3.1 Präfixderivation3.2 Suffixderivation3.3 Zirkumfigierung4 Komposition5 Konversion6 Rückbildung7 fahren als Präfix- und Partikelverb8 Korpusanalyse9 ZusammenfassungLiteratur
Deutsche Substantivkomposita und ihre Entsprechungen im Albanischen1 Einleitung2 Substantivkomposita im deutsch-albanischen Vergleich3 Die Entsprechungstypen der deutschen Komposita im Albanischen3.1 Entsprechungstyp I: dt. Substantivkompositum → alb. Wortgruppe im Genitiv3.2 Entsprechungstyp II: dt. Substantivkompositum → alb. Ablativ-Wortgruppe3.3 Entsprechungstyp III: dt. Substantivkompositum → alb. adjektivische Wortgruppe3.4 Entsprechungstyp IV: dt. Substantivkompositum → alb. Simplex oder Derivat3.5 Entsprechungstyp V: dt. Substantivkompositum → alb. Substantivkompositum3.6 Entsprechungstyp VI: dt. Substantivkompositum → alb. präpositionale Wortgruppe4 ZusammenfassungLiteratur
Verzeichnis der Autorinnen und Autoren
Sachregister
Zu diesem Band
Der vorliegende Sammelband möchte einen Überblick über den Stand der Forschung zur deutschen Wortbildung und damit in einem Bereich der deutschen Grammatik geben, der in den letzten Jahren eher wenig Beachtung gefunden hat. Dies erstaunt insofern, als es wohl kaum einen Aspekt der Morphologie des Deutschen gibt, der lebendiger ist und produktiver genutzt wird als die Wortbildung. Umso wichtiger scheint es, die aktuellen Ansätze in diesem Arbeitsgebiet in einem Sammelband zusammenzufassen.
Der Blick auf den Gegenstand erfolgt dabei aus vier ganz unterschiedlichen Perspektiven, um so in der Summe ein möglichst umfassendes Bild zu ergeben. Vier Beiträge zu eher grundsätzlichen Fragestellungen bilden den unter „Allgemeines“ zusammengefassten ersten Teil des Bandes, in dem es um Grenzen zu Flexionsmorphologie und Syntax (Hentschel), um Sprachkontaktphänomene (Hofer), um Akronyme (Kromminga) und um die Deutung der Nominalisierungsprozesse bei Partikelverben geht (Öhl). Es folgen zwei Beiträge, die sich mit der Geschichte der Wortbildung befassen, indem sie Komposita in den Schriften Notkers III. von St. Gallen (Raag) sowie Abstrakta bei Schiller (Lühr) untersuchen. Auch toponomastischen sowie dialektologischen Aspekten sind je zwei Beiträge gewidmet: Zum einen geht es um spezifische Wortakzentverhältnisse bei Ortsnamen (Fetzer) und um neue Wörter als Grundlage für Flurnamen (Gerhardt), zum anderen um Diminutiva im luxemburgisch-moselfränkischen Übergangsgebiet (Edelhoff) und um das Fugen-s im Ostfränkischen (Nickel). Abgerundet wird die Behandlung des Themas durch vier Beiträge sprachvergleichender Art, in denen das Thailändische (Attaviriyanupap) und das Albanische (Hamiti und Sadiku/Rexhepi), aber auch das Niederländische und Schwedische mit herangezogen werden (Battefeld/Leuschner/Rawoens). Auf diese Weise entsteht ein Panoramabild des Gegenstandes und zugleich ein Einblick in die aktuelle Forschung in diesem Bereich der Morphologie.
Bern, im September 2016 Elke Hentschel
A Allgemeines
Zwischen Verbalparadigma und WortbildungWortbildung
Elke Hentschel
Abstract
The following paper attempts a systematisation of the extended infinitive constructions in spoken as well as in written German. There seem to be almost no limits to their extension. And while structures like Abendessen or Gefühlsleben can clearly be categorised as word formation, this is not the case with constructions like das Sich-nichts-anmerken-lassen, beim heimlich Pornos gucken or das „nichts gesehen haben wollen“. This type of construction can be found in abundance in internet communication (blogs, bulletins boards etc.), but also in written forms of communication like advice books, which are supposed to be more formal in style. I will propose the hypothesis that the constructions we are dealing with here fulfill the same function as converb constructions in languages like Turkish and can therefore be considered equivalent.
1 Fragestellung und Vorgehen
Im folgenden Beitrag soll diskutiert werden, welchen Status InfinitiveInfinitiv in Konstruktionen wie beim heimlich(en) Lauschen oder (Anweisung) zum richtig Sprechen haben. Handelt es sich dabei um ein Phänomen, das im weitesten Sinne der WortbildungWortbildung zuzuordnen ist, also substantivierte Infinitive mit verschiedenen Arten von Attributen, oder muss man die Formen dem Verbalparadigma zuordnen? In letzterem Fall wäre zusätzlich zu fragen, ob die Bildungen dann als gewöhnliche Infinitive zu betrachten wären oder ob man eine davon zu unterschiedene eigene Form ansetzen sollte (und wenn ja: welche).
Zur Diskussion dieser Fragen werden verschiedene, insbesondere aus Internetquellen zusammengestellte Belege für den Konstruktionstyp vorgestellt und im Hinblick auf ihre syntaktische Umgebung analysiert. Ferner werden die Syntagmen vergleichbarer Konstruktionen aus einer agglutinierenden Sprache, hier: dem TürkischenTürkisch, gegenübergestellt.
2 Infinitivkonversionen: Beobachtungen
Jeder InfinitivInfinitiv des DeutschenDeutsch lässt sich substantivieren, ohne dabei seine Form zu verändern; er bekommt dann das Genus Neutrum zugewiesen und kann syntaktisch wie jedes andere Substantiv verwendet werden. Darüber, ob bzw. in welchem Ausmaß diese Infinitivkonversion der WortbildungWortbildung zuzurechnen ist, lässt sich allerdings diskutieren: „Die Zahl tatsächlich geläufiger Konversionsprodukte hält sich in Grenzen“, schreiben Fleischer/Barz (2012: 270) und fahren fort: „Die Infinitivkonversion ist weniger ein Mittel zur Bereicherung des Wortschatzes (obwohl auch diese Seite nicht fehlt) als vielmehr ein syntaktisch relevantes Nominalisierungsverfahren.“ (ibd.: 271).
Zweifellos sind zahlreiche substantivierte InfinitiveInfinitiv vollständig lexikalisiert. Sie bezeichnen oft Konkreta und unterscheiden sich dann deutlich von ad-hoc-Konversionen. Diese können aber unabhängig von der lexikalisierten Form stets ebenfalls nach wie vor gebildet werden; cf. etwa Das Essen steht auf dem Tisch vs. Das Essen fiel ihm schwer oder Das Schreiben ist in der Post vs. Das Schreiben ist ihre Berufung. Klar von WortbildungWortbildung kann man nach Fleischer/Barz (ibd.) vor allem dann sprechen, wenn „der bereits substantivierte Infinitiv als Zweitglied auftritt […] (Abend|essen, Gefühls|leben).“ Allerdings sind die Grenzen auch hier nicht ganz so trennscharf, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag, denn es finden sich mit Leichtigkeit Belege wie Lass uns abendessen oder Lass uns abendessen gehen,1 in denen die KompositionKomposition klar als verbaler Infinitiv zu deuten ist. Die Definition von Fleischer/Barz (ibd.) ist aber trotz solcher Überlegungen vom Grundsatz her durchaus überzeugend, und mit ihr lassen sich Fälle wie die folgenden somit klar als Wortbildung kategorisieren:2
beim gemeinsamen Kuchenbacken
die Sache mit dem Frühaufstehen
Genderkritisches Kindererziehen
Tipps fürs Kaffeekochen
Auch wenn man darüber diskutieren könnte, ob hier bereits lexikalisierte Formen vorliegen, ist die Bedingung „bereits substantivierter InfinitivInfinitiv als Zweitglied“ mit das Backen, das Aufstehen, das Erziehen, das Kochen im Grunde durchaus gegeben, und gegen die Interpretation der Formen als Substantive spricht auch im jeweiligen Kontext nichts.
Dass es dennoch nicht ganz so einfach sein kann, zeigt der Blick auf ein Beispiel wie dieses:
beim Pornos gucken aufm Handy
Unabhängig von der Schreibweise – man könnte natürlich auch Pornosgucken schreiben – sträubt man sich hier vermutlich intuitiv, WortbildungWortbildung anzunehmen, und würde in Pornos eher ein Objekt zum InfinitivInfinitiv gucken sehen. Und in der Tat. Bei näherem Hinsehen würde sich auch bei den obigen Beispielen bei einer Getrenntschreibung der Bestandteile, wie sie sich durchaus gelegentlich findet (etwa in Belegen wie: Und das Beste am Kuchen backen), eine solche Interpretation anbieten. Dass es in der Tat gute Gründe dafür gibt, keine Wortbildung anzusetzen, zeigen auch Beispiele wie
beim heimlich Lauschen
Anweisung zum richtig Sprechen3
etc., bei denen – anders, als dies etwa bei einer Konstruktion wie beim heimlichen Lauschen der Fall wäre, – eindeutig ein Adverbial vorliegt. Dafür, dass beide Typen auch problemlos kombiniert werden können, lassen sich ebenfalls leicht Beispiele finden, so etwa dieses:
stellt euch einfach schlauer an beim heimlich Pornos gucken
Technik zum heimlich Filme aufnehmen
Diese Art der Kombination von Infinitiven mit allen möglichen für ein VerbVerb (nicht aber für ein Substantiv) typischen Zusätzen kommt, wie man schnell feststellen kann, außerordentlich häufig vor. Sie findet sich vor allem, aber keineswegs nur bei konzeptioneller Mündlichkeit. Aber eine Wendung wie zum Aus-der-Haut-Fahren hat Eingang in den Rechtschreib-Duden gefunden, ohne als umgangssprachlich markiert zu werden, und auch sonst ist der Konstruktionstyp an vielen Stellen bereits in die konzeptionelle Schriftlichkeit eingedrungen, wie das folgende Beispiel exemplarisch belegen mag:
Gemäß einer offiziellen als auch informellen Polizeikultur gelten die Härte-gegen-sich-und-andere, das Zähne-zusammen-beißen, das Sich-nichts-anmerken-lassen als handlungsleitende Wertvorstellungen. (Schlee 2008: 165)
Die Stilebene, die sich hier in der Wortwahl manifestiert, läuft jeglicher Annahme einer konzeptionellen Mündlichkeit deutlich zuwider. Dass die Form dennoch nicht als selbstverständlicher Bestandteil der Schriftsprache angesehen wird, lässt sich allerdings nicht zuletzt aus der Tatsache ableiten, dass die Wahl der korrekten Schreibweise in solchen Fällen Probleme macht. Außer zu Bindestrichen, wie sie auch der Rechtschreib-Duden verwendet, greifen die Schreibenden zu völlig unterschiedlichen Lösungen. Ganz ohne Markierung kommt etwa das folgende Beispiel aus:
[…] denn das tägliche Brote schmieren, Hausaufgaben kontrollieren und Vokabel abfragen wird uns für ein paar Wochen erlassen.
Aber auch die Markierung der gesamten Form als eine Art Zitat findet sich:
[…] obwohl das „sich einfach nicht mehr melden“ nur von ihm ausging.
Ebenso schwanken Groß- und Kleinschreibung in den gesammelten Belegen stark. In der Mehrzahl der Fälle werden die InfinitiveInfinitiv jedoch auch beim Vorhandensein eines Artikels nicht groß geschrieben, was den vorsichtigen Schluss nahe legt, dass sie von den Schreibenden nicht als Substantivierungen, sondern als Verbformen wahrgenommen werden.
Was den Umfang der Erweiterung der InfinitiveInfinitiv betrifft, so scheint es hier keine Beschränkungen zu geben, wie die nachfolgende kleine Beispielsammlung illustriert:
Dass einen in der ÖVP das „offen seine Meinung“ Sagen schon zur „Kapazität“ macht […]
Und das sich ständig beklagen […], das kann ich nachvollziehen.
[…] für mich ist das ständige sich-Beklagen-über-alles DIE typisch deutsche Eigenschaft schlechthin.
Viel Spass schon ma [sic!] beim Geld für Laser sammeln, Herr […]
[…] Musik, die sich perfekt beim Für-die-Party-Zurechtmachen hören lässt, […]
Habe mir heute beim fürs Mittagessen gemüseschneiden so stark in den Daumen geschnitten […]
[…] weil mein auf ihn einreden echt überhaupt nichts bringt.
[…] zunächst, um Jedem beim Sich-Einander-Vorstellen in spaßvoller und interaktiver Weise zu helfen […]
sie macht es wieder, also das alles besser wissen und ständig fragen warum ich […]
Das letzte Beispiel enthält sogar einen Nebensatz, der die Funktion des Objekts zum InfinitivInfinitiv übernimmt.
Daneben lassen sich auch substantivierte Modalverben beobachten, die Vollverben bei sich haben, von denen ihrerseits wieder weitere Elemente abhängig sind:
[…] dass Dir genau dieser Zustand und das Sich-ständig-beklagen-können besonders gefällt […]
Das Sich-Verstecken-Wollen sei ein Merkmal seiner Kunst.
[…] das „nichts gesehen haben wollen“.
[…] eine Verleugnung und Abspaltung der Affekte sowie das ständige Kontrollieren-Müssen von Beziehungen […] (Hirsch 2004: 185)
3 Analyse der Belege
Die beobachtbaren Konstruktionen weisen unterschiedliche Eigenschaften auf, die wiederum verschiedene Zuordnungen der jeweils vorliegenden Verbform als VP oder NP nahelegen. So zeigen sich neben dem Artikel oder Possessivum, deren Vorhandensein Bedingung war, damit das Beispiel in die Sammlung der zu untersuchenden Formen aufgenommen wurde, und die natürlich alleine schon ein deutlicher Hinweis auf SubstantivierungSubstantivierung sind, auch kongruierende Adjektivattribute (wie in das ständige sich-Beklagen, das tägliche Brote schmieren). Solche Attribute können, ebenso wie Genitivattribute (wie in das Abwägen aller möglichen Probleme) bei VerbenVerb nicht auftreten und verweisen ganz klar auf das Vorliegen einer NP und damit auf eine Konversion. Allerdings sind trotz des Artikelgebrauchs ebenso sehr häufig Eigenschaften zu finden, die als klar verbal einzustufen sind. Dazu gehört zum einen die Anbindungen von Objekten wie in beim Pornos gucken, zum anderen – und salienter – aber auch die Verwendung von links attribuierten Adverbialen wie in beim heimlich Pornos gucken. Eine solche Linksattribuierung von Adverbien oder von zu Attributen umgewandelten Adverbialen ist bei Substantiven nicht möglich, da nicht-kongruierende Attribute dieses Typs hier stets nachgestellt werden müssen, cf.:
das Haus dort auf dem Hügel
*das dort auf dem Hügel Haus
Das Vorliegen von Linksattributen, die klar die Funktion von Adverbialen übernehmen, lässt nur den Schluss zu, dass die Konstruktion in dieser Verwendung verbal wahrgenommen wird. Linksattribuierungen dieser Art zeigen sich auch in den folgenden Belegen:
beim fürs Mittagessen gemüseschneiden
das sich-ständig-Beklagen
beim Für-die-Party-Zurechtmachen
Dabei scheint hier aber offensichtlich eine Wahlmöglichkeit zwischen NP und VP zu bestehen, denn sowohl kongruierende als auch nicht-kongruierende Konstruktionen (mit entsprechendem Wechsel der Wortstellung) lassen sich selbst bei identischer Wortwahl beobachten, cf.:
das ständige sich-Beklagen-über-alles
vs.
das Sich-ständig-beklagen-können
Während die Kombination von Kongruenz und Rechtsattribuierung im ersten Fall auf eine eindeutig nominale Konstruktion verweist, ist das zweite Syntagma nur möglich, wenn man den InfinitivInfinitiv als verbal auffasst.
Ebenso zeigt sich wahlweise Rechts- und Linksattribuierung bei Präpositionalphrasen, die abermals einmal auf eine Interpretation als NP, einmal auf VP schließen lassen:
Beim Gemüseschneiden für das Abendessen
vs.
beim fürs Mittagessen gemüseschneiden
Modalverben mit abhängigem Vollverb oder auch mit zusätzlichem Auxiliar und Partizip des Vollverbs (oder mit anderen Worten: mit einem InfinitivInfinitiv Perfekt) zeigen die folgenden Beispiele:
das Sich-ständig-beklagen-können
Das ständig kontrollieren müssen
das „nichts gesehen haben wollen“
Diese Konstruktionen kann man trotz des Artikels, der ihnen vorangeht, nur noch mit Schwierigkeit als nominal interpretieren.
Wenn man den Horizont der Betrachtung etwas weiter ausdehnt, kommt man schnell zu der Überlegung, dass Verlaufskonstruktionen wie der Progressiv und möglichweise auch der sog. Absentiv (cf. Vogel 2009) hier mit betrachtet werden sollten. Insbesondere beim Progressiv zeigen sich abermals parallel sowohl substantivische als auch verbale Merkmale. So bemerkt etwa van Pottelberge (2009: 369), dass neben den von ihm angeführten, seltenen Verwendungen eines Objektsgenitivs wie in
Denn während eine Gruppe noch am Entladen des mit verschiedenen Utensilien beladenen Kleinlasters ist (Beispiel nach ibd.)
sowohl in der geschriebenen als auch in der gesprochenen Sprache weit häufiger die von ihm als „substantivierte Infinitivphrasen“ (ibd.) bezeichneten Konstruktionen zu beobachten sind, die verschiedene Objekttypen sowie auch Adverbiale aufweisen:
Am Arbeiten war er und am Olympische-Spiele-Schauen (Beispiel nach ibd.)
Und vielleicht ist er genau nach diesem „guten alten Stück“ seit Jahren am Suchen. (Beispiel nach ibd.: 371)
Tatsächlich zeigt sich hier kein struktureller Unterschied zu den im Vorigen angeführten Beispielen: „Die am-Phrase ist nicht fest mit dem VerbVerb sein verbunden, sondern bildet eine eigenständige morphologische Einheit […]“ (ibd.: 367). Offensichtlich verhält sich der Progressiv incl. seiner Parallelkonstruktionen mit beim oder im (cf. ibd.: 364–366) völlig analog zu den anderen hier behandelten Infinitivkonstruktionen und kann hier mit subsumiert werden.
Absentiv-Konstruktionen weisen im Gegensatz zum Progressiv zwar keinen Artikel auf und stehen in einer Position, die man entweder als prädikativ oder sonst als verbale Konstituente auffassen kann. Dennoch sind auch hier Ähnlichkeiten unverkennbar, cf. etwa die folgenden beiden Belege:
Heute vormittag waren wir auch noch kurz Pilze fürs Mittagessen sammeln und es gab soooo viele :o
vs.
beim Pilzesammeln für den privaten Bedarf
Schließlich könnte man im gegebenen Zusammenhang möglicherweise auch die sog. „Sternchen-Formen“ mit berücksichtigen, wie sie Pankow (2003: 104) beschreibt und wie sie durch die folgenden Belege (Beispiele nach ibd.) illustriert werden:
*mitdenfüßennachderfernbedienungfisch*
*schweißvonderstirnwisch*
Hier findet sich zwar weder ein Artikel noch eine Infinitivendung, aber es zeigen sich linksattribuierte Objekte und Adverbiale in einer trotz mangelnder Finitheit eindeutig verbalen Konstruktion.
Aber abgesehen von solchen zusätzlichen Problemfällen: Was hat es mit den im Vorigen beschriebenen Konstruktionstypen auf sich?