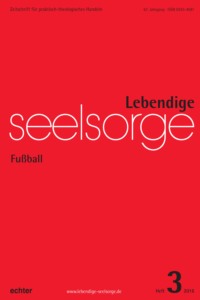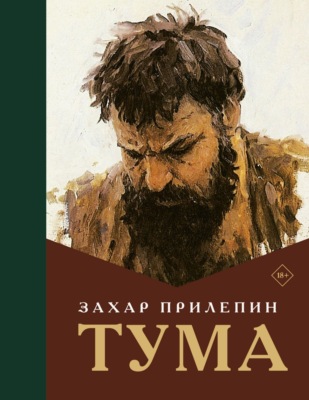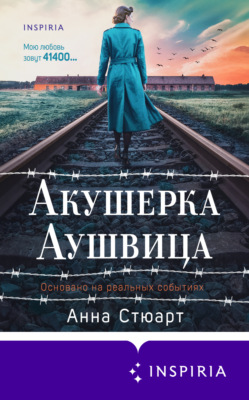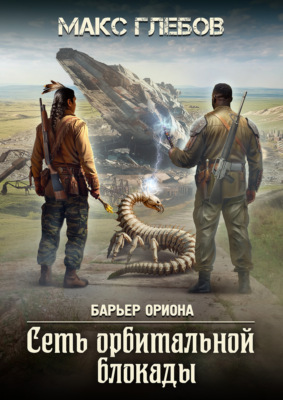Czytaj książkę: «Lebendige Seelsorge 3/2016»
THEMA
Fußball im Paradies?
Von Thomas Ruster
Von einer nutzlosen Leidenschaft, dem Fußball, oder: Vom Religionstier Mensch
Von Magnus Striet
Theologie aus Leidenschaft
Die Replik von Thomas Ruster auf Magnus Striet
Vom Spielen und Foulen
Die Replik von Magnus Striet auf Thomas Ruster
Fußball als Inspiration für eine Pastoral positiver Adjektive
Wie sich Pastoral vom Fußball inspirieren lassen kann
Von Thorsten Kapperer
KURZSKIZZEN: DAS FUSSBALL- ALS GLEICHNISFELD
(1) Tor! Toooooor!
(2) 0:0
(3) Der öffnende Pass
(4) Abtasten des Gegners
(5) Die Eckfahne
(6) Die Zahl elf
(7) Trainingslager
(8) Auswärtsspiele
(9) Das Spiel lesen können
(10) Der 12. Mann
Von Matthias Sellmann
PROJEKT
„Ich bin eine Fußballpfarrerin!“
Von Susanne Haensel
INTERVIEW
„Unsere Dreifaltigkeitskirche ist ein missionarischer Ort für alle Schwarz- Gelben!“
Ein Gespräch mit Karsten Haug
PRAXIS
Monumentale Momente
Fußball im Bedeutungs-Zusammenhang von Geschichte, Kultur und Emotionen Von Manuel Neukirchner
Fußball – mehr als die schönste Nebensache der Welt
Von Joachim Wiemeyer
FORUM
„Glaubens epicenter“ – Wie Kirchenarchitektur wirkt
Von Markus Thiel
POPKULTURBEUTEL
Velocipedia
Von Bernhard Spielberg
NACHLESE
Glosse von Annette Schavan
Buchbesprechungen
Impressum
| IMPRESSUM | www.lebendige-seelsorge.de |
LEBENDIGE SEELSORGE ISSN 0343-4591
Begründet von Alfons Fischer, Josef Schulze, Alfred Weitmann.
Schriftleiter: Professor Dr. Erich Garhammer, Schönleinstraße 3, D-97080 Würzburg.
Mitglieder der Schriftleitung: Prof. Dr. Matthias Sellmann, JProf. Dr. Bernhard Spielberg, Prof. Dr. Hildegard Wustmans
Redaktion: Elisabeth Hasch, Neubaustraße 11, D-97070 Würzburg, E-Mail: elisabethhasch@hrb.de
Verlag: Echter Verlag GmbH, Dominikanerplatz 8, D-97070 Würzburg, Telefon (09 31) 6 60 68-0, Telefax (09 31) 6 60 68-23.
Internet: www.echter.de.
Auslieferung: Brockhaus Kommissionsgeschäft GmbH, Kreidlerstraße 9, 70806 Kornwestheim.
Auslieferung für die Schweiz: AVA Verlagsauslieferung AG, Centralweg 16, CH-8910 Affoltern am Alibs.
Erscheinungsweise: Lebendige Seelsorge erscheint sechsmal im Jahr.
Abonnementskündigungen sind nur zum Ende des jeweiligen Jahrgangs möglich.
eBook-Herstellung und Auslieferung:
Brockhaus Commission, Kornwestheim

Matthias Sellmann Mitglied der Schriftleitung
Liebe Leserin, lieber Leser,
wir von der Lebendigen Seelsorge streben ja immer an, dass unsere Hefte eine „runde Sache“ sind – aber das Heft zum Sommer 2016 will dies in doppelter Weise erreichen. Denn es geht um Fußball. Das Runde soll ins Eckige. Äußerer Anlass ist die Europameisterschaft in Frankreich, wo Trainer Löw und „unsere 11“ nach dem Gewinn des Weltmeister-Titels vor zwei Jahren einen weiteren Glanzpunkt setzen wollen.
Es gibt aber auch jenseits von großen Turnieren gute Gründe für Seelsorger und Seelsorgerinnen, das Fußballfeld als pastorales Lernfeld zu betreten. So jedenfalls sehen das die Autorinnen und Autoren dieses Heftes.
Nehmen Sie lesend die zugeflankten Bälle auf und verwandeln Sie sie in Ihren persönlichen Gewinn: Aus dem neuen Fußballmuseum in Dortmund kommt die Anregung, Fußball als Reflex kulturgeschichtlicher Prozesse zu lesen. Fans und Fanbeauftragte sprechen von Leidenschaft und großen Emotionen, die man fußballerisch wie auch religiös deuten könnte. Zwei Systematiker liefern sich ein robustes argumentatives Tackling. Sozialethische Einwürfe kommen vom Spielfeldrand. Neue Gleichnisse werden erzählt. Und eine Kirche wird als missionarischer Ort schwarz-gelb ausgeflaggt.
Überhaupt – schwarz-gelb. Insidern des gepflegten Passspiels wird sofort auffallen, dass viele der Beiträge in und um Dortmund herum geschrieben wurden. Hieraus abzuleiten, welche fußballerische Vorliebe bei der Heftgestaltung prägend war, bleibt natürlich jedem selbst überlassen…
Ihr

Prof. Dr. Matthias Sellmann
Fußball im Paradies?
Wurde im Paradies Fußball gespielt? Die Quellen geben dazu nichts her, auch wenn der grüne Rasen durchaus zum Garten Eden passen würde. Aber schließlich hätten Adam und Eva vor dem Sündenfall keine zwei Mannschaften auf die Beine stellen können. Wenn aber der Sündenfall nicht geschehen wäre und sich das erste Menschenpaar im Paradies vermehrt hätte, wäre dann ein Turnier mit der paradiesischen Reinheit und Gerechtigkeit vereinbar gewesen? Die Frage ist nicht so abwegig, wie es scheint. Thomas Ruster
Die klassische Theologie behandelte in der Schöpfungslehre auch die Frage nach dem Zustand der Menschen in einer Welt ohne Sünde, so z.B. F. Suarez (1548-1617) im 5. Band seines Buches über das Sechs-Tage-Werk unter der Überschrift: De statu quem habuissent in hoc mundo viatores, si primi parentes non pecassent. Der Sündenfall ist schließlich freie, kontingente Tat. Er musste nicht sein, er kam Gottes Plänen gewissermaßen in die Quere. Wie wäre es denn mit der Welt gegangen, wenn die Sünde nicht passiert wäre, wenn also das eingetreten wäre, was Gott eigentlich wollte? Wie hätte die Welt nach Gottes Willen ausgesehen? Diese Frage weckt theologische Neugier.
Thomas von Aquin behandelt sie ausführlich im ersten Teil seiner theologischen Summe (qu. 94101). Er fragt nach der Erkenntnis der Menschen im Unschuldsstand, z.B. ob sie die Engel schauen konnten – nein, jedenfalls nicht in ihrer Wesenheit, und ob sie getäuscht werden konnten (nein; das schränkt allerdings das Fußballspielen schon sehr ein). Er fragt nach ihren Leidenschaften (sie hatten nur solche, die dem Urteil der Vernunft folgten; das würde man sich für Spieler wünschen). Er fragt, ob sie über die Tiere geherrscht hätten (uneingeschränkt ja) und auch über die Menschen (ja, aber nur im Sinne einer Leitung zum Guten), ob sie der Nahrung bedürftig waren (ja), ob sie sich geschlechtlich vermehrt hätten (ja, aber ohne unbeherrschte Begierde), ob auch Mädchen geboren worden wären (ja, notgedrungen, so der ausgemachte Misogyniker Thomas), ob die Kinder sich körperlich und geistig entwickelt hätten (ja), ob sie mit der Urstandsgerechtigkeit ausgestattet gewesen wären (ja) und ob sie darin schon von Geburt an gefestigt gewesen wären (nein) usw.
Die (neulateinische) Frage „Utrum homines in statu innocentiae folle pedibusque lusissent‘ (ob die Menschen im Stande der Unschuld Fußball gespielt hätten) findet sich zwar nicht, aber sie wäre in dieser Reihe durchaus denkbar gewesen. Wir wollen versuchen, sie im Geist des Aquinaten zu beantworten. Thomas kannte die spätere Bedeutung des Fußballs noch nicht; warum das so ist, wird uns gleich noch beschäftigen.
Thomas Ruster
geb. 1955 in Köln, Prof. Dr. theol.; seit 1995 Professor für Systematische Theologie/Dogmatik an der TU Dortmund; Arbeitsschwerpunkte: Religionsunterricht als Ort der Theologie, Theologie der Mächte und Gewalten, Die drei Ämter Jesu Christi und die Ämter in der Kirche.
DIE BRAUTGABEN DER STARS
Bei der Suche nach fußballaffinen Stellen in der Dogmatik stößt man auf die Lehre von den Brautgaben (dotes). Und wieder sind wir im Paradies, aberjetzt im Paradies am Ende der Zeiten, in das die Leiber der Erlösten von Gott versetzt werden (vgl. Gutberlet, 878-900; Diekamp, 395397). Der himmlische Bräutigam übergibt den Erlösten eine Mitgift (dos), so die Dogmatik in einer durchaus poetischen Sequenz. Für die Seelen besteht diese in der visio (die Gabe, Gott zu sehen), der comprehensio (die Gabe, ihn zu verstehen) und der fruitio (die Gabe, ihn zu genießen). Diese drei Gaben sind analog zu Glaube, Hoffnung und Liebe auf Erden. Für unseren Zusammenhang sind aber besonders die Gaben von Bedeutung, die der verklärte Leib nach der Auferstehung erhält. Diese sind Klarheit (claritas), Feinheit (subtilitas), Behendigkeit (agilitas) und Leidensunfähigkeit (impassibilitas).
Und da muss man doch gleich an die großen Stars des Fußballs denken! Machen wir es an dem größten, dem fünffachen Weltfußballer Lionel Messi fest. Welcher Glanz, welche claritas ist um ihn! „Ist Messi der beste Fußballer aller Zeiten? Ich sage: Ja!“, sagt Ottmar Hitzfeld, der ehemalige Trainer des BVB (vgl. unten angegebene Internetadressen). „Messis berühmter Landsmann Diego Maradona reihte sich ein in die Schar der Verehrer: ‚Lionel Messi wird besser, als ich es je war!‘“. Entsprechend glanzvoll ist die Auszeichnungsfeier zur Überreichung des „FIFA Ballon d’Or“. „Geladen sind die allerbesten Spielerinnen und Spieler der Welt – und alle werden da sein, ihre Planung darauf ausrichten, dass sie persönlich vor Ort präsent sein können.“
Dabei ist Messi persönlich so bescheiden, so sympathisch. „Wenn Messi sich mit seinem breiten Lächeln und dem so grenzenlos verdienten Ball seiner großen Nacht vor die spanischen Reporter stellt und behauptet, dass er vor allem froh sei, dass die Mannschaft gewonnen hätte, dann glaubt man ihm das. Er ist niemand, der sich zwanghaft profiliert, der sich gerne im Mittelpunkt sieht.“ Seine Fans macht er glücklich, sein Glanz strahlt auch auf sie aus. „Litt Messi als Kind noch unter Hormonmangel, so verursachte er bei seinen Fans einen Überschuss an Glückshormonen.“
Theologisch bedeutet die claritas „die Beseitigung alles Unschönen, Entstellenden, Beschämenden, positiv einen glanzvollen Lichtschein, den die verherrlichte Seele in dem Leib bewirken wird.“ Sie ist „ein Lichtglanz, die vom verklärten Körper ausgestrahlt wird“, so wie sie von Messis breitem Lächeln ausstrahlt. Auch in Hinsicht auf die subtilitas hat Messi die paradiesische Auszeichnung offenbar schon erhalten. „Diese Eigenschaft besteht wesentlich in der virtus penetrandi, d.i. in der Fähigkeit, körperliche Dinge zu durchdringen.“ „Die rohe grobe Stofflichkeit des Körpers wird beseitigt und den Eigenschaften des immateriellen Geistes genähert.“ Bei Messi: „So elegant und mühelos lässt er seine scheinbar zu Eis erstarrten Gegenspieler stehen. Als sei nichts einfacher auf dieser Welt. Gegen diese Art Fußball zu zelebrieren kann wohl kein noch so schneller und gewitzter Verteidiger etwas ausrichten.“
Seine virtus penetrandi beweist er vor der gegnerischen Abwehrmauer. Darin zeigt sich zugleich seine agilitas, seine Behendigkeit. „Ihr Grund ist die vollkommene Beherrschung des Leibes durch die Seele, und ihr Inhalt besteht darin, daß der Leib ungehindert und behend dem Geiste in alle Bewegungen und Tätigkeiten zu gehorchen vermag.“ Das ist es doch, was wir bei den großen Spielern bewundern – die traumwandlerische Sicherheit, mit der Pässe ankommen, die unfassbare Leichtigkeit, mit der sie ihre Gegenspieler ausdribbeln. Beim Dribbelkünstler Messi scheint es Zauberei zu sein: „Selbst verzweifelte Versuche den kleinen, so unwahrscheinlich beweglichen Argentinier mit unfairen Mitteln zu bremsen, bleiben oft erfolglos. Zu schnell ist dieser Ballvirtuose, zu sehr liebt er es das runde Leder eng an seinen Zauberfüßen zu führen, als dass er einen freiwilligen Fall in Erwägung ziehen würde.“ „Keine Lobeshymne scheint zu bombastisch für Messis Dribbelkünste, kein Superlativ zu übertrieben für den Ballartisten aus Rosario.“ „Seine perfekte Technik beim Tempo-Dribbling, sein linker Fuß, sein wuchtiger Abschluss, die hohe Spielintelligenz, die Intuition, in noch so schwierigen Situationen das Richtige, das Großartige zu tun, machen Messi einzigartig“ (Hitzfeld).
Und dann die Leidensunfähigkeit. Sie beeindruckt unsereinen, der mit seinem schwerfälligen und dumpfen Leib (so die Schilderung der Leiber der Verdammten) auf dem Sofa sitzt, immer wieder. Da ist ein Spieler schwer gefoult worden und wälzt sich schmerzverzerrt am Boden. Unsereiner würde einen mehrwöchigen Krankenhausaufenthalt in Aussicht nehmen. Aber der Spieler steht wieder auf und spielt weiter, als wenn nichts gewesen wäre. Und Messi: „Wenn man ihn da so stehen sieht: Verschwitzt, dreckig, mit dem Ball unter dem Arm, dann meint man nur einen kleinen Jungen zu sehen, der gerade von seinem geliebten Fußballspiel kommt und nun seiner stolzen Mutter erzählt, wie glücklich er ist.“ Alle Leiden sind vergessen, als habe es sie nie gegeben. Und dies meint auch die impassibilitas im theologischen Sinne: Sie ist „bei dem glückseligen Zustand der Himmelsbewohner selbstverständlich“, sie verlangt „volle Beseligung an Leib und Seele als dauernde Zuständlichkeit“, sie besteht „in einer vollkommenen Herrschaft der Seele über den auferstandenen Leib, die durch nichts aufgehoben oder beeinträchtigt werden kann“, auch nicht durch die Leiden und Qualen eines aufreibenden Matchs.
Ich halte diese Entsprechungen zwischen der Lehre von den Brautgaben und den Eigenschaften eines Weltklasse-Fußballers wie Lionel Messi nicht für zufällig, ich halte sie für höchst aufschlussreich. So fern sich die Texte der scholastischen Eschatologie und die Blogs der Fußballbegeisterten auch stehen, sie kommen doch beide aus derselben Sehnsucht: die nach der vollkommenen Harmonie von Leib und Seele, nach Charme und freudigem, ansteckenden Glanz, nach Leichtigkeit und Beschwingtheit, nach einem stabilen Glückszustand, der, wenn er auch oft mühsam erreicht werden muss, alle Leiden vergessen lässt.
Sicher gibt es auch andere Erfahrungen im Leben, die an den Zustand der verklärten Leiber gemahnen: die Beschwingtheit durch Musik, beim Tanzen, beim ausgelassenen Feiern. Alle Gelegenheiten also, die den Charme, d.h. die Gnade eines Menschen erglänzen lassen – bei uns und bei anderen. Im Fußball aber, jedenfalls bei den großen Meisterschaften, hat diese Sehnsucht schon ihre Erfüllung gefunden. Sie hat einen Ort und eine Zeit gefunden. Man freut sich darauf, so wie sich die Seelen der Erdenpilger auf den Himmel freuen; aber die Frist ist beim Fußball viel kürzer. Fußballmeisterschaften sind Vorschein und Angeld der eschatologischen Vollendung. In ihnen lebt weiter, was im Glauben weitgehend schon verschüttet ist. Und da haben wir auch schon die theologische Bedeutung des Fußballs.
Dass die Theologie in der Lehre von den Brautgaben nicht nur eine realitätsferne Utopie zeichnen wollte, das belegt übrigens nicht zuletzt mein Gewährsmann, der Fuldaer Theologe Constantin Gutberlet (1837-1928). Er verbindet die Ausführungen zu den dotes mit physikalischen Erwägungen zu deren Ermöglichung. Zum Lichtglanz der claritas führt er aus, es könne sich nicht um Licht handeln, das durch chemische Prozesse, Elektrizität oder Reibung hervorgerufen wird, denn dann wäre es mit viel zu viel Wärme verbunden. „Solche Hitze wäre aber dem Leibe der Seelen verderblich.“ Und er verweist auf die Leuchtkraft mancher Insekten bei Nachtzeit, deren Licht ohne eine Unmenge von Wärme erzeugt wird. Das Glühwürmchen als Vorbild der himmlischen Ökologie: „Das wunderbarste aber an diesem hellen und schönen Lichte ist, daß es bloß leuchtet und nicht erwärmt […] wie wunderbar herrlich mag ein Glanz sein, den die übernatürliche Gnade […] verleihen kann, ohne jene natürlichen Mittel anwenden zu brauchen, welche nur auf Kosten von 98% Verlust der thermischen und chemischen Strahlen […] Licht erzeugen können?“ (Gutberlet, 886; erwähnt werden sollte, dass Gutberlet einer der ganz wenigen Theologen ist, der die Auferstehung der Tiere lehrt, vgl. ebd. 945f.)
In ähnlicher Weise äußert er sich auch zur schnellen Bewegungsart der agilitas und zur Durchdringung von Materie in der subtilitas. Solche Erwägungen zehren von dem eingangs dargestellten Grundsatz, dass Gott die Welt als Paradies eingerichtet haben wollte und nur durch die Sünde daran gehindert worden ist. Das Paradies, das wir für die Vollendung erwarten, ist kein anderes als das, was Gott von Anfang an begründet und vorgesehen hat. Anzeichen dafür müssen auch in der postlapsarischen Welt noch zu finden sein. Ist der Fußball vielleicht eines davon?
DER FUSSBALL UND DER SÜNDENFALL
Der postlapsarische Fußball, den wir heute haben, kann nur gebrochen ein Vorschein des Paradieses sein, denn in ihm besteht die Sünde. Kleinere Sünden, Fouls, Regelverletzungen werden gleich durch den Schiedsrichter geahndet und können zu Sperren und Verhandlungen vor dem Sportgericht führen. Auch die Ausschreitungen der Fans kann man der noch ungefestigten Gerechtigkeit zurechnen, die Thomas (s.o.) mit dem paradiesischen Zustand für vereinbar hielt. Aber dem Fußball fehlt offensichtlich die Urstandsgerechtigkeit (iustitia originalis), die Gott den Menschen im Paradies verlieh: die Fähigkeit, Gott, sich selbst und den Mitgeschöpfen gerecht zu werden. Stattdessen beherrscht ein Freund-Feind-Denken das Feld, das dem Spiel von seinen Ursprüngen her eingestiftet ist. Nicht selten führt die Rivalität zu Häme und Hass („Bei uns in Dortmund fliegen die Tauben zum Kacken nach Schalke“).
Die Ur- oder Erbsünde des Fußballs haben wir im Kontext seiner Entstehung zu suchen. Das recht junge Spiel mit seinen heutigen Regeln entstand im 19. Jahrhundert in England und kam erst im 20. Jahrhundert in Mitteleuropa so richtig in Gang. Sein gesellschaftlicher Kontext ist deutlich: Industrialisierung – Nationalisierung – Militarisierung. Auf Letzteres verweisen nicht nur die Nutzung dieser Sportart für die militärische Körperertüchtigung (im deutschen Heer ab 1910, vgl. Eisenberg, 184ff.), sondern auch Begrifflichkeiten wie Angriff, Abwehr, Verteidigung, Deckung, Flanke usw. Ein erstes Länderspiel gab es 1872 zwischen England und Schottland. Weltmeisterschaften inszenieren den Weltkrieg neu, mit gebändigter Gewalt, aber es ist immer noch der Kampf zwischen den Nationen.
Am meisten dürfte aber den Fußball seine Entstehung im Zeitalter der Industrialisierung geprägt haben. Seine Handlungsformen sind analog zur industriellen Arbeit: Es herrscht das Leistungsprinzip, das geprägt ist vom Konkurrenzkampf; die (Fußball-)Arbeit ist streng rationalisiert und muss durch Training bis in die einzelnen Schritte hinein (Standardsituationen) geplant, geordnet und geübt werden; es besteht Rollendifferenzierung bei grundsätzlicher Auswechselbarkeit der einzelnen Positionen; die Ergebnisse werden statistisch bilanziert und damit vergleichbar; mindestens im Profi-Fußball ist der Sport eine bezahlte Arbeit und zugleich eine Ware, für die andere bezahlen (vgl. Fatheuer). Der Fußball ist wie der Kapitalismus, nur noch einmal anders: als Spiel. Das aber ist die Maskerade des Kapitalismus, dass er sich als das freie Spiel der Kräfte inszeniert. Und alle, die mitspielen oder sich daran erfreuen, wirken daran mit. Der Fußball ist nicht nur Vorschein des Paradieses, er ist auch ein Fall für die Erlösung. Er ist von Gewalt und Rassismus, heute aber mehr denn je von der Herrschaft des Geldes bedroht. Von ihr gilt, ausweislich der Einnahmen aus der Champions-League, den TV-Einnahmen und dem Mäzenatentum der Großkapitalisten auf der einen Seite, des finanziellen Abstiegs der Zweit- und Drittligavereine auf der anderen Seite (welche Verarmung der Fußballlandschaft im Ruhrgebiet seit Mitte des letzten Jahrhunderts!) das bittere Wort Jesu: „Wer hat, dem wird gegeben werden, wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat“ (Lk 19,26). Christen als die Experten für die Erlösung sind gefragt. Sie müssten an der Spitze des Triumphzugs stehen, von dem es im Kolosserbrief heißt: „Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt“ (2,15).
Gott will, so lässt sich noch einmal die alte Dogmatik vernehmen, dass die ganze Erde „mehr und mehr zum Paradiese werden sollte“ und berief dazu den Menschen zu seiner Hilfe. Denn „die ursprüngliche Pflanzung des Paradieses war ausschließlich Gottes Werk, die Erhaltung und Ausbreitung des Paradieses aber wollte Gott durch den Menschen bewirken“ (Heinrich, 598). Das Paradies wird auf dem grünen Rasen entschieden. ■
LITERATUR
Diekamp, Franz, Katholische Dogmatik nach den Grundsätzen des heiligen Thomas Bd. 3, Münster 1922.
Eisenberg, Christiane, Fußball in Deutschland 1890–1914. Ein Gesellschaftsspiel für bürgerliche Mittelschichten, in: Geschichte und Gesellschaft 20, 1994.
Fatheuer, Thomas, Eigentore. Soziologie und Fußball, Münster 1985.
Gutberlet, Constantin, Dogmatische Theologie Bd. 10, Münster 1904.
Heinrich, Johann Baptist, Dogmatische Theologie Bd. 6, Mainz 1887.
http://www.bild.de/sport/fussball/lionel-messi/maradona-geraet-insschwaermen-41229380.bild.html (11.1.16).
http://www.spox.com/myspox/blogdetail/Lionel-Messi—Eine-Lobeshymne,77251.html (7.4.2010). [Aufrufe am 31.03.16]
Darmowy fragment się skończył.