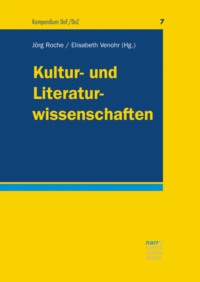Czytaj książkę: «Kultur- und Literaturwissenschaften»
Kultur- und Literaturwissenschaften
Jörg Roche / Elisabeth Venohr
A. Francke Verlag Tübingen
[bad img format]
© 2019 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG
Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
www.francke.de • info@francke.de
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
E-Book-Produktion: pagina GmbH, Tübingen
ePub-ISBN 978-3-8233-0119-6
[bad img format]
Inhalt
VorwortEinleitung: Die Reihe Kompendium DaF / DaZWarum Aus-, Weiter- und Fortbildung heute so wichtig istInterkulturelle Kommunikation im Zeitalter der GlobalisierungInterkultureller FremdsprachenunterrichtEin kleiner historischer Rückblick auf die Entwicklung des FremdsprachenunterrichtsZur kognitiven Ausrichtung
1 Kulturkonzepte und Kulturmodelle1.1 Kultur, Sprache und Kognition1.1.1 Das Konzept Weltsicht von Humboldt und seine Vorläufer1.1.2 Linguistischer Determinismus1.1.3 Kulturbegriffe1.1.4 Zusammenfassung1.1.5 Aufgaben zur Wissenskontrolle1.2 Kulturbegriffe und Kulturtheorien1.2.1 Modelle der Kulturvermittlung1.2.2 Ansätze traditioneller Kulturvermittlung1.2.3 Kultur- und Landeskunde1.2.4 Dimensionen interkulturellen Trainings1.2.5 Kulturelle Deutungsmuster1.2.6 Zusammenfassung1.2.7 Aufgaben zur Wissenskontrolle1.3 Interkulturelle Hermeneutik1.3.1 Grundlagen der interkulturellen Hermeneutik in der Sprachvermittlung1.3.2 Innen- und Außenperspektive1.3.3 Das 5-Phasenmodell der interkulturellen Sprachdidaktik1.3.4 Zusammenfassung1.3.5 Aufgaben zur Wissenskontrolle
2 Transkulturation und Transdifferenz2.1 Kulturtransfer und Identität2.1.1 Kommunikative Steuerung sozialer Identitätsprozesse2.1.2 Kollektivzugehörigkeit als Ausdruck von pluraler Identität2.1.3 Konvergenz und Divergenz im Kulturkontakt2.1.4 Transkulturalität und kulturelle Figuration2.1.5 Die Normalität des Fremden in der skeptischen Hermeneutik2.1.6 Zusammenfassung2.1.7 Aufgaben zur Wissenskontrolle2.2 Transdifferenz2.2.1 Transdifferenz2.2.2 Veränderung und Koordination kognitiver Schemata und Modelle2.2.3 Konstruktion und Relationalität des Fremden2.2.4 Zur Rolle literarischer Texte und anderer (medialer) Textgattungen2.2.5 Zusammenfassung2.2.6 Aufgaben zur Wissenskontrolle2.3 Lingua Franca als Instrument in Wissenskulturen und Wissenschaftssprachen2.3.1 Lingua Franca2.3.2 Wissensstrukturen – Denkstrukturen – Sprachstrukturen2.3.3 Lingua Franca als Ausdruck des Dritten Ortes2.3.4 Sprachenvielfalt – Sprachenpolitik2.3.5 Zusammenfassung2.3.6 Aufgaben zur Wissenskontrolle
3 Critical Incidents und Tabus, Vermittlungswege interkultureller Kompetenz3.1 Critical Incidents I – Kritische Interaktionssituationen3.1.1 Theoretische Grundlagen3.1.2 Viele Missverständnisse sind (nur) sprachlicher Natur3.1.3 Die drei Ebenen eines Critical Incident3.1.4 Zusammenfassung3.1.5 Aufgaben zur Wissenskontrolle3.2 Critical Incidents II – Begriffe und Modelle3.2.1 Stufen interkultureller Kompetenz3.2.2 Grade von Komplexität3.2.3 Begriffe und Modelle3.2.4 Modell zur Strukturierung eines Critical Incident3.2.5 Vermittlungspraxis der kritischen Interaktionssituation3.2.6 Der Wert des Schemas der kritischen Interaktionssituation3.2.7 Zusammenfassung3.2.8 Aufgaben zur Wissenskontrolle3.3 Tabuthemen3.3.1 Tabu – eine Einführung3.3.2 Der Begriff Tabu – Abgrenzung vom Verbot3.3.3 Bezüge zum Tabu im Deutsch als Fremdsprache-Unterricht3.3.4 Zusammenfassung3.3.5 Aufgaben zur Wissenskontrolle
4 Interkulturelle Literatur und Didaktik4.1 Interkulturelle Literatur I: Interkulturelle Literaturwissenschaft und interkulturelle Literaturdidaktik4.1.1 Welche Literatur ist für den Deutsch- und Fremdsprachenunterricht geeignet?4.1.2 Wie kann mit Literatur im Deutsch- und Fremdsprachenunterricht gearbeitet werden?4.1.3 Zusammenfassung4.1.4 Aufgaben zur Wissenskontrolle4.2 Interkulturelle Literatur II: Interkulturelle Philologie und interkulturelle Hermeneutik4.2.1 Interkulturelle Philologie: Textarbeit4.2.2 Interkulturelle Hermeneutik: Verstehensarbeit4.2.3 Text- und Bildmaterial4.2.4 Zusammenfassung4.2.5 Aufgaben zur Wissenskontrolle4.3 Grundlagen einer dialogischen Literaturdidaktik4.3.1 Prinzipien der Literaturdidaktik4.3.2 Grundlagen einer Dialogdidaktik4.3.3 Kognition und Dialog4.3.4 Diskursethik4.3.5 Zur Wissensasymmetrie des Dialogs4.3.6 Was sind die Grundlagen einer Didaktik des Dialogs? Der Transdifferenzansatz4.3.7 Der Ansatz sprach- und dialogdidaktischer Arbeit mit literarischen Autorinnen und Autoren4.3.8 Ein Beispiel aus der Praxis: Unterrichtseinheit Identität4.3.9 Verbindung zwischen den theoretischen Überlegungen zur Dialogdidaktik, der Transdifferenz und dem Unterrichtsvorschlag4.3.10 Zusammenfassung4.3.11 Aufgaben zur Wissenskontrolle
5 Interkulturelle Literatur und Erinnerungskultur5.1 Interkulturelle Literatur in der Lehr- und Lernpraxis5.1.1 Was ist interkulturelle Literatur?5.1.2 Interkulturalität im Rezeptionsprozess und die Interdisziplinarität der interkulturellen Literaturdidaktik5.1.3 Die Rolle von (interkultureller) Literatur im DaF-Unterricht5.1.4 Zusammenfassung5.1.5 Aufgaben zur Wissenskontrolle5.2 Geschichte und Kultur I5.2.1 Konzeption von Gedächtnis und Erinnerung5.2.2 Kulturelles, kommunikatives und kollektives Gedächtnis5.2.3 Begründung von Geschichte als Gegenstand für den DaF-Unterricht5.2.4 Didaktische Überlegungen zur Vermittlung von Geschichte5.2.5 Zusammenfassung5.2.6 Aufgaben zur Wissenskontrolle5.3 Geschichte und Kultur II5.3.1 Erinnerungsorte5.3.2 Europäische Erinnerungsorte im Fremdsprachenunterricht als konstruktivistisches Supplement des Geschichtsunterrichts5.3.3 Arbeit mit Erinnerungsorten in der Kulturvermittlung (Beispiele)5.3.4 Zusammenfassung5.3.5 Aufgaben zur Wissenskontrolle
6 Angewandte Interkulturwissenschaften6.1 Kultureme und Kommunikation6.1.1 Der kommunikative Akt als Ort der Realisierung von Kultur6.1.2 Kommunikative Interaktion und Kultureme6.1.3 Linguistic Awareness of Cultures (nach Müller-Jacquier)6.1.4 Zusammenfassung6.1.5 Aufgaben zur Wissenskontrolle6.2 Interkulturelle Aspekte von Werbung6.2.1 Werbung und ihre Sprache in verschiedenen Textsorten6.2.2 Was ist interkulturelle Werbung?6.2.3 Verschiedene Lebenswelten in Werbetexten6.2.4 Didaktische Funktionen von interkultureller Werbung im DaF-Unterricht6.2.5 Zusammenfassung6.2.6 Aufgaben zur Wissenskontrolle6.3 Film als kulturelles Medium6.3.1 Erinnerungsorte, Erinnerungsfilme6.3.2 Das Massaker von Nanking: Historischer Hintergrund6.3.3 Das Massaker von Nanking: Erinnerungsdiskurse in der Volksrepublik China und in Deutschland6.3.4 Der Film John Rabe6.3.5 Der Film City of Life and Death6.3.6 Vergleich der beiden Filme6.3.7 Hinweise zur Aufgabenerstellung6.3.8 Vorschläge für Prüfungsaufgaben und Fragestellungen in der Schlussdiskussion6.3.9 Schlussbemerkung6.3.10 Zusammenfassung6.3.11 Aufgaben zur Wissenskontrolle
7 Interkulturelles Lernen7.1 Interkulturelle Landeskunde7.1.1 Der interkulturelle Ansatz von Landeskunde7.1.2 Ziele interkultureller Landeskunde7.1.3 Themen interkultureller Landeskunde7.1.4 Methoden interkultureller Landeskunde7.1.5 Interkulturelle Landeskunde in der Anwendung7.1.6 Zusammenfassung7.1.7 Aufgaben zur Wissenskontrolle7.2 (Inter-)Kulturelles Lernen im Tandem7.2.1 Sprache oder Kultur? Oder vielleicht doch Sprache und Kultur?7.2.2 Tandem als …?7.2.3 Zusammenfassung7.2.4 Aufgaben zur Wissenskontrolle7.3 Kulturelles Lernen in Austauschprogrammen7.3.1 Gründe für eine Beschäftigung mit Austauschprogrammen7.3.2 Nationenbilder als Teilbereich interkultureller Lernerfahrung in und durch Studienaustauschaufenthalte7.3.3 Veränderung von Nationenbildern – Empirische Ergebnisse7.3.4 Möglichkeiten zur Förderung der interkulturellen Lernerfahrungen mobiler Lerner sowie deren Integration in Ihren Unterricht7.3.5 Zusammenfassung7.3.6 Aufgaben zur Wissenskontrolle
8 Interkulturelle Bildung und Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik8.1 Unterschiede in Lern(er)- und Wissenschaftskulturen8.1.1 Lerner- und Studienkultur in der Einzelsprache8.1.2 Interkulturelle Lehr-Lern-Situationen8.1.3 Sprachgebundenes Textsortenwissen (am Beispiel der deutschen Seminararbeit)8.1.4 Didaktische Konsequenzen für den universitären DaF-Unterricht8.1.5 Zusammenfassung8.1.6 Aufgaben zur Wissenskontrolle8.2 Interkulturelle Bildung8.2.1 Migrationsforschung8.2.2 Transmigrant und Transnationalismus8.2.3 Das Gegenstandsverständnis, Wissensideal und Aufgabenverständnis der interkulturellen Bildungsforschung8.2.4 Gerechtigkeitstheoretische Perspektiven8.2.5 Globale Ungleichheiten und Migration8.2.6 Interkulturelle Kompetenz als migrationsgesellschaftliche Kompetenz8.2.7 Zusammenfassung8.2.8 Aufgaben zur Wissenskontrolle8.3 Institutionen der Kulturvermittlung: Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik8.3.1 Die auswärtige Kulturpolitik als „dritte Säule“ der deutschen Außenpolitik8.3.2 Die Förderung der deutschen Sprache im In- und Ausland8.3.3 Deutsch als Wissenschaftssprache oder „English only“?8.3.4 Schwerpunkte der Spracharbeit nach Regionen8.3.5 Stärkung der Auslandsgermanistik8.3.6 Zusammenfassung8.3.7 Aufgaben zur Wissenskontrolle
9 Literaturverzeichnis
10 Abbildungsverzeichnis
11 Register
Vorwort
Trotz vieler neuerer Bemühungen um Kompetenz-, Aufgaben- und Handlungsorientierung kommen in der Praxis der Sprachvermittlung weiterhin verbreitet traditionelle Verfahren zur Anwendung, beispielsweise bei der Festlegung der Lehrprogression, den Niveaustufen, der Fehlerkorrektur und der Leistungsmessung. Mit der Weiterentwicklung der kognitiven Linguistik und weiterer kognitiv ausgerichteter Nachbardisziplinen beginnt sich nun aber auch in der Sprachvermittlung in vieler Hinsicht ein Paradigmenwechsel zu vollziehen. Die kognitionslinguistischen Grundlagen dieses Paradigmenwechsels werden in dieser Reihe systematisiert und anhand zahlreicher Materialien und weiterführender Aufgaben für den Transfer in die Praxis aufbereitet.
Die Reihe Kompendium DaF/DaZ verfolgt das Ziel einer Vertiefung, Aktualisierung und Professionalisierung der Fremdsprachenlehrerausbildung. Der Fokus der Reihe liegt daher auf der Vermittlung von Erkenntnissen aus der Spracherwerbs-, Sprachlehr- und Sprachlernforschung sowie auf deren Anwendung auf die Sprach- und Kulturvermittlungspraxis. Die weiteren Bände behandeln die Themen Sprachenlernen und Kognition, Kognitive Linguistik, Berufs- und Fachsprachen, Sprachenlehren, Medien, Kultur, Mehrsprachigkeitsforschung, Unterrichtsmanagement, Propädeutik.
Durch die thematisch klar abgegrenzten Einzelbände bietet die Reihe ein umfangreiches, strukturiertes Angebot an Inhalten der aktuellen DaF-/DaZ-Ausbildung, die über die Reichweite eines Handbuchs weit hinausgehen und daher sowohl in der akademischen Lehre als auch im Rahmen von Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen behandelt werden können.
Die Reihe wird von (fakultativen) flexibel einsetzbaren Online-Modulen für eine moderne Aus- und Weiterbildung begleitet. Diese Online-Module ergänzen den Stoff der Bücher und enthalten Zusatzlektüre und Zusatzaufgaben (www.multilingua-akademie.de). Das Digitale Lexikon Fremdsprachendidaktik (www.lexikon-mla.de) bietet darüber hinaus Erklärungen der wichtigsten Fachbegriffe und damit einen leichten Zugang zu allen aktuellen Themen der Fremdsprachendidaktik und der Sprachlehr- und -lernforschung.
Möglich gemacht wurde die Entwicklung der Inhalte und der Online-Module durch die Förderung des EU Tempus-Projektes Consortium for Modern Language Teacher Education. Neben den hier verzeichneten Autorinnen und Autoren haben eine Reihe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an der editorischen Fertigstellung des Manuskriptes dieses Buches mitgewirkt, vor allem: Katsiaryna EL-Bouz, Ruth Ho’aba, Telse Sundermann, Kathrin Heyng (Gunter Narr Verlag) und Corina Popp (Gunter Narr Verlag). Ihnen allen gebührt großer Dank für die geduldige und professionelle Mitarbeit.
Einleitung: Die Reihe Kompendium DaF / DaZ
Jörg Roche
Der Bedarf an solider Aus-, Fort- und Weiterbildung im Bereich der Sprachvermittlung nimmt ständig zu. Immer stärker treten dabei spezialisierte Anforderungen zum Beispiel in Bezug auf Fach- und Berufssprachen, Kompetenzen oder Zielgruppen in den Vordergrund. Theoretisch fundiert sollten die entsprechenden Angebote sein, aber gleichzeitig praxistauglich und praxiserprobt. Genau diese Ziele verfolgen die Buchreihe Kompendium DaF / DaZ und die begleitenden Online-Module. In mehreren Modulen und Bänden soll hiermit eine umfassende Einführung in die Wissenschaft und in die Kunst des Sprachenlernens und Sprachenlehrens gegeben werden, weit weg von fernen Theorie- oder Praxiskonstruktionen und Lehr-Dogmen. Im Mittelpunkt des hier verfolgten Ansatzes steht das, was in den Köpfen der Lerner geschieht oder geschehen sollte. Sachlich, nüchtern, effizient und nachhaltig. Buchreihe und Online-Module sind eine Einladung zur Professionalität eines Bereichs, der die natürlichste Sache der Welt behandelt: den Sprachenerwerb. In diesen Materialien und Kursen werden daher Forschungsergebnisse aus verschiedenen Forschungsrichtungen zusammengetragen und der Nutzen ihrer Synthese für die Optimierung des Sprachenerwerbs und Sprachunterrichts aufgezeigt.
Warum Aus-, Weiter- und Fortbildung heute so wichtig ist
Wer sich etwas eingehender darum bemüht zu verstehen, welche Rolle die Sprache im weiten Feld des Kontaktes von Kulturen spielt – oder spielen könnte –, muss von den Gegensätzen, Widersprüchen und Pauschalisierungen, die die Diskussion in Gesellschaft, Politik und Fach bestimmen, vollkommen irritiert sein. Vielleicht lässt sich aus dieser Irritation auch erklären, warum dieser Bereich von so vielen resistenten Mythen, Dogmen und Praktiken dominiert wird, dass das eigentlich notwendige Bemühen um theoretisch fundierte Innovationen kaum zur Geltung kommt. Mangelndes Sprach- und Sprachenbewusstsein besonders in Öffentlichkeit und Politik führen ihrerseits zu einem ganzen Spektrum gegensätzlicher Positionen, die sich schließlich auch bis in die lehrpraktische Ebene massiv auswirken. Dieses Spektrum ist gekennzeichnet durch eine Verkennung der Bedeutung von Sprache im Umgang der Kulturen auf der einen und durch reduktionistische Rezepte für ihre Vermittlung auf der anderen Seite: Die Vorstellung etwa, die Wissenschaften, die Wirtschaft oder der Alltag kämen mit einer Universalsprache wie dem Englischen aus, verkennt die – übrigens auch empirisch über jeden Zweifel erhabenen – Realitäten genauso wie die Annahme, durch strukturbasierten Sprachunterricht ließen sich kulturpragmatische Kompetenzen (wie sie etwa für die Integration in eine fremde Gesellschaft nötig waren) einfach vermitteln. Als ineffizient haben sich inzwischen auch solche Verfahren erwiesen, die Mehrsprachigkeit als Sonderfall – und nicht als Regelfall – betrachten und daher Methoden empfehlen, die den Spracherwerb vom restlichen Wissen und Leben zu trennen versuchen, also abstrakt und formbasiert zu vermitteln. Der schulische Fremdsprachenunterricht und der Förderunterricht überall auf der Welt tendieren (trotz rühmlicher unterrichtspraktischer, didaktischer, struktureller, konzeptueller und bildungspolitischer Ausnahmen und Initiativen) nach wie vor stark zu einer solchen Absonderung: weder werden bisher die natürliche Mehrsprachigkeit des Menschen, die Sprachenökologie, Sprachenorganik und Sprachendynamik noch die Handlungs- und Aufgabenorientierung des Lernens systematisch im Fremdsprachenunterricht genutzt. Stattdessen wird Fremdsprachenunterricht in vielen Gesellschaften auf eine (internationale) Fremdsprache reduziert, zeitlich stark limitiert und nach unterschiedlich kompetenten Standards kanalisiert.
Interkulturelle Kommunikation im Zeitalter der Globalisierung
In unserer zunehmend globalisierten Welt gehört die Kommunikation zwischen verschiedenen Kulturen zu einem der wichtigsten sozialen, politischen und wirtschaftlichen Aufgabenbereiche. Die Globalisierung findet dabei auf verschiedenen Ebenen statt: lokal innerhalb multikultureller oder multikulturell werdender Gesellschaften, regional in multinationalen Institutionen und international in transkontinentalen Verbunden, Weltorganisationen (unter anderem für Wirtschaft, Gesundheit, Bildung, Sport, Banken) und im Cyberspace. Dabei sind all diese Globalisierungsbestrebungen gleichzeitig Teil einer wachsenden Paradoxie. Der Notwendigkeit, die großen sozialen und wirtschaftlichen Probleme wegen der globalen Vernetzung der Ursachen auch global zu lösen, stehen andererseits geradezu reaktionäre Bestrebungen entgegen, der Gefahr des Verlustes der »kulturellen Identität« vorzubauen. Einerseits verlangt oder erzwingt also eine Reduktion wirklicher und relativer Entfernungen und ein Überschreiten von Grenzen ein Zusammenleben und Kommunizieren von Menschen verschiedener Herkunft in bisher nicht gekannter Intensität, andererseits stehen dem Ideal einer multikulturellen Gesellschaft die gleichen Widerstände entgegen, die mit der Schaffung solcher Gesellschaften als überkommen geglaubt galten (Huntington 1997). Erzwungene, oft mit großer militärischer Anstrengung zusammengehaltene multikulturelle Gesellschaften haben ohne Druck keinen Bestand und neigen als Folge des Drucks vielmehr dazu, verschärfte kulturelle Spannungen zu generieren. Auch demokratisch geschaffene multikulturelle Gesellschaften benötigen meist viel Zeit und Energie, um sich aus der Phase der multi-kulturellen Duldung zu inter-kultureller Toleranz und interkulturellem Miteinander zu entwickeln. Die rechtspopulistischen Bewegungen in Europa und die ethnischen Auseinandersetzungen in Afrika und Asien zeigen, dass es zuweilen gewaltig unter der Oberfläche gesellschaftlicher Toleranz- und Internationalisierungspostulate rumort. Ethnozentrismus, Ausländer- und Fremdenfeindlichkeit, Rechtspopulismus, Rassismus, Diskriminierung, Terrorismus, Bürgerkrieg, Massen- und Völkermord sind durch politisch und wirtschaftlich bewirkten Multikulturalismus nicht verschwunden. Das verbreitete Scheitern von Multikulturalismus-Modellen zeigt, dass ein verordnetes oder aufgezwungenes Nebeneinander von Kulturen ohne Mediationsbemühungen eher Spannungen verstärkt, als nachhaltig Toleranz zu bewirken. Es mangelt an effizienten Verfahren der Vermittlung (Mediation) zwischen Kulturen. Den Sprachen kommt in dem Prozess der Mediation deswegen eine besondere Rolle zu, weil er mit der Kommunikation über kulturelle Grenzen hinweg anfängt und auch nur durch diese am Laufen gehalten wird. Die Sprache kann nicht alle Probleme lösen, aber sie hat eine Schlüsselposition beim Zustandekommen interkulturellen Austauschs, die weit über die Beherrschung von Strukturen sprachlicher Systeme hinausgeht. Diese Funktion hat mehr mit Kulturvermittlung als mit strukturellen Eigenschaften sprachlicher Systeme zu tun und sie kann kaum durch eine einzige Lingua Franca erfüllt werden. Das Lernen und Lehren von Sprachen ist in Wirklichkeit eines der wichtigsten politischen Instrumente im Zeitalter der Globalisierung und Internationalisierung. Sprachunterricht und Sprachenlernen werden aber von Lehrkräften und Lernern gleichermaßen oft noch als die Domäne des Grammatikerwerbs und nicht als Zugangsvermittler zu anderen Kulturen behandelt. Wenn kulturelle Aspekte im Fremdsprachenerwerb aber auf die Faktenvermittlung reduziert werden und ansonsten vor allem strukturelle Aspekte der Sprachen in den Vordergrund treten, bleiben wichtige Lern- und Kommunikationspotenziale ungenutzt. Dabei bleibt nicht nur der Bereich des landeskundlichen Wissens unterentwickelt, sondern es wird in erster Linie der Erwerb semantischer, pragmatischer und semiotischer Kompetenzen erheblich eingeschränkt, die für die interkulturelle Kommunikation essentiell sind. Wenn in der heutigen Zeit vordringlich interkulturelle Kompetenzen verlangt werden, dann müssen in Sprachunterricht und Spracherwerb im weiteren Sinne also bevorzugt kulturelle Aspekte der Sprachen und Kommunikation berücksichtigt werden. Dazu bedarf es aber einer größeren Bewusstheit für die kulturelle Bedingtheit von Sprachen und die sprachliche Bedingtheit von Kulturen. Diese müssen sich schließlich in kultursensitiven Lern- und Lehrverfahren manifestieren, die Mehrsprachigkeit nicht nur künstlich rekonstruieren und archivieren wollen, sondern die in Fülle vorhandenen natürlichen Ressourcen der Mehrsprachigkeit und Mehrkulturalität organisch, dynamisch und effizient zu nutzen wissen. Das Augenmerk der künftigen Lern- und Lehrforschung ist daher verstärkt auf Aspekte der Ökologie und Ökonomie des Sprachenerwerbs und Sprachenmanagements zu richten. Das bedeutet aber, dass die Spracherwerbs- und die Mehrsprachigkeitsforschung sich nicht nur eklektisch wie bisher, sondern systematisch an kognitiven und kultursensitiven Aspekten des Sprachenerwerbs und Sprachenmanagements ausrichten müssen. Diesen Aufgabenbereich zu skizzieren, indem wichtige, dafür geleistete Vorarbeiten vorgestellt werden, ist Ziel dieser Reihe.