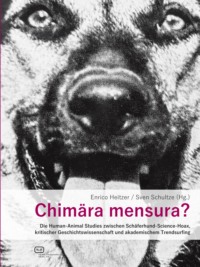Czytaj książkę: «Chimära mensura?»
Enrico Heitzer / Sven Schultze (Hg.)
Chimära mensura?
Die Human-Animal Studies zwischen Schäferhund-Science-Hoax, kritischer Geschichtswissenschaft und akademischem Trendsurfing
Impressum
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN: 978-3-86408-239-9
Coverabbildung: Vergangenheitsverlag
© Copyright: Vergangenheitsverlag, Berlin / 2018
www.vergangenheitsverlag.de
Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen und digitalen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.
Vorwort
Peter Boghossian
Einleitung
Enrico Heitzer & Sven Schultze
Debatten-Reader
Der deutsch-deutsche Schäferhund.
Ein Beitrag zur Gewaltgeschichte des Jahrhunderts der Extreme
Christiane Schulte
Interviews aus der Zeitschrift sub\urban. zeitschrift für kritische stadtforschung
„Kritische Wissenschaft braucht einen Begriff von Gesellschaft“
Christiane Schulte & Freund_innen
Die Human-Animal Studies zwischen wissenschaftlicher Distanz und politischem Engagement.
Ein Gespräch über Wissenschaft, Politik und Gesellschaft mit Chimaira – Arbeitskreis für Human-Animal Studies e. V.
Markus Kurth, Aiyana Rosen & Helen Keller
„Schulte et al. haben nicht nur den Finger in die Wunde gelegt, sie sind auch Ausdruck derselben.“
Ilko-Sascha Kowalczuk
Kultur statt Wissenschaft?
Chimära mensura?
Reflexionen über das wissenschaftliche und erkenntnistheoretische Potential der Human-Animal Studies
Sven Schultze
Im Reich der wilden Tierrechtler.
Anmerkungen zur Kritik an Tierrechten und Human-Animal Studies
Heiko Werning
Christiane Schulte gegen die Human-Animal Studies:
Warum eine politische Kritik keine wissenschaftliche Auseinandersetzung ersetzt
Markus Kurth
Von turn zu turn zu turn?
Schäferhunde, die bellen, beißen nicht.
Der Schäferhund-Hoax als Symptom akademischen Trendsurfings
Florian Peters
Normalisierung des Absurden?
Das „Simon-und-Garfinkel-Prinzip“ und die kommunikative Validierung von Nonsens
Thomas Hoebel
„Es ist der gleiche Hund, nur mit einem anderen Halsband“.
Über politische Erkenntnisinteressen und wissenschaftliche Erkenntnispotenziale alter und neuer Forschungsparadigmata
Enrico Heitzer
Hoaxes als Kommunikationsmedium
Publish and Perish.
Publikationszwänge, selbstunternehmerische Wissenschaftssubjekte und Geschlecht
Antonia Schmid & Peter Ullrich
Ernst beiseite!
Humoristische Interventionen in den Wissenschaftsbetrieb
Oliver Lauenstein
Ohne Witterung.
Oder warum Studierende den ‚Geruch‘ eines Textes nicht (mehr) bemerken. Von der Aneignung des Schäferhund-Textes in einem BA-Seminar
Heiner Stahl
Autorenporträts
Dank an die Crowd
Vorwort
The further a discipline is from reality, the easier it is to hoax. And the easier it is to hoax, the angrier scholars in that field become once it is hoaxed. The reasons for anger are many. A bogus paper that passes the peer-reviewed process shows, 1) there are either serious problems with the peer-reviewed mechanism in that journal or the entire discipline is operating in make-believe-land, 2) scholars have wasted a considerable amount of time, money, and effort in a bogus field, and most interestingly, 3) they are morally motivated to believe that their scholarly efforts are of indispensable importance. Successful hoaxes should force every honest scholar to take a long, hard look at their discipline of study and bluntly ask themselves if they should still pursue lines of inquiry that have been exposed as fraudulent.
The best analogue for this are the countless videos on YouTube of martial arts “masters” (almost always in ancient, Eastern disciplines) who effortlessly destroy wave after wave of assailants. Many of these masters do so without ever having touched their opponents. Attackers just fly through the air, as if by magic. To an onlooker, of course, this is absolutely remarkable. How can one person definitively incapacitate scores of attackers, many of whom are wielding bats and knives?
The answer is that he cannot. The assailants have bought into the delusion that their master has secret powers. Consequently, whether they realize it or not, they are complicit in the charade. It’s all bogus. All of it. The drills. The training. The attacks. They are all untethered to reality. And the more time participants spend practicing their make-believe martial art, the more invested they become—invested in convincing themselves of its efficacy and of their own powers.
All it takes to show that the Emperor has no clothes is to find one individual who actually knows how to fight and who’s not bought into this collective delusion. (Usually that person is an amateur MMA, or Mixed Martial Arts, practitioner.) Then it’s straightforward: with basic rules and a referee, the master fights the Mixed Martial Artist. Time after time after time, the master loses ignominiously, usually in just a few seconds. His disciples are shocked. The most delusional among them manufacture elaborate excuses, from cheating opponents in collusion with the referee, to mystical forces (or big toes) being out of alignment, to chi energy being unbalanced. The rest of us, however, see it for what it is: a group of practitioners who, along with their leader, convinced themselves something worked when it didn’t.
This is almost exactly what happens when hoax papers are accepted in peer-reviewed journals. The master is the field. The willing participants in the charade are the scholars in that field. The hoax paper is the MMA fighter. Submission of the hoax paper is the challenge. Publication of the paper is the result.
In the case of hoax papers, what’s interesting is the reaction of the scholars in the particular field of study. Just as the master’s students, who have invested time, money, and energy into an activity that does not do what they thought it would do, become indignant, incredulous, and outraged, so too do the scholars in the field that was hoaxed. But there is one crucial difference. The master’s students don’t think they’re better people for practicing that particular art. That is, they don’t think the martial art makes them more moral, they just think it make them better fighters. (There are exceptions to this, of course. Some practitioners believe they’re more “moral,” but they interpret “morality” as meaning “possessing higher spiritual purity”.) And this is the crucial distinction. Gender scholars, for example, think they’re better people as a result of doing work they consider to be morally necessary. Consequently, they interpret hoaxes morally, in a way that mathematicians and physicists would not if their journals were hoaxed. That is to say, gender scholars can be fooled by nonsense if it is sufficiently aligned with their moral predilections.
This is why it’s particularly interesting that many martial arts masters solicit challenges and even offer hefty rewards if they can be defeated. They solicit challenges because they believe they can win. And they believe they can win because they believe their art does what they think it can do—defeat resisting opponents. Many postmodern scholars, for example, possess no such honesty because their moral minds have overridden their rational minds. That is, they perceive their discipline and their work within it as morally crucial. This causes them to interpret challenges as immoral and challengers as unethical, or worse. It also causes them, like the master’s most devote disciples, to rationalize hoaxes as failures or flukes.
Just as we can independently figure out if a master’s and his art are legitimate, so too can we figure out if a journal and the field to which it belongs are in lawful alignment with reality. Hoaxes act as correctives, both for the journal and for the discipline. Consequently, as the student of the master should want to know if she’s spending her time wisely, so too should journals and fields encourage hoaxes. In this way can we find out if the things we value are true. More importantly, however, hoax papers can help us figure out if we should value the things we value.
Peter Boghossian
Portland, Oregon
Einleitung
Enrico Heitzer & Sven Schultze
Während einerseits seit Jahren eine immer stärkere Entfremdung der Menschen in westlichen Industrieländern von der Natur vielfach belegt1 und sogar schon mit dem Terminus Nature Deficit Disorder beschrieben ist, liegt andererseits gleichzeitig eine zunehmende Beschäftigung mit Tieren (und Pflanzen) im Zeitgeist; nicht die raue amoralische, sondern eher eine „fühlende Natur“ ist ein öffentlich sehr präsentes Thema unserer Zeit2, das auch in der Popkultur fest verankert ist: Die Rapperin Sookee beispielsweise verbreitet sich musikalisch über „queere Tiere“3 und die Popsängerin Björk veröffentlicht anlässlich einer Retrospektive ihrer Kunst im Museum of Modern Art in New York ihre Korrespondenz mit Timothy Morton4, dem „Philosophenproheten des Anthropozäns“, der auch immer wieder bei Eröffnungen von Ausstellungen des Künstlers Olafur Eliasson spricht.5 Morton verficht u.a. die These, dass „in einem ‚ökologischen‘ Stadium der menschlichen Gesellschaft der so in Ehren gehaltene Begriff ‚Natur‘ wird verkümmern müssen“.6 Mortons Terminologie einer „Ökologie ohne Natur“ ist “slowly infecting all the humanities”.7 Er spricht von Menschheit und „Postmenschheit“ und weist darauf hin, dass der Animismus „eine Menge gemeinsam“ habe „mit einer Ökologie der Zukunft“.8 Niemals zuvor haben Designer so viele Tiermuster auf Kleider gedruckt wie heute.9
Einerseits feiern neueste Publikationen reromantisierend die „geheime“ Natur als funktionierendes soziales Gefüge10, nicht nur Peter Wohlleben gehört mit seinen Büchern über das „geheime“ Seelenleben der Bäume11, des Waldes oder gar „der“ Tiere12 zu den erfolgreichsten deutschen Sachbuchautoren der letzten Jahre. Theater widmen sich Maulwürfen („Und gibt es vielleicht sogar Gemeinsamkeiten zwischen Maulwürfen und Menschen?“13), zeigen „Animal Dances“ („eine tänzerische Untersuchung des Mensch-Tier-Verhältnisses“), spielen „Schlüsselwerke der Tierchoreografie“14 wie „Zoo Mantras“ oder führen „Tiermusik“ auf. In großen Museen gibt es Ausstellungen zu Tieren und „ihren“ Menschen15, in denen inzwischen der „Perspektivwechsel“ vollzogen und beispielsweise mittels Virtual-Reality-Technik darüber spekuliert wird, „wie Heimtiere ihre Umwelt wahrnehmen und wie es ihnen mit uns Menschen geht“.16 Auch „Being a Beast“, der exzentrische Versuch von Charles Foster, in die Rolle eines Dachses, einer Otter oder eines Mauerseglers zu schlüpfen, stürmt die Bestsellerlisten.17 Man kann einen „Gottesdienst für Mensch und Tier“ besuchen18 oder seit ein paar Jahren beim Institut für Theologische Zoologie in Münster studieren.19 Desweiteren reicht ein Gang in eine Buchhandlung, um weitere der unzähligen Veröffentlichungen, oder der Blick in Verlagsankündigungen, um Anzeigen wie eine auf mehrere Bände angelegte „Ökologiegeschichte“ zu finden, in der es heißt:
„Als aktiv Handelnde ihrer eigenen Geschichte sind Klima, Berge, Gewässer, Pflanzen, Tiere mehr als die Randerscheinungen, als welche sie üblicherweise wahrgenommen werden: Sie haben aufgehört, bloß Staffage zu sein in der Geschichte der Menschheit. Sie reagieren in dieser Geschichte auf menschliches Tun und lassen uns keine Fehler durchgehen.“ 20
Wird hier „uns“, also allen Menschen, armen, reichen, großen, kleinen, behinderten, von rassistischen Diskriminierungen oder von Homophobie betroffenen Personen, „durch die Blume“ mit Revanche gedroht? Oder hat man es eher mit einem apokalyptisch grundierten Raunen zu tun? Knüpfen Veröffentlichungen in diesem Geiste an die Narrative des „tiefenökologischen“ bzw. „biozentrischen“ Denkens an, deren radikalere Vertreter Menschen schon mal als „Krebsgeschwür“ am Planeten Erde bezeichnet haben oder auch Tötungen als Mittel gegen eine angebliche Überbevölkerung nicht ausschlossen?21 Man wird sehen.
Jedenfalls wird inzwischen im blühenden akademischen Feld der Human-Animal Studies (HAS) einträchtig sowohl das „sozialistische“22 als auch das „nationalsozialistische Tier“23, der „Zoo der Anderen“24, d.h. das tierische „Wettrüsten“ des ost- und westberliner Zoos im Kalten Krieg, aber auch der „Hunde“- bzw. „Tiersoldat“25 zum Gegenstand von meist tiefsinnigen historischen Untersuchungen gemacht. Mit Blick auf Pferde und die Onkomaus, eine gentechnisch modifizierte Hausmaus, wird die „für westliche moderne Gesellschaften konstituierende Differenz und damit einhergehende Asymmetrie zwischen Menschen, Tieren und Maschinen […] infrage gestellt“.26 Eine Vertretreterin der HAS formuliert die verbreitete Infragestellung folgendermaßen:
„In sum, posthumanist ontology can be seen as various relationships that connect us in complex networks […] advocate for alternative ontology that rejects western dualisms such as fact and value, human and nonhuman, along with nature and culture, and rather looks to emphasize relations between entities.” 27
Mit Verweis auf ein Theaterstück von Raymond Roussel, in dem ein Regenwurm eine zentrale Rolle spielt, „der Musik auf einer Zither spielt, indem er seine Exkremente über die Saiten fallen lässt“28, erarbeitet ein Autor eine ganze „Kulturgeschichte des Wurms [aus], seiner Rolle in der romantischen Kunstphilosophie und seiner Handlungsmacht in ästhetischen Prozessen“.29 Dabei ist nicht nur auch wieder von angeblichen „Mensch-Tier-Kollaborationen bei der Herstellung von Kunstwerken“ die Rede, sondern gar von einer „Ikonografie von Scheiße“ und davon, wie „Scheiße und Kultur in ein Abhängigkeitsverhältnis gestellt“ seien.30 Abschließend sei erwähnt, dass es auch das Plädoyer für die Entwicklung einer Philosophie des Polypen gibt.31
Die geschilderte Gemengelage und die nicht einmal in Umrissen skizzierten Trends trugen offenbar zur Entstehung einer Konstellation bei, in der ernsthaft Fragen aufgeworfen und debattiert wurden, ob der Deutsche Schäferhund eine Mitschuld an der Nazi- und SED-Diktatur gehabt haben könnte oder Schäferhunde als „Napfsoldaten“ Täter oder doch die eigentlichen Opfer der deutschen Teilung gewesen seien. Überlegungen dieser Art, vorgetragen auf einer Konferenz und veröffentlicht in einer Fachzeitschrift, sind 2016 als „Schäferhund-Hoax“ bekannt geworden und haben vor allem der Geschichtswissenschaft eine unangenehme Diskussion beschert, die u.a. auf einem Workshop im Oktober 2016 an der Technischen Universität Berlin geführt wurde.
Aber der Reihe nach: Begonnen hatte alles im Herbst 2014, als eine Doktorandin am Center for Metropolitan Studies der TU Berlin im Rahmen ihrer Dissertation zu einem Workshop mit dem Titel „‚Tiere unserer Heimat‘. Auswirkung der SED-Ideologie auf gesellschaftliche Mensch-Tier-Verhältnisse in der DDR“ einlud.32 Im Call for Papers33, auf den die o.g. Doktorandin „Schulte“ reagierte, scheinen nicht nur halbgare Bezüge zu teilweise diametral gegensätzlichen Deutungsangeboten zur DDR-Geschichte durch. Ihn prägt auch ein etwas überreichlich anmutendes Selbstlob, wenn ein ziemlich weit gefasster, tendenziell allumfassender Erklärungsanspruch anklingt, wonach „die Untersuchung von Mensch-Tier-Beziehungen [...] zu einem Schlüssel für eine neuartige Gesellschaftsanalyse werden“ könne.34
Soweit bekannt, fühlten sich mindestens zwei Personen angespornt, mit satirisch gemeinten Papers ins Rennen zu gehen. Der Berliner Zeithistoriker Florian Peters schlug einen Vortrag mit dem großspurigen Titel „Freie Liebe im Schatten der Mauer: Das staatssozialistische Mensch-Tier-Verhältnis aus der Grenzperspektive der Wildkaninchen“ vor. Peters, der auch als Autor in diesem Band vertreten ist, zog dafür ausschließlich tatsächlich verfügbares kulturhistorisches Quellenmaterial heran, vermischte aber bewusst Formulierungen zu „Eigen-Sinn“ und Agency mit solchen aus dem interpretativen Totalitarismus-Kosmos des Forschungsverbunds SED-Staat bzw. des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung (HAIT). Dass Peters diese eigentlich gegensätzlichen Interpretationsmuster in seinem Vortrag unbekümmert miteinander verband und überdies betont leger gekleidet zu dem Workshop erschien, erregte jedoch keinerlei Anstoß.
Auch „Christiane Schulte“ und ihr Team wurde wohl aus dem Geiste dieses Call for Papers geboren. Sie bauten ihren Beitrag nach einem ähnlichen Muster wie Peters, erfanden aber Quellen und Zitate. Beispielsweise postulierte „Schulte“ eine „zentrale Bedeutung der Human-Animal Studies für die neuere Totalitarismusforschung“, weil sie „den Nachweis einer tierischen Eigenlogik, vielleicht sogar eines ‚Eigensinns‘ im Sinne von Alf Lüdke, die Grenzen des Totalen aufzeigen“ könne. Der Text ist eine einzige Aneinanderreihung von Oxymora wie: „Gerade im Sinnbild des DDR-Totalitarismus, den Grenzanlagen an der Mauer“, zeige sich die Unmöglichkeit der totalen Kontrolle über Mensch und Tier.35 Der Workshop umfasste insgesamt acht Vorträge, die auf der Basis von vorab zirkulierten Papers diskutiert wurden. So wie an anderer Stelle völlig ernstgemeint die Handlungsmacht eines Regenwurms erforscht wird, so fragten die beiden nach der Agency von Häschen und Hunden. Ironischerweise fanden sich die Satiriker sogar gemeinsam auf einem Panel wieder, wo sie ihre Beiträge unter der Überschrift „Grenztiere“ unter das akademische Publikum brachten.
Anett Laue, von der gleichfalls der Call for Papers stammte, schrieb im Tagungsbericht, in dem sie neben ihrem eigenen Beitrag36 gerade auch die beiden Wissenschaftsparodien herausstellte, Peters habe versucht, „die besondere Bedeutung der Kaninchen für die DDR-Gesellschaft herauszuarbeiten“. Die Grenzkaninchen seien zur „Projektionsfläche zahlreicher künstlerischer Auseinandersetzungen“ geworden, was ihre „Relevanz [...] für die DDR-Gesellschaft“ belege. „Schulte“ wiederum habe „weitreichende Kontinuitäten“ totalitärer Staatsgewalt „aufgedeckt“ und eindrucksvoll die These belegen können, „dass trotz des eingeschränkten Handlungsspielraums der ‚Kettenhunde‘, jene durchaus „eigensinniges Verhalten“ an den Tag“ gelegt hätten, das dem Grenzregime zuwidergelaufen sei. Auf dem Podium sei „eine Debatte über die DDR-Gedenkkultur“ geführt worden. Im Tagungsbericht heißt es dazu: „So gibt es in Berlin etwa einen Erinnerungsort für die Grenzkaninchen. Die zahlreichen Grenzhunde haben hingegen (noch) keinen Eingang in eine umfassende Erinnerungskultur der innerdeutschen Grenze gefunden.“ Daran habe sich „eine eingehende Diskussion über Schäferhunde als ‚Mittäter‘“ angeschlossen, über deren Erträge sich der Tagungsbericht aber ausschweigt.
In der Abschlussdiskussion wurden die Schulteschen „Napfsoldaten“ noch einmal zum Thema: Das „Beispiel des Deutschen Schäferhundes“ habe exemplarisch belegt, dass die DDR-Historiographie „durch einen diachronen Forschungsansatz profitieren“ könne. Die „Perspektiverweiterung“ durch die HAS biete
„eine Möglichkeit [...], die DDR-Forschung aus der wissenschaftlichen Sackgasse zu führen. Die Betrachtung von gesellschaftlichen Mensch-Tier-Beziehungen könnte Forschungslücken füllen, neue Erkenntnisgewinne erzielen und vermeintliche Fakten und Interpretationen der historischen Wirklichkeit der DDR neu bewerten“. 37
Enrico Heitzer, Mitherausgeber dieses Bandes, kamen die vorgeblichen Befunde „Schultes“ hingegen merkwürdig vor, seit er von ihnen erfahren hatte. Darüber hinaus irritierte ihn, dass die vermeintliche Doktorandin an keiner deutschen Universität bekannt war. Über die Workshop-Veranstalter*innen nahm er schließlich Kontakt mit der web.de-Adresse der ominösen Nachwuchswissenschaftlerin auf, wurde aber auf die vorgesehene Publikation in der Zeitschrift „Totalitarismus und Demokratie“ vertröstet. Seine Reaktion auf den Text, den er für den ernst gemeinten Beitrag einer unerfahrenen Forscherin hielt, die sich in den Totalitarismus- und Unrechtsstaatsdebatten zur DDR verirrt hatte, teilte er verschiedenen Kollegen in einer Mail mit: Darin beschreibt er, dass er sich „beim ersten Lesen an einigen besonders absurden Stellen vor Lachen gebogen“ und den Text stellenweise als „Persiflage auf einen geschichtswissenschaftlichen Aufsatz“ empfunden hatte. Besonders die für die Argumentation zentrale Kontinuitätsbehauptung zwischen dem Einsatz von identischen bzw. direkt voneinander abstammenden Wachhunden in NS-Konzentrationslagern, in sowjetischen Speziallagern und bei den DDR-Grenztruppen konnte er nicht nachvollziehen, hätte sie doch selbst mit den von „Schulte“ gefälschten Quellenangaben in der entsprechenden Fußnote auf einer empirisch ziemlich dünnen Grund gestanden. Ohne die angeführten Quellen grundsätzlich in Frage zu stellen, kam Heitzer zu dem Schluss: „Schaut man sich dann aber mit einem zweiten Blick die zentralen Passagen genauer an, kommt man schnell dahinter, dass die Autorin letztlich ziemlich unredlich agiert, um ihre zentrale These zu untermauern“. Die weitreichenden Schlussfolgerungen des Aufsatzes über den Hundeeinsatz an der deutsch-deutschen Grenze bewertete er als von bisherigen Untersuchungen völlig unbeeindruckte Spekulationen.38 Als nächsten Schritt bot „Schulte“ ihre „Forschungen“ der Zeitschrift Totalitarismus und Demokratie zur Veröffentlichung an. Folgt man den Angaben der anonymen Satiregruppe „Christiane Schulte & Freund_innen“, nahm die von dem stellvertretenden Institutsdirektor Uwe Backes geleitete Redaktion der Hauszeitschrift des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung (HAIT) in Dresden den Beitragsvorschlag aber innerhalb „weniger Tage“ mit einer überschaubaren Anzahl von Änderungswünschen zur Publikation an.39
Er sei ein „Riesenrhinozeros“, das jetzt an der Leine durch die Manege geführt werde, soll Backes gesagt haben, als er von einem Journalisten auf den liebevoll gefälschten Aufsatz angesprochen wurde, der über seinen Schreibtisch – den Text haben Kollegen und auch der Institutsdirektor ebenfalls gekannt40 – schließlich den Weg in die Hauszeitschrift gefunden hatte.41
Dem war vorausgegangen, dass im Februar 2016 „Christiane Schulte“ in einem digitalen Bekennerschreiben den gesamten Vorgang offen legte.42 Unmittelbar darauf folgte Peters.43 Trotzdem zwei von acht Vorträgen auf einer Tagung satirische Fälschungen waren, versuchte in der Folge die HAS-Community stillschweigend zur Tagesordnung überzugehen. Der Chimaira Arbeitskreis für Human-Animal Studies (Chimaira AK), der das unmittelbare Opfer des Hoaxes geworden war, reagierte mit der trotzigen Behauptung, der Beitrag sei keinesfalls als eleganter Unsinn erkennbar gewesen, schließlich sei „[w]eiterhin […] bisher weder bewiesen noch widerlegt, dass Wachhunde aus der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) nicht von KZ-Hunden abstammten“.44 Die Redaktion von „Totalitarimus und Demokratie“ verschickte eine Stellungnahme, in der sie sich für die Veröffentlichung entschuldigte. Der Redaktion habe „sich die Verfasserin u.a. mit einem ausführlichen Tagungsbericht der renommierten Internetplattform ‚H-Soz-Kult‘ empfohlen. […] [T]rotz eines intensiven Lektorats [sei] die Täuschungsabsicht nicht erkannt und die nötige wissenschaftliche Sorgfaltspflicht vernachlässigt“ worden. Das „liberale Grundverständnis der Zeitschrift [sei] missbraucht und für eine angebliche Wissenschaftskritik instrumentalisiert“ worden.45 Allerdings gingen der Verlag und das Institut ansonsten weniger souverän mit dem Hoax um. Der Beitrag wurde kommentarlos aus der eLibrary des Vandenhoeck & Ruprecht-Verlages gelöscht, das im Internet verfügbare Inhaltsverzeichnis sowohl auf der Seite des Verlages als auch auf der des HAIT stillschweigend um den Schäferhund-Text bereinigt. Im Jahresbericht des Instituts wird die Angelegenheit ebenfalls nicht benannt46, geschweige denn, dass eine erkennbare Auseinandersetzung mit dem Hoax stattfindet.
Der „deutsch-deutsche Schäferhund“ geisterte also seit dem Frühjahr 2016 durch Online-Medien und die deutsche Presse. Während die Wissenschaftsparodie von Alan Sokal vor 20 Jahren wie auch der jüngste Science-Hoax von Peter Boghossian zum „konzeptionellen Penis als sozialem Konstrukt“47 ausführliche Debatten nach sich zogen, hat der Hunde-Hoax, innerhalb der Geschichts- und Geisteswissenschaften bislang zu wenig Resonanz gefunden. Das ist erstaunlich, fordert die frei erfundene Studie Historiker*innen und andere Geisteswissenschaftler*innen doch gleich in mehrfacher Hinsicht heraus. Nach zahlreichen Gesprächen der Herausgeber mit Beteiligten und Interessierten gelangten wir zu der Ansicht, dass zu diesem Hoax noch lange nicht alles gesagt ist, dass er vielleicht nur einen Aspekt innerhalb eines übergreifenden Problemhorizontes abbildet und dass ihm eine virulente Bedeutung im Hinblick auf die gegenwärtige akademische Praxis zukommt: Auf dem Prüfstand stehen nicht nur wissenschaftlichen Qualitätsstandards und kritische Urteilskraft, sondern auch das Verhältnis der Geschichtswissenschaft zu ideologisierten Deutungen der Vergangenheit sowie die innerfachliche Debattenkultur. Die Herausgeber haben sich anlässlich des Hoaxes durch unzählige Seiten des jungen Forschungsfeldes gelesen. Sie haben viel gelernt, interessante Forschungsfragen und neue Perspektiven wahrgenommen, aber auch etliche mindestens halbgare Dinge gelesen und solche, die tatsächlich wie eine Wissenschaftsparodie wirken. Zudem beschlossen die Herausgeber, einen Workshop zu organisieren, der am 28. Oktober 2016 an der TU Berlin stattfand.48 Dazu mochte oder konnte keine/r der etwa zwei Dutzend angefragten HAS-Vertreter*innen erscheinen. Wenige versicherten glaubhaft, dass es tatsächlich terminlich nicht klappte, doch die meisten beantworteten nicht einmal unsere Anfrage.49 Dies verwundert insofern, als immer wieder herausgestellt wird, welch innovativen und für eine zeitgenössische Gesellschaft unverzichtbaren Leitideen die HAS repräsentierten. Wäre dem so, und sie hätten diese immense Innovations- und Anziehungskraft, stellt sich die Frage, warum niemand kam, um für seine wissenschaftlichen Positionen einzustehen und zu werben. Umso erfreulicher ist, dass Markus Kurth vom gehoaxten Chimaira AK sich bereit zeigte, einen Beitrag für dieses Buch beizusteuern. Zudem erhielten wir die freundliche Erlaubnis, nicht nur Interviews von „Christiane Schulte“ und dem Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk, sondern auch von Aiyana Rosen, Helen Keller und dem genannten Markus Kurth vom Chimaira AK mit sub\urban. zeitschrift für kritische stadtforschung abzudrucken.
Wenn diese Publikation manchen Lesern also insgesamt etwas „einseitig“ vorkommen mag, so liegt das nicht in der Absicht der Herausgeber, sondern vor allem an dieser Konstellation. Natürlich hatten wir Organisatoren auch Forscher*innen aus zahlreichen anderen Disziplinen angesprochen und eingeladen: aus den Geschichtswissenschaften, Politologie, Literaturwissenschaft, Biologie, Ethnologie, Soziologie und Wissenschaftssoziologie, Metropolitan Studies und Philosophie. Denn schließlich wollten wir kein Tribunal inszenieren oder gar Häme zeigen, sondern den Raum für eine offene und kontroverse Debatte öffnen. Es trafen dann 40 Menschen jeglichen Geschlechts zusammen und diskutierten angeregt auf drei Panels – meist im Fishbowl-Format – auf einem interessanten Workshop, der von einer anregenden Podiumsdiskussion abgeschlossen wurde.
Fokus und Aufhänger des Hoaxes sind die erwähnten HAS. Auch wenn jüngst der Versuch des Kulturwissenschaftlers Thomas Macho, den Bereich Animal Studies an der Berliner Humboldt-Universität zu etablieren, zurückgewiesen wurde50, gibt es inzwischen zwei thematisch zugeschnittene Professuren in Deutschland und ein erstes Textbook für Lehrende und Studierende im UTB-Verlag.51 Die HAS, die zu einem Feld gehören, das sich mitunter selbst als „more-than-human social sciences“ bezeichnet52, scheinen sich – so der Eindruck der Herausgeber – zu etwas wie dem Katzencontent der jüngeren, postmodern und kulturalistisch erweiterten Geistes-, Gesellschafts- und Sozialwissenschaften zu entwickeln.53 Wer im World Wide Web unterwegs ist, kommt um „Cat Content“ kaum herum. Die LOLcats etwa gehören zu den verbreitetesten Internet-Memen– „millionenfach kopierte Fotos von Katzen, denen durch eingefügte Schrift menschliche Sätze mit einer eigenartigen Grammatik in den Mund gelegt werden.“54 Ähnliches – Menschen legen Tieren eine Botschaft in Maul, Schnauze oder Schnabel – scheint häufig auch für die HAS zu gelten. Auch eine eigene Sprache entwickelt sich im Mikrokosmos dieses akademischen Feldes, die aus „tierisch“ „tierlich“ werden, durchweg von „nichtmenschlichen Tieren“ hören lässt, mit Jacques Derrida von „an-humain“ oder „l‘animot“ spricht, letzteres ein Neologismus, gebildet aus l’animal (Tier) und le mot (Wort), oder von Prädomestizität, Domestizität und Postdomestizität (Richard Bulliet) oder „Naturecultures“ (Donna Haraway).