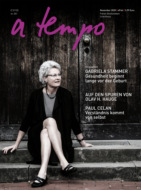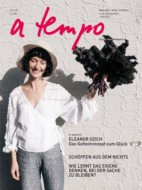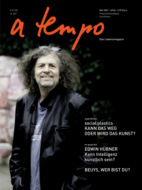Czytaj książkę: «a tempo - Das Lebensmagazin»

1 – über a tempo
a tempo - Das Lebensmagazin
a tempo Das Lebensmagazin ist ein Magazin für das Leben mit der Zeit. Es weckt Aufmerksamkeit für die Momente und feinen Unterschiede, die unsere Zeit erlebenswert machen.
a tempo bringt neben Artikels rund um Bücher und Kultur Essays, Reportagen und Interviews über und mit Menschen, die ihre Lebenszeit nicht nur verbringen, sondern gestalten möchten. Die Zusammenarbeit mit guten Fotografen unterstützt hierbei den Stil des Magazins. Daher werden für die Schwerpunktstrecken Reportage und Interview auch stets individuelle Fotostrecken gemacht.
Der Name a tempo hat nicht nur einen musikalischen Bezug («a tempo», ital. für «zum Tempo zurück», ist eine Spielanweisung in der Musik, die besagt, dass ein vorher erfolgter Tempowechsel wieder aufgehoben und zum vorherigen Tempo zurückgekehrt wird), sondern deutet auch darauf hin, dass jeder Mensch sein eigenes Tempo, seine eigene Geschwindigkeit, seinen eigenen Rhythmus besitzt – und immer wieder finden muss.
2 – inhalt
3 – editorial Quellen des Lebens von Jean-Claude Lin
4 – im gespräch Zukunft als Möglichkeitsraum Lena Papasabbas im Gespräch mit Doris Kleinau-Metzler
5 – thema Erwachen am anderen Menschen von Jean-Claude Lin
6 – augenblicke Quelle alter junger Weisheit von Christian Hillengaß
7 – herzräume Voll das Leben von Brigitte Werner
8 – erlesen John Garth «Die Erfindung von Mittelerde» gelesen von Konstantin Sakkas
9 – mensch & kosmos Allen ein Freund sein von Wolfgang Held
10 – alltagslyrik – überall ist poesie Du musst dein Leben ändern von Christa Ludwig
11 – kalendarium Juni 2021 von Jean-Claude Lin
12 – was mich antreibt Neugier und Freude von Brigitte Werner
13 – unterwegs Sieh, das Gute liegt so nah von Daniel Seex und Jean-Claude Lin
14 – sprechstunde Ein rosafarbener Lebensretter von Markus Sommer
15 – blicke groß in die geschichte Teil 2: Ein Licht, das nie erlosch. Der griechische Unabhängigkeitskampf von Konstantin Sakkas
16 – von der rolle Die sonderbaren «WonderBoys» von Elisabeth Weller
17 – eine seite lebenskunst Bewegungsfreude von Maria A. Kafitz & Christel Dhom
18 – wundersame zusammenhänge Lernen im Leben von Albert Vinzens
19 – kulturimpuls Mitgestalten am Morgen. Die Konferenz zur Zukunft Europas von Sebastian Hoch
20 – literaratur für junge leser Jihyun Kim «Sommer» gelesen von Simone Lambert
21 – mit kindern leben Sommeranfang von Bärbel Kempf-Luley und Sanne Dufft
22 – sudoku & preisrätsel
23 – tierisch gut lernen Zweisprachig! von Renée Herrnkind und Franziska Viviane Zobel
24 – suchen & finden
25 – ad hoc Pass auf! von Jean-Claude Lin
27 – bücher des monats
28 – impressum
3 – editorial
Quelle des Lebens
Liebe Leserin, lieber Leser!
An so manchem Tag der Erschöpfung, nach fortgesetzter anstrengender Arbeit oder anhaltender Krankheit, kann einem zumute sein, nach den Quellen des Lebens zu fragen. Wo finde ich sie, diese neuen Quellen von Energie, Wandel und Heiterkeit? Eine Lektüre der Beiträge dieser Ausgabe unseres Lebensmagazins hat mir eine erstaunliche Vielfalt solcher Quellen des Lebens beigebracht. Sie seien hier ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder Ausschließlichkeit der Reihe nach aufgelistet:
1. In der Zukunft, die ich mir vorstelle, damit sie einmal aufgehe in realer Gegenwart.
2. In der Verbindung, die ich in meinem eigenen Schicksal durch die Begegnung mit einem
anderen Menschen entdecke.
3. In der Wahrnehmung des Göttlichen eines fallenden Tropfen Wassers auf einen See.
4. In allen Tränen, die uns das Leben beibringt.
5. In den Sagen von Mittelerde, wie überhaupt den Sagen der Menschheit.
6. In Sonne, Mond und Erde und deren gegenseitigen Bewegungen und Erscheinungen.
7. Im Wandel des eigenen Lebens und seinen Dichtungen.
8. Im Schöpfen aus Freude und Neugierde.
9. In der Wahrnehmung alles naheliegenden Glückes.
10. In allem Verborgenen, das durch Aufmerksamkeit und nicht nachlassende Forschung zu Tage
geführt wird.
11. Im Gewahrwerden der Freiheit und Freiheitsbemühungen der Menschen aller Alter und Erdenräume.
12. Im Interesse, das ich aufbringen kann für die Art, wie andere und ich selbst vom Leben lernen.
Mögen Sie, liebe Leserin, lieber Leser, unbändige Lust empfinden, zur Vermehrung dieser Quellen des Lebens erkennend wie erschließend beizutragen!
Von Herzen grüßt Sie in diesem Monat der Sommersonnenwende,
Ihr



4 – im gespräch
Zukunft als Möglichkeitsraum
Lena Papasabbas im Gespräch mit Doris Kleinau-metzler
Fotos: Wolfgang Schmidt
Lena Papasabbas ist Kulturanthropologin und als Halbgriechin mit zwei Kulturen vertraut. Kulturanthropologie befasst sich mit unserer alltäglichen Gegenwartskultur, beispielsweise: «Warum tragen wir eine bestimmte Kleidung? Warum starren in der Bahn fast alle auf ihr Smartphone? Was macht diese Technologie mit uns?» Ihren Fragen nach dem «Warum» geht sie beim Frankfurter Zukunftsinstitut nach. Das Zukunftsinstitut analysiert Trends und zukünftige Entwicklungen und berät Organisationen und Unternehmen im Hinblick auf Veränderungsprozesse. Durch Corona hat sich für uns alle vieles verändert, ist anders geworden als wir gewohnt waren und planten. Die Unsicherheit, wie es in Zukunft weitergeht, wächst. Damit sind aber auch neue Möglichkeitsräume entstanden, meint zumindest die Zukunftsforscherin.

Doris Kleinau-Metzler | Liebe Frau Papasabbas, jede und jeder von uns hat Zukunftsträume und Zukunftsvorstellungen. Was sagen Sie als Zukunftsforscherin dazu?
Lena Papasabbas | Eigentlich ist Zukunft nur das, was wir uns vorstellen. In dem Sinne ist sie etwas, was nie eintrifft, also nur eine Fiktion. Sobald sie da ist, ist sie ja Gegenwart. Aber die Art, wie wir uns Zukunft vorstellen, bestimmt auch unsere Gegenwart. Wenn ich beispielsweise heute noch einen Termin beim Zahnarzt habe, beeinflusst mich das den ganzen Tag, ich bin angespannt, obwohl es ja in der Zukunft liegt. Auch die Prognosen für die Folgen des Klimawandels beeinflussen mich beim Einkaufen, bei meiner Urlaubsplanung. Im Hier und Jetzt ist es egal, ob ich den Müll trenne, für ein Wochenende nach Rom fliege – doch wenn ich Zukunft mitdenke, ist es moralisch möglicherweise nicht mehr vertretbar. Da muss man eine Balance für sich finden.
DKM | Eine gewisse Unsicherheit, was die Zukunft uns bringt, zwischen guter Hoffnung und Befürchtungen schwankend, kennen wir wohl alle. Das hängt wohl auch mit unserem Zeitempfinden zusammen, das anders ist als das von Kindern, die mehr oder weniger ganz in der Gegenwart leben.
LP | Ja, das lineare, messbare Zeitempfinden ist in unserer westlichen Kultur ganz fest verankert, alles fließt linear von der Vergangenheit in die Zukunft. Aber es gibt auch andere Arten, Zeit zu denken, zum Beispiel zyklisch, als andauernder Prozess. Die Zukunftsforscher kennen aus Befragungen zudem das «Zukunftsparadox», das heißt, für unser persönliches Leben sind wir eigentlich recht zuversichtlich. Anders sieht es aus, wenn wir an die Gesellschaft, an die Welt denken – dann meinen wir, dass die Gesellschaft weiter verrohen wird, der Klimawandel unaufhaltsam ist usw. Diese unterschiedliche Sicht auf den persönlichen Bereich und die Gesellschaft wurde fast zu jeder Zeit in vielen Kulturen der Welt so wahrgenommen; man sah sich kurz vor der Apokalypse, dem Ende der Welt. Dieses Grundgefühl ist da, auch wenn wir in der westlichen Welt meist in Wohlstand und relativer Sicherheit leben. Eine entscheidende Rolle unserer jetzigen allgemeinen Zukunftsbefürchtungen kommt heute der Art zu, wie Medien agieren – Überschriften sind oft alarmistisch, Social Media spuckt automatisch immer mehr Meldungen und Nachrichten aus, die sehr emotionalisierend sind und häufig auf Angst und Panik setzen. Das trägt dazu bei, dass wir die gesellschaftliche Zukunft pessimistisch und als festgelegt sehen – wenn wir nicht darüber reflektieren.
DKM | Aber es ist nicht leicht, im Alltagstrott und -stress zum Nachdenken zu kommen, ob es einen anderen Weg gibt. Hat Corona etwas daran geändert?
LP | Ja, denn manchmal ist Abstand zum Gewohnten hilfreich, um offen für Neues zu werden – wie im Urlaub vielleicht. Die Corona-Krise mit den verschiedenen Stufen des Lock Down hat Distanz erzwungen und für manche dabei entschleunigt. Der totale Bruch mit dem, was vorher normal war, hat anfangs zu einer Art Innehalten beigetragen, eine neue Achtsamkeit bestärkt. Ein großes Problem ist ja, dass viele Menschen so in die Zukunft verhaftet sind, die nächsten Termine im Blick, den Sommerurlaub in der Planung, dass sie dabei das Leben, das gerade jetzt läuft, ein bisschen verpassen. Es gibt nur ein reales Leben − und das ist hier und jetzt. Es sind viele Dinge im Alltag weggefallen, die uns sonst beschäftigen, aber manchmal eben auch Terminstress verursachen. Nun aber verbringt man viel mehr Zeit zu Hause, sieht vielleicht seinen vollen Kleiderschrank und merkt: Ich brauche kein neues Outfit, keine andere Wimperntusche. Fragen tauchen auf: Was ist mir wirklich wichtig? Woher kommen diese künstlichen Bedürfnisse? Konsum ist für mich als Kulturanthropologin ein wichtiges Zukunftsthema. Wir können zum Beispiel in Zukunft mehr Produkte produzieren, die Menschen wirklich brauchen, die lange halten, weil man sie reparieren kann − statt Wegwerfartikel, in denen eingebaut ist, dass sie nach drei Jahren kaputt gehen. Das bedeutet Postwachstum, denn es geht dann nicht mehr darum, noch mehr Profit zu erzielen, immer mehr zu verkaufen, sondern um eine andere Qualität und darum, nachhaltig mit unseren Ressourcen umzugehen.
DKM | Ja, aber wir machen uns doch auch derzeit viel mehr Sorgen um unsere Gesundheit …
LP | Vor Corona war Gesundheit etwas, das immer weiter optimiert werden musste. Man wollte fitter, schöner, schlanker sein, das Altern unsichtbar machen. Es ging um Fitness, Vitalität, Sexiness. Durch Corona ist viel klarer geworden: Gesundheit ist in erster Linie die Abwesenheit von Krankheit – und das allein ist ein hoher Wert, den man schätzen kann wie ein Geschenk. Es kann schnell verloren gehen, wenn man sich irgendwo ansteckt und schwer krank wird. Man hat es nicht völlig in der Hand. Durch die mit der Corona-Pandemie in vielen Ländern verbundenen Einschränkungen wurde zudem vieles Selbstverständliches abrupt unterbrochen, das heißt, eine Krise, wie sie vorher nicht für möglich gehalten wurde, erfasste die Welt. Die Wirtschaft ist gedrosselt, unsere Freiheit im sozialen Leben, Konsumieren und Reisen, wann und wohin man will, sind eingeschränkt. Viele Menschen leiden auch seelisch darunter und sind zudem in existenzielle Not geraten. Das ist die eine Seite. Aber eine Krise führt auch oft zu Erschütterungen, die Starres und Gewohntes lockern können und Neues hervorbringen. Dadurch kann sich ein Möglichkeitsraum entwickeln, der auch neue Zukunftsbilder entstehen lässt. Denn wenn vorher als zentral für unsere Zukunft die Technik angesehen wurde (künstliche Intelligenz-Projekte, Roboter, die Menschen pflegen), haben wir nun erlebt, dass wir andere, uns nahe stehende Menschen brauchen, besonders aber auch Menschen, die in sogenannten «systemrelevanten Berufen» arbeiten – von Krankenpflegerinnen und Altenpflegern über Verkäuferinnen bis zu Lehrerinnen und Erziehern. Es sind eben nicht die hochbezahlten IT-Berater und Banker, die sich in der Krise als systemrelevant erweisen!
DKM | Viele Frauen haben unter Corona-Bedingungen zusätzlich noch mehr Care-Arbeit übernommen, Sorgearbeit, die den gesamten Bereich der Fürsorge für die eigene Familie umfasst, vom Essenkochen und Einkaufen über das Drandenken an Geburtstage der Verwandtschaft bis zur Betreuung der Kinder zu Hause − auch wenn sie selbst im Homeoffice tätig, voll berufstätig waren. Frauen sind zudem traditionell oft in systemrelevanten, aber gering bezahlten Berufen. Die alten Geschlechterzuschreibungen sind also immer noch da …
LP | Ja, aber sie wanken. Mit dieser neuen Erfahrung verschieben sich Bewertungen und Werte von dem, was wirklich wichtig ist für uns – mit sicher langfristigen Auswirkungen, bis hin zu einem anderen und gerechten Entlohnungssystem. Gleichzeitig gab es auch mehr Väter, die sich aufgrund von Homeoffice und Homeschooling mehr um die Kinder gekümmert haben als zuvor. Dass das wirklich ein Knochenjob ist und nichts, was man so nebenbei zwischen zwei Meetings machen kann, ist eine wesentliche Erfahrung geworden. Diese Care-Arbeit ist, auch wenn sie nicht bezahlt wird, eine wirklich anstrengende Arbeit, die Zeit und Energie erfordert − aber sie ist auch eine erfüllende und wertige, das Leben bereichernde Sache. Auch dieser Schritt hat sich schon vorher angedeutet, denn insbesondere jüngere Männer sagen: Karriere ist mir nicht das Wichtigste. Ich will nicht zehn Stunden im Büro sein, sondern auch aktiv und verantwortlich teilhaben am Leben mit den Kindern. Da verschiebt sich etwas, das durch die Corona-Bedingungen möglicherweise verstärkt wird.

DKM | Sie sehen als Zukunftsforscherin die vielen kleine Veränderungen als Gesamtes. Wo beginnt das für jeden Einzelnen?
LP | Äußere Lebensbedingungen und innere Haltung sind eng verbunden. Diese innere neue Haltung findet sich vielleicht auch in dem, was wir enoughness nennen (genug ist genug). Dass wir selbst uns Grenzen des «Genug» setzen, gibt eine wesentliche Orientierung für unsere Lebensqualität – nicht dem immer mehr Geld, mehr Konsum, mehr Events nachzujagen. Daraus ergibt sich, auch mehr Zeit zu haben für Familie und Selbstverwirklichung. Das heißt nicht, dass dann jeder in unterschiedlichen Sphären ist, allein im Wohnzimmer in seiner Blase sitzt. Wir haben durch Corona doch auch die Erfahrung gemacht, dass wir als Weltgesellschaft tatsächlich verbunden sind, nicht nur im Geist, sondern ganz faktisch. Wir sind miteinander verbunden – im Kleinen und im großen Ganzen. Das Leitbild dieser Verbundenheit, wir nennen es connectedness, steht der Tendenz zu Individualisierung und Egoismen gegenüber, die damit ein Stück weit überwunden werden kann – das heißt, dass man sich selbst als Mensch nicht als isoliertes Individuum wahrnimmt, sondern auch als einen Knotenpunkt, der eingebunden ist in sozialen Netzwerken, in ein größeres Ganzes.
DKM | Zum großen Ganzen gehört auch unser Dorf, unsere Stadt, in der wir leben – und auch, dass in der globalen Welt Ungerechtigkeit, extreme soziale Ungleichheit, Kriege und Elend herrschen. Unser Wohlstand, unser Konsum beruhen in vielfacher Weise auch darauf. Wie sehen Sie Ihre Zukunft vor diesem Hintergrund?
LP | Auch dagegen wendet sich das Comeback von Regionalität und Lokalität, das es schon vor Corona gab, vor allen Dingen, wenn es um Lebensmittel ging. Was baut der Bauer unter welchen Bedingungen in der Nähe an, was bietet der kleine Laden an der Ecke? Man hatte fast vergessen, dass man sein Fahrrad nehmen und in der eigenen Region herumfahren kann. Durch Corona hat sich dieser Trend verhundertfacht. Es sind viele Sachen, die dem Großtrend Globalisierung entgegenwirken, Handel, Gastronomie mit lokalen Spezialitäten, Handwerk, Produkte. Neue Verbindungen entstehen, auch zwischen lokal und global, man nennt das «glokal». Ich verbinde Zukunft tatsächlich mit sehr viel Hoffnung auf Wandel. Ich nehme die Zeit, in der ich lebe, als eine wahr, in der ganz viel passiert, in der sich Normalität verändert, in der beispielsweise Ungerechtigkeit nicht mehr so hingenommen wird, auch beim Thema Feminismus und Gleichberechtigung. In dieser Zeit des Wandels verschieben sich auch Machtverhältnisse. Das merkt man auch an kleinen Stellschrauben wie der Tagesschau, die seit einiger Zeit gendert, oder weiblichen Protagonisten in Videospielen oder mehr Vielfalt in Filmen und Serien. Ich glaube, dass die Welt in 20, 30 Jahren tatsächlich eine bessere ist.
5 – thema
erwachen am anderen menschen
von Jean-Claude Lin Als Mensch können wir verschiedene Stufen des Erwachens erleben. Im Traum erwachen wir aus dem Tiefschlaf. Starke, zuweilen verwirrende, angstvolle oder sehnsuchtsvolle Bilder erleben wir dabei. Selbst eingreifen können wir aber nicht – beziehungsweise, wenn wir das tun wollen, wachen wir auf. Aus dem Traum wiederum wachen wir für unsere Umgebung hier auf der Erde auf, ergreifen unsere Sinneswahrnehmungen und unsere Gedanken. So können wir ins Gespräch mit anderen Menschen treten, erfahren auch von ihren Erlebnissen, ihren Gefühlen, Gedanken und Vorhaben. All das gehört zu unserem täglichen Leben: schlafen, träumen, wachen.
Als Mensch können wir verschiedene Stufen des Erwachens erleben. Im Traum erwachen wir aus dem Tiefschlaf. Starke, zuweilen verwirrende, angstvolle oder sehnsuchtsvolle Bilder erleben wir dabei. Selbst eingreifen können wir aber nicht – beziehungsweise, wenn wir das tun wollen, wachen wir auf. Aus dem Traum wiederum wachen wir für unsere Umgebung hier auf der Erde auf, ergreifen unsere Sinneswahrnehmungen und unsere Gedanken. So können wir ins Gespräch mit anderen Menschen treten, erfahren auch von ihren Erlebnissen, ihren Gefühlen, Gedanken und Vorhaben. All das gehört zu unserem täglichen Leben: schlafen, träumen, wachen.
Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit des Erwachens über unser waches «Tagesleben» hinaus, die wir allerdings nur selten voll bewusst wahrnehmen, die wir aber doch hin und wieder erahnen. Diese weitere Stufe des Erwachens kann sich in der Begegnung mit der Biografie eines anderen Menschen ereignen. Rudolf Steiner nannte es das «Erwachen am Seelisch-Geistigen des anderen Menschen». Es bildet das Tor zu einer bedeutsamen Erweiterung unseres Seelenlebens ins Spirituelle hinein. In der Biografie eines Menschen kann etwas aufscheinen, was weit über die einzelnen Gedanken, Gefühle und Handlungen eines Menschen hinausweisen, was sogar auf einen noch weiteren Hintergrund dieses einen Lebens hinweisen kann. Es ist etwas, das wir mit dem alten deutschen Wort «Schicksal» oder dem östlichen Ausdruck „Karma“ in Verbindung bringen können. Das besondere dabei ist, dass wir zu dessen Wahrnehmung meist die Begegnung mit einem anderen Menschen brauchen.
Ein bewegendes Bild eines solchen «Erwachens» für die Tiefen des eigenen Schicksals ist in der folgenden kleinen Geschichte gegeben, die nicht erfunden ist, sondern die sich wirklich zugetragen hat.
In München lebte einst das Mädchen Ruth Guggenheim mit ihrer Schwester und ihren beiden Eltern. Der Vater war Arzt. Und Ruth hatte eine über alles geliebte Puppe, die sie Elisabeth nannte. Eines Tages hatte sich ihr Hund die Puppe geschnappt und am Arm so zugebissen, dass tiefe Bissspuren an der Puppe entstanden. Ruth lief mit ihrer Puppe schnell in die Praxis ihres Vaters, damit er die Wunden verbinde. Dadurch war auch Ruth beruhigt und alles schien wieder in Ordnung zu sein. Doch eines Tages kam sie aus der Schule nach Hause und sah, wie ein in brauner Uniform gekleideter Soldat vor ihrem Zuhause, in dem auch die Praxis des Vaters war, auf und ab ging. Der Soldat sollte darauf achten, dass keine nicht-jüdischen Menschen in die Praxis ihres Vaters eintraten.
Eines Nachts nun wurde Ruth von ihren Eltern geweckt. Sie mussten fliehen – so unauffällig wie möglich und daher alles zurücklassen. Auch ihre so sehr geliebte Puppe Elisabeth musste Ruth zurücklassen.
Über Italien und Frankreich floh die Familie in die USA. Dort wuchs Ruth Guggenheim auf, heiratete einen Mann namens Nivola und bekam eine Tochter, Claire. Als Claire sechs Jahre alt wurde, erzählte sie ihrer Mutter, dass sie so gerne eine Puppe hätte. Für Ruth, die ihre über alles geliebte Puppe hatte zurücklassen müssen, war das natürlich ein sehr nachvollziehbarer Wunsch, der allerdings viele schmerzliche Erinnerungen weckte. Doch sie machte sich auf den Weg in die Stadt und kam – nach langer vergeblicher Such nach einer hübschen Puppe – an einem Antiquitätenladen vorbei. Auf einer Kommode entdeckte sie eine sehr schöne alte Puppe, die ihr irgendwie bekannt vorkam. Sie trat ein und fragte nach ihr. Als sie die Puppe in Händen hielt – sie konnte es kaum glauben –, bemerkte sie genau an derselben Stelle wie bei ihrer Elisabeth die Bisswunden am Arm. Auf eine geheimnisvolle Art und Weise hatte ihre Puppe ebenfalls den weiten Ozean nach Amerika überquert. Eine tiefe Wunde in ihrem Leben wurde geheilt: Claire bekam die Puppe ihrer Mutter geschenkt und konnte später Elisabeth sogar an ihre eigene Tochter weitergeben. Ein früheres Leben war wieder mit dem späteren verbunden.
In jeder Biografie eines Menschen können wir solche zunächst verborgenen Zusammenhänge entdecken. Wenn wir sie wahrnehmen, dann helfen sie uns über jedes Unverständnis, jede Entfremdung oder gar Feindseligkeit unter uns Menschen hinweg. Dann wissen wir uns miteinander als Teil einer großen menschheitlichen Familie. Das macht den Zauber einer tiefergehenden Begegnung mit der Biografie eines Menschen aus.
Darmowy fragment się skończył.