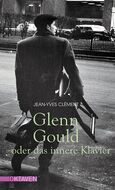Czytaj książkę: «Du gehörst mir»
Peter Middendorp
DU GEHÖRST MIR
Aus dem Niederländischen von Rolf Erdorf

Inhalt
I FRÜHJAHR
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
II SOMMER
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
III HERBST
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
IV WINTER
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
«AUCH UNTEN EMPFINDET MAN LUST UND LEID, MAGDA, ES IST GENAU WIE OBEN, ES IST GLEICH, OB MAN OBEN ODER UNTEN LEBT.»
HANS FALLADA, DER TRINKER
ICH STAND HINTEN AUF DEM FELD UND SAH ZU, WIE DAS LINKE BEIN MEINES VATERS VON EINEM MÄHDRESCHER AUFGEFRESSEN WURDE. Es war sein erster eigener Mähdrescher. Lange hatte er sich keinen zulegen wollen. Aber von der Mentalität von früher war ja kaum etwas geblieben. Fast nichts wurde mehr gemeinschaftlich angeschafft, immer weniger miteinander geteilt. Vater hatte sich für einen großen, modernen, flammend Roten entschieden. Auch, wie er sagte, mit Blick auf die Zukunft des Hofs.
Jetzt lag er da.
Und ich stand dabei und betrachtete ihn, ein Junge noch, zwölf, fast dreizehn.
Ein Bein lag frei, das andere hatte sich in der Maschine verfangen.
Es war, als ob die Messer im Inneren bei jeder Umdrehung eine neue Scheibe von seinem Bein abtrennten.
Er schrie, gellte langgezogen, irreal, schrill.
In dem Schreien lag Abscheu; anfänglich, so schien es, mehr des Schicksals als der Schmerzen wegen.
Er stieß sich ab mit dem Absatz, mähte mit den Armen und grub mit seinen starken Händen und Fingern im Sand – zurück wollte er, zurück mit aller Kraft, die in ihm steckte, aber es ging nicht, es gelang ihm nicht.
Er blutete wie ein Schwein – das Leben ergoss sich über das warme Stoppelfeld. Ich wusste, ich war zu jung für dieses Schauspiel, viel zu jung, ich hatte noch keine Verteidigung. Trotzdem konnte ich nichts als hinschauen. Hinschauen und weiter hinschauen, während ich meinen Vater hasste, weil er aus mir einen Zuschauer gemacht hatte.
Als Derksen auf den Mähdrescher stieg, schrie Vater nicht länger. Seine Kräfte waren dahin. Sein Kopf war nach hinten weggeknickt, der Mund ein wenig offen.
Derksen drehte den Schlüssel um – die Stille kam wie eine Detonation, sie donnerte auf einen herab, der Staub wirbelte, überall war Staub. Sofort danach sank er neben Vater auf die Knie. «Jan!», rief er. «Jan!» Mit der flachen Hand schlug er ihm einige Male ins Gesicht. «Jan! Jan!»
Einen Moment öffneten sich die Augen, schienen einen Moment nach einer Öffnung in der Wirklichkeit zu suchen, dann schlossen sie sich wieder.
«Keine Sorge, Jan», sagte Derksen. «Wir sind noch nicht zu spät.» Er nahm eine Hand meines Vaters und presste sie sich gegen die Brust. «Wir sind noch nicht zu spät.»
Sie sagen, meine Mutter hätte an diesem Tag ihre Schönheit eingebüßt. Das kann nur dann stimmen, wenn sie davor eine schöne Frau gewesen ist. Ich weiß es nicht, ich kann es weder abstreiten noch bestätigen, obwohl ich viel Zeit mit ihr verbracht habe in den ersten Jahren, den Kinderjahren, in der Küche und dem Wohnzimmer, aber mitunter auch auf der Treppe ins Obergeschoss, wenn sie sich im Badezimmer langsam in Ordnung brachte.
Als Kind sieht man so etwas nicht. Als ich unter ihren Röcken hervorkam und hochschaute, ist mir jedenfalls nichts Besonderes aufgefallen.
Mutter kam schreiend aufs Feld gerannt, die Arme in der Luft.
Alles war ein Ziel für ihre Panik.
Sie rannte zu Vater, stürzte sich in den Sand an seine Brust.
Sie rannte zu Derksen, zerrte ihn am Overall, als fordere sie von ihm, dass die Zeit zurückgedreht würde bis kurz vor dem kleinen, banalen Moment, als Vater nach einer ungeschickten Bewegung das Gleichgewicht verloren hatte.
Sie rannte zu der Maschine, rief, flehte, rannte wieder zu Derksen und zu Vater. So rannte sie weiter, eine ganze Zeit, überallhin, nur nicht zu mir.
Der Krankenwagen hielt auf der Straße, die Sanitäter kamen mit einer Tragbahre angerannt. Sie sahen alles. Alles nahmen sie wahr, darauf sind sie trainiert, nur mich sahen sie nicht.
Die Polizisten erbarmten sich meiner Mutter, nahmen sie mit in die Küche und versuchten sie zu beruhigen, während sie bereits einige erste Fragen stellten. Sie befragten Derksen bei sich zu Hause, zusammen mit seiner Frau, die selbst doch gar nichts gesehen hatte.
Mich fragten die Polizisten nichts.
Sie sahen mich nicht.
Von mir wollten sie nichts wissen.
Die Männer aus der Nachbarschaft, die seufzend auf der Auffahrt standen, besprachen miteinander, wer das Melken übernehmen sollte, wer wann was tun konnte. Zu mir sagten sie nichts, sie sahen mich nicht. Genau wie die Männer, die einige Tage später den Mähdrescher vom Acker schleppten, auf einen Tieflader packten und ihn vorsichtig davonfuhren.
Mit Vater und Mutter hatte der Krankenwagen auch den Tag mitgenommen. Das Licht verlor seine Farbe. Auf der Hauptstraße fuhr kein Verkehr mehr. Es war still, windstill, mäuschenstill. Ich konnte meinen Herzschlag hören, das Rauschen in meinen Ohren.
Die Dämmerung legte sich langsam über das Land. Das Haus war leer und dunkel. Alle waren im Krankenhaus, mein Vater und meine Mutter. Selbst die Nachbarn waren schon unterwegs dorthin. Ich stand noch auf dem Feld, die Zeit verging schnell.
Nachts lag der Mond hinter den Pappeln halb tot auf dem Rücken. Die Stare schliefen in den Bäumen, die älteren sicher, nah am Stamm, die Jungen und Kranken auf den äußeren Ästen und Zweigen – so legten die Starken einen tierischen Schild der Schwäche um sich, als erwürben Stare nur durch das Überleben des ersten Winters das Recht auf ein Weiterleben.
Der Morgen nahte mit Möwen, die sich still glänzend, das erste Licht unter den Bäuchen, geräuschlos über das Land führen ließen. Ich zog die Hände aus den Taschen und erschrak bei ihrem Anblick. Sie waren dick geworden, hart, Arbeitshände, Instrumente.
Ich sah die Schwalben tief über den Wassergraben streichen, der erste Kormoran des Tages hing seine Flügel zum Trocknen in die Bäume. Ich ging allein nach Hause zurück. Der Himmel zog sich zu.
Es dauerte Wochen, bis man mich wieder bemerkte. Bevor man manchmal, vereinzelt, ganz kurz zu mir hinschaute. Mutter, Nachbarn, Bauern. Lehrer, Ärzte, Krankenpflegerinnen. Tankwagenfahrer, Vertreter, der Importeur von Landmaschinen. Wenn sie schauten, dann nicht, um Informationen abzurufen. Sondern um welche zu senden, gerade lange genug, um mich wissen zu lassen, was ich eigentlich schon wusste.
Ich sah es an Passanten, Dorfbewohnern groß und klein. Ich sah es an meinem Vater, als der nach vielen, vielen Wochen endlich aus dem Krankenhaus entlassen worden war und mir im Vorbeifahren in seinem Rollstuhl kurz in die Augen schaute.
Ich habe es auch selbst im Spiegel gesehen.
Da sah ich, was ich schon verstanden hatte.
I
1
ICH BIN DER VERACHTETE, DER UNSYMPATHISCHE. Die Geringachtung hat mich irgendwann heimgesucht, noch auf dem stoppeligen Feld, mittlerweile an die dreißig Jahre her. Danach ist sie immer bei mir geblieben, hat mich weniger verfolgt als vielmehr ins Schlepptau genommen, durch die Schulen und die Jahre, bei allem, was ich tat und unternahm, bis hierher in diese Zelle, ein paar Quadratmeter Ruhe.
Geringachtung nistet sich ein in der menschlichen Konstitution, auch wenn man noch klein ist, ein Kind faktisch noch. Die hängenden Schultern, die schmalen Hüften, die in hunderttausenden dünnen Pusteblumenhärchen über das Land verwehte Frisur – ich denke manchmal, ohne Geringachtung wäre ich größer geworden, breiter, hätte mehr Raum eingenommen.
Man sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber das ist ein Spruch für Leute, die nicht wissen, dass man die Hoffnung schon verlieren kann, kaum dass man richtig angefangen hat. Ein abgehobener Spruch, ohne Boden unter den Füßen. Tatsächlich stirbt die Hoffnung gerade bemerkenswert schnell. Ruck, zuck, länger braucht es nicht. Man merkt es erst, wenn es passiert ist. Nanu, denkt man, war das die Hoffnung, die mich soeben verlassen hat, der Geist der Hoffnung?
Man hofft ja nicht auf etwas, wovon man weiß, dass es ohnehin nicht geschieht. Man glaubt dem Direktor nicht, wenn er einen zu sich ruft und sagt: «Du fängst hier noch mal ganz neu an, ganz von vorn. Keiner kennt dich, keiner weiß, was an der vorigen Schule passiert ist. Hier bekommst du eine neue Chance. Greif zu, würde ich sagen. Ergreife sie mit beiden Händen!»
«Ja», sagst du. «Gut, in Ordnung, das werde ich.»
Aber du weißt längst, woran du bist. Du siehst es auch schon beim ersten Schritt in die neue Schule, dem ersten Schritt über die Schwelle der neuen Klasse. Du fühlst es. Eine bestimmte Dumpfheit. Im Kopf, in den Schultern. Als ob der Körper zu lange in eine unbequeme Haltung gezwungen gewesen wäre. Auch in den Armen und Beinen kannst du es spüren, den Knochen – Geringschätzung ziept und zwickt wie Wachstumsschmerzen.
Alle waren neu in der Klasse, aber in dem Moment, als ich hereinkam, schien es plötzlich, als ob sich alle schon seit Jahren kennen würden und ich der einzige Neuling war. Wie durch Zauberhand besaßen die anderen etwas Gemeinsames. Abneigung war ihre erste geteilte Erfahrung. So lernten sie sich untereinander kennen; ich war der Katalysator des Gruppenprozesses.
Das Gute an der neuen Schule war: Ich wurde nicht enttäuscht. Sie brachten mich nicht aus der Fassung, die Kinder, die Jugendlichen, sie brachten mich nicht mehr durcheinander.
Hinter dem Einkaufsplatz, wo die Gedenkumzüge und später auch die Demonstrationen gegen das Asylbewerberheim stattgefunden haben, führt eine schmale Gasse zu der Diskothek zwischen dem Supermarkt und dem Friseursalon, in dem Rosalinde einen Teilzeitjob hatte.
Ich denke, ich bin höchstens zehn Mal in De Tangelier gewesen. Ich kam dort nicht viel weiter, als dass ich ein oder zwei Stunden auf die Tanzfläche schaute, an einen Pfeiler gelehnt, die Hände in den Taschen. Manchmal rauchte ich etwas, manchmal trank ich zu viel Bier.
Die Jungs blieben am Tresen hängen, lautstark und halb betrunken. Die Mädchen tanzten paarweise auf der Tanzfläche, ihre Handtaschen zwischen sich auf den gelben Steinfliesen. Sie waren ausnahmslos blond und trugen enge Jeans sowie rosafarbene Frottee-T-Shirts mit rundem Ausschnitt.
Da steht er, sagten sie.
Ich konnte es durchaus hören – sie ereiferten sich am meisten über die Leute, mit denen sie am wenigsten zu tun haben wollten.
Da steht er. Und beobachtet uns.
Männer machen den Krieg, Frauen bestimmen die Ziele. Nie machen sie sich selbst mal die Hände schmutzig. Alles geht implizit, über die Bindung. Eine kleine Geste. Ein Blick. Eine leicht gekräuselte Nase. Ein gestreckter Hals. Augen, für einen Moment leicht geweitet. Ein Lächeln oder ein kleiner Wink und sie brauchen den Jungs schon nichts mehr zu erzählen.
Um diese Jungs habe ich mich nie viel geschert. Ich habe nie etwas erwartet und nie etwas bekommen, und am Ende hatte ich doch eine Frau, zwei Kinder und einen Bauernhof.
So ist es passiert. Bei den Verhören haben sie mich manchmal gefragt, warum alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. «Sie hätten mich mehr in Ruhe lassen sollen», sagte ich. «Ob das etwas geändert hätte, weiß ich nicht, aber jedenfalls hätte ich es zu schätzen gewusst.»
Eines Abends stand Ada plötzlich neben mir. Sie war etwas kleiner als ich, einen halben Kopf, weder schlank noch dick, weder rund noch flach, mit halblangem, fast weißem Haar. Ich kannte sie nicht, ich hatte sie vorher noch nie gesehen, sie käme aus einem Dorf gut zwanzig Kilometer weiter, sagte sie, aber da gäbe es keine Diskothek.
Eine Weile beobachtete sie zusammen mit mir die Tanzfläche. Sie folgte meinen Augen, als ob sie herausfinden wollte, wo mein Blick die Mädchen traf.
Dann sagte sie etwas.
Ich zuckte mit den Schultern, die Musik war zu laut.
Sie stellte sich auf Zehenspitzen – sie trug halbhohe Stiefeletten – und beugte sich zu meinem Ohr, bevor sie sich wieder auf ihre Absätze sinken ließ, als ob die Aktion sie ein wenig ermüdet hätte, enttäuscht vielleicht.
Ich betrachtete sie mit neuen Augen, aber ich sah nach wie vor dasselbe Mädchen, dieselbe junge Frau, nicht schön, aber auch keinesfalls hässlich.
Die ersten Minuten hinter der Sporthalle vergingen eher zäh; Kinder, die gegenseitig vom Eis des anderen kosten und gleichzeitig versuchen, mehr zu nehmen, als zu geben.
Unterwegs hatte sie nichts gesagt, jetzt sagte sie «warte», schob mich ein Stück von sich weg, zog sich die Hose runter, stieg aus einem Hosenbein und drehte sich zu mir um.
Hinter der Sporthalle gab es wenig Licht, nur ein bisschen von einer Laterne am Fahrradweg. Ich legte meine Hände auf ihre Hüften und begann vorsichtig suchend; es war meine erste Erfahrung. Dann machte ich weiter, fester, schneller. Vielleicht, dachte ich, konnte man die Hoffnung wieder etwas anfachen, Stoß für Stoß, Funken für Funken.
Ada stemmte die Hände gegen die Wand.
2
MEINE ELTERN HABEN ADA WIE EINE FREMDE EMPFANGEN. Sie beobachteten sie wie seinerzeit auch die ersten Flüchtlinge, als diese, eine oder zwei Haltestellen zu früh aus dem Bus gesetzt, vor unserem Haus vorbei über die Straße zum Dorf zogen, ein bunter Tross farbiger Menschen mit Sack und Pack, der lange Reihen von Kindern hinter sich herzog, die großen Mädchen mit Kopftüchern.
Sie waren eigens dafür in den Vorgarten gelaufen, zwei von Korsett und künstlichem Bein zusammengehaltene Menschen, die Hände am Zaun und mit hängenden Schultern.
Meine Eltern konnten sich nicht erinnern, dass irgendwer in die Zeitung gesetzt hätte, wir hier wüssten nicht, wohin mit unserer Gastfreundschaft. Das irgendwer gesagt hätte: «Kommt und nehmt, soviel ihr wollt, sie verludert sonst ohnehin!»
Es dauerte lange, bis die Asylsuchenden wieder außer Sichtweite waren, meine Eltern seufzten, bevor sie langsam zurück ins Haus gingen.
Ein Mensch ohne Gastfreundschaft hat fast nichts mehr zu geben. Eigentlich ist so jemand auch schon kein Gastgeber mehr.
Wir haben sie langsam daran gewöhnt. Am Anfang kam Ada nur samstags vorbei, nach dem Essen, zum Kaffee, und war vor dem Schnaps schon wieder fort. Veränderungen kommen immer ungelegen, sie bringen Unruhe mit sich. Als ob eine zusätzliche Person auf dem Sofa die Abende beleidigte, die wir zu dritt verbracht hatten.
Aber wir mochten immer noch ein drittes Tässchen, oder ein viertes. Ada backte Torten und Kuchen, die erst spät aus dem Ofen kamen. Wir dehnten die Kaffeezeit aus; langsam, allmählich, immer weiter, und zwar so lange, bis die Kaffeezeit die Schnapszeit allmählich überlappte und wir die Sehnsucht nach einem Schnaps die weitere Arbeit tun lassen konnten.
Meistens war es noch hell, wenn ich sie zur Tür brachte, und ich brauchte mich nicht zu fragen, ob sie auch sicher nach Hause fände. Aber ehrlich gesagt habe ich nie Angst gehabt, dass etwas passieren könnte. Auch später nicht, als Suze selbständiger wurde. Nie wirklich.
Manchmal blieb sie über Nacht, bei mir im Bett. Am nächsten Morgen stand sie mit mir auf und verließ lange vor dem Frühstück zusammen mit mir das Haus.
Manchmal auch schliefen wir erst gegen Morgen ein und schraken erst nach zehn aus dem Schlaf hoch. Dann gab ich dem Wetter die Schuld, während ich zusätzliches Brot zum Auftauen aus der Gefriertruhe holte. Oder ich redete etwas von der Dunkelheit, den langen, leeren Fahrradwegen zwischen den Dörfern. Es hätte gestürmt, gewittert, einfach wie aus Eimern gegossen – hatten sie das denn nicht mitbekommen?
Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat – Ada zufolge jedenfalls eine Ewigkeit –, aber eines Tages sagte Mutter: «Wenn du nächste Woche etwas früher kommst, dann darfst du auch mit uns mitessen.»
Die Wochenendbesuche wurden länger – der Freitag wurde drangehängt, der Sonntag, ein erster Montagmorgen. Ada kam immer früher und ging auch immer etwas später, so lange, bis sich die Wochenenden am Mittwoch berührten und sie immer bei uns war.
So begann mein Verhältnis mit Ada Hofstra, einem jungen Mädel damals noch, die offenbar wenig bis nichts an die Menschen band, die sie vor unserer Begegnung gekannt hatte. Sie sprach nie über Eltern, Freunde oder Bekannte. Soweit ich wusste, besaß sie keine Geschwister, Tanten, Onkel oder auch nur ein Haustier.
Sie sprach nicht viel.
Und wenn, musste man manchmal die Ohren in ihre Richtung spitzen. Was? Was hast du gesagt?
Nach draußen kam sie wenig, der Bauernhof war nichts für sie. Im Haus bewegte sie sich die ersten Jahre vorzugsweise an den Wänden entlang, so als könnte man andere am besten an sich gewöhnen, indem man quasi nicht da war.
Obwohl wir nicht groß wohnten.
Ein Wohnzimmer haben wir, eine Küche und eine Waschküche, eine Diele mit Flur und eine Treppe zu einem Stockwerk mit drei Zimmern und einem Bad, und darüber noch einem Spitzboden unter dem schrägen Dach, zu erreichen mit einer Ausziehtreppe. Ein Haus gebaut für Leute, die viel im Freien sind. Aufrecht in seinem roten Backstein, aber mager und schmal.
Bei uns fängt der Platz dahinter an. Bei der Scheune, dem Lager, dem Hof und den Ställen, dem Land dahinter, den endlosen, uferlosen Hektaren, einem Ozean aus Gras – der Domäne der Milchviehhaltung, unterteilt in geometrische Formen.
Unser Land sei grün, heißt es. Aus der Luft stimmt das auch. Oder aus einem Auto heraus von der Hauptstraße aus gesehen, das zwischen Dorf und Stadt pendelt. Aber wenn man in seinen Stiefeln dasteht, drängen sich einem vielmehr die mächtigen Wolkenhimmel auf, die groß und beweglich sind.
Aus der Luft würden wahrscheinlich auch die gewundenen Klinkerstraßen auffallen, die die Bauern kurvig mit den Bauern verbinden sowie die Bauern mit der Straße. Birken säumen sie, die Straßen ächzen unter der schweren Verkehrslast.
Ansonsten ist es eine männliche Landschaft, gerade und klar, eine Landschaft, die ihrer Entwurfszeichnung auch künftig immer ähneln wird.
Die ersten Jahre fiel es nicht so auf, dass Ada wenig Vergangenheit besaß. Es machte nichts. Ich selbst verfügte auch nicht über übertrieben viel Vergangenheit. Eine Kindheit zu Hause, eine abgebrochene Ausbildung, ein Leben auf dem Hof. Mit Interesse für die Geschicke anderer musste man geboren sein; sich das später anzueignen war schwer.
«Das heißt, sie hatte nie Geburtstag?», fragten die Ermittler. «Wollten Sie das sagen? Es kam nie jemand vorbei? Keine Anrufe, nichts?»
Der Ältere lehnte sich zurück, die Hände im Nacken, die Augen gegen die Decke gerichtet, wie man es sie auch im Fernsehen tun sah. «Und ab wann dämmerte Ihnen denn so allmählich, dass Ihre Beziehung nie Geburtstag hatte?»
Zu Anfang des Verhörs hatten sie sich bemüht, neutral zu klingen, möglichst neutral und objektiv, konnte man sagen. Später gaben sie diesen Anspruch auf.
«Ich weiß nicht, warum Menschen keine Vergangenheit haben wollen», sagte ich – oder etwas Derartiges, in Worten gleichen Inhalts. «Ich weiß nicht, warum sie damit nichts zu tun haben wollen. Kann doch sein, das bestimme ich doch nicht? Hätte sie mir davon erzählen wollen, dann hätte sie das sicher getan.»
Ich schaute sie an, einen nach dem anderen. Männer mit Arbeit, einem Beruf, einem Haus und Kindern. Männer, die ihre Attraktivität in den Arbeitsjahren zurücklassen mussten, die hinter ihnen lagen. «Man muss …», sagte ich. «Das heißt, man muss natürlich nichts, so meine ich es nicht. Aber man muss Leuten ein bisschen Raum geben; Zeit, Ruhe und Raum.»
«Wieso sind Sie nicht umgezogen?» Der Jüngere begann durchs Zimmer zu gehen, einen kahlen Raum, einen, so schien es, eilends für ein Verhör umfunktionierten Büroraum. «Wieso sind Sie nicht abgehauen? Erklären Sie das mal, das verstehe ich nämlich noch nicht ganz. Warum haben Sie nicht irgendwo anders neu angefangen?»
Ich dachte an die Frage, die alle immer stellten: «Was wärst du geworden, wenn du kein Bauer gewesen wärst?»
Ich dachte daran, dass der Bauer und sein Vieh zueinander verurteilt sind. Zueinander verdammt, könnte man sagen, aber dann versteht man nicht, was Liebe ist.
Ich hatte darauf keine Antwort. Ich konnte darauf nichts erwidern. Meine beste Antwort wäre gewesen, dass es diese Frage in Wirklichkeit nicht gab. Einer Kuh brauchte man nicht beibringen, Milch zu geben, einem Bauern nicht, Bauer zu sein. Sie wussten es schon, sie waren es schon, schon immer gewesen.
«Warum sind Sie nicht ausgewandert?» Er hatte aufgehört, herumzulaufen. «Kanada, Amerika, Neuseeland? Sie hatten so viel Zeit. Sie hatten so viel Vorsprung.»
In seiner Stimme steckte Verärgerung. Auf einmal hörte ich es. Müdigkeit. Als ob ihm erst jetzt bewusst würde, wie viel Zeit und Mühe es gekostet hatte, alle im weiten Umkreis zu durchleuchten, die seit dem Unglück mit Rosa einen Sprachkurs angefangen hatten.
Wir saßen, wir schwiegen.
So wurde während der Verhöre viel Zeit vertan.
Die meisten Dinge lassen sich gut erklären, besonders im Nachhinein ist das einfach. Aber es gibt auch Sachen, die besonders im Nachhinein sehr schwierig oder fast gar nicht zu erklären sind, obwohl sie einem in dem Moment selbst natürlich vorkamen.
Vater nannte Ada «das Gespenst», Mutter übernahm es. Wo ist das Gespenst? Hat das Gespenst das gemacht? Wie spät kommt das Gespenst nach unten, muss das Gespenst noch lange ausschlafen? Wenn das mal nicht wieder das Gespenst ist. Wenn das Gespenst das nicht mehr mag, dann esse ich es.
Ich fand es nicht schlimm, ein Verhältnis mit einem Gespenst zu haben. Ich merkte es nicht so, ich war tagsüber nie drinnen; Arbeit ist die beste Methode, um sich mit dem Tag zu verbinden, vielleicht auch mit sich selbst, Arbeit ist die beste Methode, um bei sich selbst zu bleiben.
Nachts erwachte das Gespenst zum Leben, im Schlafzimmer vollzog sich eine Verwandlung. Alles, was ich in all den Jahren von meinen Eltern durch die dünne Wand zwischen den Schlafzimmern hatte ertragen müssen, bekamen sie jetzt mitsamt Zinsen zurück.
Die Kraft eines Bauern kann man nicht sehen. Man muss sie spüren, erfahren, sonst glaubt man es nicht. Ada rühmte meine Kraft und Ausdauer, sie bewunderte die Form meiner Unterarme, Hände und Finger. Sie wusste, wo sie hinschauen musste.