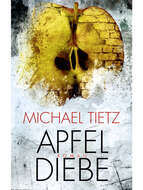Czytaj książkę: «Rattentanz»
Inhaltsverzeichnis
Rattentanz
Prolog
Erstes Buch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Zweites Buch
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
Drittes Buch
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Epilog
Nachwort
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung oder Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen, oder Video, auch einzelner Text-und Bildteile.
Alle Akteure dieses Romans sind fiktiv, Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig und sind vom Autor nicht beabsichtigt.
Copyright © 2009 by Bookspot Verlag GmbH
Satz/Layout: Peter Hänssler
Covergestaltung: Nele Schütz Design, München unter Verwendung eines Motivs von Shutterstock
Lektorat: Eva Weigl
eBook: Jara Dressler
ISBN 978-3-937357-44-7
www.bookspot.de
Michael Tietz
Rattentanz
Roman
BOOKSPOT VERLAG
Für
Tamara
und
Joscha
Denn der Tag des Herrn der Heere kommt,
über alles Stolze und Erhabene, über alles Hohe – es wird erniedrigt.
An jenem Tag nimmt jeder seine silbernen und goldenen Götzen,
die er gemacht hat, um sie anzubeten,
und wirft sie den Fledermäusen und Ratten hin.
Jesaja 2, 12 und 20
Prolog
»Bringt das Schwein endlich raus!«
»Er soll hängen!«
»Ja! Hängt ihn auf!«
Die Rufe vor dem Gasthaus wurden von Minute zu Minute lauter. Schon machten zwei Männer Anstalten, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Sie wollten gerade hinunter in den Gewölbekeller steigen und den Verurteilten seiner gerechten Strafe zuführen, als sich die schwere Holztür des Wirtshauses öffnete. Augenblicklich kehrte Stille ein.
Wie in der Nacht festgelegt, hatten sich fast alle Einwohner Wellendingens Punkt sechs am Abend hier versammelt, hier auf der kleinen Wiese, zwischen dem einzigen Gasthof des Dorfes und dem Ehrenbach. Nachdem sie ihn verurteilt hatten, wollten sie ihn nun auch hängen sehen. Einige Halbwüchsige standen auf Fahrzeugdächern und warteten auf das, was sie bisher nur aus Filmen kannten. Die Ziegen, denen die Wiese seit Kurzem gehörte, standen in ihrem Verschlag und beäugten das fremde Konstrukt: ein aus alten Balken zusammengezimmerter Galgen, der sich drei Meter hoch über ein mehr als mannshohes Podest erhob.
Zwei Männer führten den Gefangenen über die Straße. Die Frauen und Männer des Dorfes gaben eine schmale Gasse frei.
»Ich verfluche dich!« Eine alte Frau drängte nach vorn, versperrte den Männern den Weg und spuckte dem Verurteilten ins Gesicht. Aber der nahm den Speichel, der ihm über die Wange lief und dann vom Kinn auf seine zerfetzten Hosen tropfte, nicht mehr wahr. Es gabm Wichtigeres. Er suchte etwas, was nur er verstehen konnte.
Sie stießen ihn weiter. Am Fuß der Konstruktion wartete der Pfarrer. Er hielt dem Gefangenen eine in Leder gebundene Bibel entgegen.
»Bereust du deine Sünden?«
Der Gefangene sah dem Pfarrer einen Moment ins Gesicht, dann stieß er ihn zur Seite und ihm die Bibel aus der Hand. Er hatte es eilig, so eilig. Er stolperte die schmale Leiter hinauf und an den Rand des Podestes. Ohne Widerstand ließ er sich eine grobe Schlinge um den Hals legen. Die Sonne schien ihm ins Gesicht, ein Hahn krähte. Das Letzte, was er sah, war eine Amsel, die unter lautem Gezeter vom Dach des Gasthauses aufflog.
Dann stülpte der Henker ihm einen Sack über den Kopf.
Erstes Buch
– IST –
Das Wort »Ist« steht für:
− die konjugierte Form des Hilfsverbs »sein« in der dritten Person Singular
− den Ist-Wert im Vergleich zum Sollwert
− den Ist-Bestand oder das Haben im Vergleich zum Soll (Kaufmännisches Rechnungswesen)
− den Ist-Zustand als Ausgangspunkt eines Projektes
(Quelle: Wikipedia)
1
22. Mai, 01:53 Uhr, Wellendingen
Nur in Eva und Hans Segers Küche brannte noch Licht − das einzige in ganz Wellendingen. Der kleine Ort im Südschwarzwald schlief. Dass es die letzte Nacht der alten Zeitrechnung war, wusste keiner.
Eva Seger saß am Küchentisch, vor sich Brot, Butter, Wurst und Käse. Der riesige Holztisch war das Zentrum des Hauses. Auf der massiven Holzplatte sortierte sich der Tag der kleinen Familie. Hier wurde gegessen und gespielt. Hier erledigte Lea ihre Hausaufgaben, rollte Eva Teig aus, las Hans seine Zeitung. Hier schmiedeten sie Pläne.
Evas Haar war vom unterbrochenen Schlaf zerzaust und immer wieder schob sie mit dem Handrücken eine ihrer Locken aus dem Gesicht. Am anderen Ende der Küche wetteiferten die Kaffeemaschine und das Nachtprogramm des Radios. Eine abstoßend muntere Moderatorenstimme versuchte Heiterkeit zu verbreiten.
Die Tür zum Bad war nur angelehnt. Eva hörte den so vertrauten Ablauf: Hans putzte seine Zähne, duschte und rasierte sich. Als er sich zu ihr setzte, roch er nach Rasierwasser.
Eva sah auf die Uhr; noch fünfzehn Minuten, dann musste er los. Waren fünfzehn Minuten genug für das, was sie ihm endlich sagen musste? Natürlich nicht, dachte sie, legte den Stapel Brote übereinander und zerteilte ihn in der Mitte. Wenn sie jetzt von dem erzählte, was in ihr heranwuchs, konnte sie diesen Morgen vergessen. Ebenso diesen Tag und auch den nächsten und übernächsten. Sie musste bis zu Hans’ Rückkehr aus Schweden warten, dann aber musste es raus.
Hans Seger, eigentlich Johannes, verbrachte in unregelmäßigen Abständen drei,vier Tage im südschwedischen Malmö. Hans arbeitete für ein Importunternehmen und obwohl er Fisch und alles andere, was aus dem Meer kam, nicht ausstehen konnte – allein der Gedanke an Tintenfischringe verursachte ihm mit der Sicherheit von Ebbe und Flut einen fast unbezwingbaren Brechreiz – hatte er vor zehn Jahren den angebotenen Job angenommen. Abgesehen vom Fischgeruch bei seinen Einkaufstouren war er mit dieser Entscheidung mehr als gut gefahren. Fast zur gleichen Zeit hatte er damals Eva kennengelernt. Und sie hatten sich verliebt, obwohl sie verheiratet war und er selbst die eigene Hochzeit fest geplant hatte.
Eva legte die Brote in eine Dose. Wie immer schrieb sie einen kleinen Zettel. Wir warten auf dich, schrieb sie. Der Versuchung, Wir drei warten auf dich! zu schreiben und ihn so mit seiner von ihr gefürchteten ersten Reaktion im Flugzeug allein zu lassen, widerstand sie. Das wäre nicht fair, wusste sie. Egal wie oft er nun auch schon gesagt hatte, dass er seine Familie liebe und so, wie sie war, komplett fand, musste sie ihm selbst von ihrer Schwangerschaft erzählen. Vielleicht bei einem kleinen Glas Wein.
Hans war zufrieden mit seinem Leben und seiner Ehe. Er liebte es in dem Dorf zu leben, in dem er selbst aufgewachsen war. Wellendingen hatte kaum mehr als vierhundert Einwohner – einen Tick zu groß, um sich gegenseitig auf die Nerven zu gehen, aber klein genug, um jeden persönlich zu kennen und über ihn Bescheid zu wissen. Von hier aus war es nur ein Katzensprung in die nahe Schweiz. Die Straße von Bonndorf nach Stühlingen durchzog den Ort, Hügel umschlossen ihn und gaben Schutz vor Stürmen. Felder, Wiesen und dichte Wälder ernährten noch immer ein Gutteil der Menschen. Der Ehrenbach folgte als ungefährliches Rinnsal dem Verlauf der Straße und später einem engen, rasch die vierhundert Meter Höhenunterschied überwindenden Tal nach Südosten der Wutach und später dem Rhein zu.
Hans leerte seinen Kaffee und ging zu seiner Frau. Sie sah fantastisch aus! Der dünne Bademantel, vor allem aber der eng zusammengezogene Gürtel, zeigte mehr als er verbarg. Er legte seine Hände um Evas Hüften und küsste ihren Nacken. Sie roch nach Schlaf – die Gerüche ihres Tages, gepaart mit einer Prise Schweiß – und fühlte sich warm und weich an. Hans liebte diese Momente zwischen Nacht und Tag, in denen seine Frau so zerbrechlich und schutzbedürftig in seinen Armen lag.
Sie schmiegte sich an ihn und legte seine Hand auf ihren Unterleib. Natürlich konnte er noch nichts spüren, sie war erst im dritten Monat. Aber es wäre schön, wenn er Bescheid wüsste.
»Liebst du mich?«, fragte sie und schmiegte sich an ihn. Hans lachte. »Du wirst dich nie ändern, oder? Natürlich liebe ich dich, das weißt du doch.«
»Ich höre es eben gern«, sagte Eva und spielte die Verlegene.
»Ich liebe dich. Und du bist die beste Ehefrau und Mutter und die weltbeste Köchin und Liebhaberin. Zufrieden?«
Eva zögerte und schien, während sie die Dose mit Hans’ Broten verschloss, nachzudenken. »Na ja, zufrieden ist was anderes, aber es wird bis übermorgen reichen. Und wenn nicht, ruf ich dich einfach an.«
Sie küssten sich.
»Jetzt muss ich aber.« Nur widerwillig gab Eva ihn frei.
»Hast du deine Krawatte?«
»In meiner Tasche.«
»Deinen Ausweis?«
»Jawoll!«
»Geldbeutel?«
»Ja.«
»Mich lieb?«
»Hab ich.«
Konnte man nach zehn Jahren noch solche Sehnsucht nach einander haben? Eva sah Hans zu, wie er in seine Schuhe schlüpfte und sein Sakko nahm. Er fehlte ihr jetzt schon.
»Hier, dein Flugticket.« Sie lehnte im Türrahmen und hielt ihm das Ticket hin.
Sie war etwas über einssiebzig und hatte schulterlange, braune Locken. Wäre ihre markante Nase, die etwas Indianisches versprach und sie immer weniger störte, nicht einen Tick zu groß gewesen, hätte man sie durchaus als ganz hübsch bezeichnen können; vielleicht ein Gesicht, das zu sehen man sich freut, es aber nach wenigen Sekunden, seiner Banalität und Austauschbarkeit wegen, schon wieder vergessen hat. So aber war sie schön. Und zwar von der Art Schönheit, die keinen Betrachter unberührt lässt. Ihre Nase war dabei der eigentlich störende Telegrafenmast in einer ansonsten perfekt abgestimmten Landschaft: er unterstrich Ebenmaß und Schönheit des Bildes, so wie Evas Schönheit erst durch den vermeintlichen Makel entstand.
»Ist alles in Ordnung mit dir?«, fragte Hans.
»Natürlich. Wieso fragst du?«
»Weiß nicht. Du wirkst als bedrücke dich irgendwas.«
»Ich bin nur müde, vielleicht deswegen.«
Hans ging nach oben zu Lea. Die Siebenjährige schlief tief. Er deckte sie zu und drückte ihr einen vorsichtigen Kuss auf die Stirn.
»Ruf mich im Krankenhaus an, wenn du angekommen bist«, sagte Eva, als er wieder bei ihr war. »Ich habe heute und morgen Frühdienst.«
»Mach ich«, sagte Hans. »Lea ist dann nebenan?«
Eva nickte. »Ich bring sie kurz vor sechs zu Susanne.«
Susanne Faust lebte im Nachbarhaus. Immer wenn Hans kurzfristig nach Schweden musste und Eva, die im zweiunddreißig Kilometer entfernten Donaueschinger Krankenhaus als Schwester auf der Intensivstation Frühdienst hatte, kümmerte sich Susanne um Lea. Ihr Mann, Frieder Faust, war wie ein Onkel und Susannes und Frieders Sohn, Bubi, wie ein großer Bruder.
Obwohl Eva wusste, dass Hans alle wichtigen Telefonnummern in seinem Handy abgespeichert hatte, fragte sie ihn auch heute wieder danach. Mit einem Lächeln hielt er ihr sein Handy hin.
»Bis übermorgen«, sagte Hans, nahm seinen Autoschlüssel und öffnete die Tür. »Ich liebe dich.« Alles war wie immer, wenn Hans mitten in der Nacht nach Schweden aufbrach. Wer rechnet schon wirklich damit, dass man sich vielleicht nie wiedersieht?
»Pass auf dich auf«, sagte Eva.
Eva fühlte sich todmüde, konnte aber lange nicht einschlafen. Sie streichelte ihren Bauch und dachte an das Kind, welches in ihr heranwuchs. Hätte sie in diesem Moment gewusst, was auf sie zukommt, hätte sie dieses Kind ohne Zögern hergegeben. Aber wie auch der Rest der Welt ahnte sie nichts von der bevorstehenden Katastrophe. Hans, wusste Eva, wird sich über das Kind freuen. Vielleicht nicht sofort, aber bald. Sie hatten sich zwei oder drei Kinder gewünscht, als dann aber Lea da war und es danach, obwohl sie auf Pille, Kondome und alle anderen Mittelchen verzichteten, zu keiner weiteren Schwangerschaft kam, arrangierten sich mit ihrer Einkindehe. Hans deutlich besser als Eva. Und in letzter Zeit hatte er mehr als einmal gesagt, dass er froh sei, dass Lea schon so groß ist. Hans war achtunddreißig, Eva vier Jahre jünger, und die Vorstellung, mit fünfzig vielleicht noch einen pubertierenden Halbwüchsigen am Tisch sitzen zu haben, gefiel ihm überhaupt nicht.
Aber er wird das Kind lieben, so wie er Lea liebt und vergöttert. Er wird sich zusammen mit Eva freuen – nach dem ersten Schock.
2
23. Mai, 06:58 Uhr, Wellendingen
Der nächste Morgen. Ein Mittwoch. Als das Telefon klingelte, saß Lea zusammen mit Susanne und Frieder Faust in deren Küche beim Frühstück.
»Das ist Papa!«, rief Lea und sprang auf. »Darf ich rangehen?«
Frieder Faust sah kurz von seiner Zeitung auf und nickte. Lea rannte mit wehenden Locken in den Flur zum Telefon und schlug die Küchentür mit einem lauten Knall hinter sich zu. Tassen und Gläser im danebenstehenden Schrank zitterten, klirrten, wie ein Windspiel an einem warmen Sommerabend.
»Lea!«
»Tschuldigung!«, rief sie halbherzig, dann nahm sie den Hörer. »Papa?«, fragte sie in den Apparat, während ein abgehackter Piepton aus dem Radio die verstreichenden Sekunden bis zur vollen Stunde zählte. »Gestern haben wir Deutsch zurückbekommen und ich hatte alles richtig und Lars der Blödmann hat einen Frosch in meinem Ranzen versteckt und der ist dann durch unsere Küche gesprungen und Mama hatte mehr Angst vor ihm als ich und ich habe ihn in ein Glas gesteckt und jetzt steht er in meinem Zimmer und bringst du mir wieder Muscheln mit?« Lea plapperte ohne Punkt und Komma.
Mit dem letzten Ton des Zeitzeichens schaltete eine unsichtbare Hand am Morgen dieses 23. Mai das Radio ab.
»Papa? Papa?« Lea kam in die Küche. Fragend hielt sie Susanne das Telefon hin. Aus dem Hörer sickerte absolute Stille. Kein Besetztzeichen, kein Rauschen, einfach nur: nichts.
»Hast du auf eine Taste gedrückt?«, fragte Susanne. Lea schüttelte den Kopf. Ihre Augen funkelten. Als ob sie nicht wüsste, wie man mit einem Telefon umgeht!
»Dein Papa ruft bestimmt noch mal an.« Susanne Faust nahm Lea das Telefon aus der Hand und brachte es zurück an seinen Platz. Frieder bestand auf Ordnung und ein Telefon auf dem Küchentisch bedeutete Unordnung.
»Mach das Radio wieder an, wenn du schon stehst.« Frieder Faust kaute an einem Wurstbrot und studierte den Sportteil. Faust war mittelgroß, ein Zimmermann mit Stiernacken und riesigen behaarten Händen. »Hast du nicht gehört? Mach das Radio wieder an!« Er sah kurz von seiner Lektüre auf. Wenn er etwas nicht ausstehen konnte, dann waren es zwei Dinge (neben seiner Frau, was die Zahl der unausstehlichen Dinge auf drei erhöhte): etwas zweimal sagen zu müssen und auch nur einen Moment ohne die beruhigende Berieselung durch ein Radio. So, wie dieser Tag begann, konnte er sicher sein, dass es ein mieser Tag werden musste.
Sein Blick folgte Susanne, die, wie Frieder Mitte vierzig, ihre Blütezeit bereits weit hinter sich gelassen hatte. Wenn es denn in ihrem Leben jemals so etwas wie eine Blüte gegeben hatte. Sie ging leicht vornübergebeugt und die dünnen, fahlen Haare bildeten keinen besonders vorteilhaften Rahmen für ihr unauffälliges Gesicht. Unauffälligkeit schien überhaupt die Maxime ihres Lebens zu sein. Schon immer versuchte sie in dem, was sie sagte, tat, anzog oder wie sie sich zurechtmachte, so unauffällig wie möglich zu bleiben. Und jahrelange Übung − oder einfach nur Talent − hatte dazu geführt, dass sie in ihrer Umgebung kaum noch von jemandem wahrgenommen wurde. Manchmal fragte sie sich, wann, sollte es sie einmal nicht mehr geben, ihr Fehlen auffiele. Und wem.
Lea beeilte sich und kratzte mit ihrem Stuhl über den Steinboden, um vor Susanne am Radio zu sein. Das dabei entstehende krächzendquietschende Geräusch machte Fausts missratenen Start in diesen neuen Tag perfekt. Von den Zehen bis zu der Stelle, wo vor einigen Jahren noch ein Scheitel gesessen hatte, breitete sich unangenehm Gänsehaut aus. Faust fröstelte.
»Wo steckt Bubi eigentlich? Wollte er heute nicht zu einem Bewerbungsgespräch?«
Bubi, eigentlich Volker, war Fausts zweiundzwanzigjähriger Sohn. Ein Nichtsnutz, wenn er ehrlich war − aber offen zugeben würde er das nie. Frieder war immer stolz darauf, dass sein Spross Manieren besaß, dass Bubi wusste, was richtig und was falsch war. Vielleicht hatte er es auch zu gut mit ihm gemeint und den einen oder anderen Wunsch zu schnell erfüllt. Früher hatte Bubi seinem Vater oft am Wochenende geholfen, wenn der in Schwarzarbeit einen Dachstuhl hochzog, aber diese Zeiten waren nun schon einige Jahre vorbei. Jetzt konzentrierte sich Bubi aufs Fernsehen.
So stolz Frieder Faust früher auf sein einziges Kind war, so sehr war es ihm heute ein Dorn im Auge. Nicht, dass er Bubi nicht mehr liebte, im Gegenteil. Aber Leben und Äußeres des Bengels widersprachen in allem den Ansichten des Vaters und führten permanent zu Spannungen und Streit. Während Faust als eines von drei Kindern in Armut aufgewachsen war und sich Auto, Haus und die regelmäßigen Urlaube mit harter Arbeit und eiserner Disziplin erkämpft hatte, verfiel sein Sohn in Lethargie und Faulheit und lebte vom Geld seines Vaters. Dieser wiederum brachte es einfach nicht fertig, seinen Drohungen Taten folgen zu lassen und Bubi endlich aus dem Haus zu werfen. Was Bubi natürlich wusste und ihn die regelmäßigen Zornesausbrüche seines Vaters geduldig ertragen ließ.
Bubis Mutter, Susanne Faust, war mit ihren fünfundvierzig Jahren bereits eine alte Frau und seit einem Vierteljahrhundert an der Seite ihres Mannes. Meist war es die Rückseite, die sie zu sehen bekam. Frieder ertrug weder Widerspruch noch Diskussionen und seine Entscheidungen traf er einsam und für alle bindend, wenn man von Bubi absah. Schließlich war er es, der das Geld verdiente. Susanne hatte sich mit dieser Ehe arrangiert und eigene Gedanken und Entscheidungen konsequent verlernt. Von Haus aus eher bescheidenen Geistes, wusste sie um ihre intellektuellen und äußerlichen Defizite und hatte diese akzeptiert. Frieder gab ihr die Sicherheit, die sie vor ihm nie gehabt hatte. Als Kind, als Mädchen und erst recht als junge Frau fühlte sie sich stets überfordert, egal ob in der Schule, die sie mit Mühe nach acht Jahren beendete, oder im Umgang mit anderen Menschen. Sie war fleißig und konnte arbeiten wie keine Zweite, was ihr Mann schnell und richtig erkannt hatte. Aber man musste ihr immer wieder sagen, was, wann und in welcher Reihenfolge zu erledigen war. Selbst im Bett. Aber das teilten sie nicht mehr miteinander, seit sich im Sommer Faust und die Frau eines seiner Bauherren etwas zu nahe gekommen waren. Dieser hatte es schnell herausgefunden und dass eine kleine Platzwunde auf Fausts Stirn von einem Arbeitsunfall herrühre, klang im Dorf nun einmal besser als die Wahrheit: der Schlag eines gehörnten Ehemanns. Seit diesem Erlebnis mied Frieder Faust seine Frau und die wiederum vermisste nichts.
»Ich glaube, der Strom ist weg.« Susanne kippte schon zum siebten oder achten Mal den kleinen Schalter am Radio hin und her und immer mit dem gleichen Erfolg – das Gerät blieb stumm.
Faust äffte sie nach: »Ich glaube, ich glaube … Probier halt mal, ob das Licht noch funktioniert.«
Susanne durchquerte die Küche. Leas Augen folgten ihr, während sie ihr Müsli in sich hineinschaufelte und darauf wartete, dass das Telefon erneut klingelte. Susanne betätigte den Lichtschalter in derselben Weise wie vorher das Radio. An, aus, an, aus, an, wobei ihr starrer Blick die Lampe fixierte.
»Ist gut! Lass den Schalter ganz und bring mir noch Kaffee.« Susanne gehorchte und Faust beschäftigte sich weiter mit seiner Zeitung. Dann stand er plötzlich auf und ging in den Flur.
An der Wand über dem Telefon, das auf einem kleinen Schrank stand, hing eine saubere Liste mit allen wichtigen Telefonnummern: Feuerwehr, verschiedene Ärzte, Wasserwerk und der hiesige Stromversorger. Faust nahm den Apparat, ohne noch an Leas eben unterbrochenes Gespräch zu denken und wählte die Nummer des Stromversorgers, wobei seine dicken Finger Mühe hatten, die jeweilige kleine Taste sauber zu treffen.
»Das funktioniert doch auch mit Strom.« Susannes tonlose Stimme folgte ihm in den Flur.
»Scheiße, ja!« Er warf den Hörer auf den kleinen Schrank. Das weiße Spitzendeckchen darunter verrutschte. Susanne strich es glatt, bevor ihr Mann es bemerkte. Die Stille aus dem Telefon machte ihm Angst.
»Wo ist mein Handy?«
»Im Wagen?«
Hinter dem Haus stand zwischen zwei geräumigen Schuppen, die Faust als Lager und Werkstatt dienten, sein Pick-up, auf der Ladefläche Werkzeug, Bretter, Helm und Zimmermannsgürtel. Faust schloss den Wagen auf und suchte im Handschuhfach nach seinem Handy.
»Hörst du das?« Susanne war ihm zum Wagen gefolgt, stand nun hinter ihm und sah zum Himmel.
»Nein. Ich hör nichts.« Als er aber mit dem Handy in der Hand aus dem Wagen kam, hörte er es auch. Ein tiefes, flatterndes Brummen. Das Geräusch kam nicht von einem Motor. Etwas Ähnliches hatte er einmal auf einem Segelflugplatz gehört, als ein Segler nur wenige Meter entfernt zur Landung ansetzte und im Vorbeiflug einen fast körperlichen Ton hinterließ. Aber dieser Laut jetzt war voller, er war bedrohlich und schwoll in Sekundenschnelle zu einem Fauchen, einem dumpfen Vibrieren an. Unvermittelt prallte eine unsichtbare Wand gegen das Dorf, der Luftdruck stieg und die eben noch singenden Vögel verstummten. Eine Katze verkroch sich unter einem Holzstoß und die Hunde unten im Dorf suchten mit eingezogenem Schwanz und angelegten Ohren Schutz. Schatten flossen über die Dächer Wellendingens und als Frieder und Susanne die Köpfe hoben, sahen sie nur etwa siebzig, achtzig Meter über sich den silbern schimmernden Leib einer Boeing 767. Mit offensichtlich abgeschalteten Triebwerken segelte der mächtige Koloss von Norden kommend über das Dorf. An Bord befanden sich zweihundertvier Passagiere. Der gewaltige Schatten huschte über die Dächer, schien an der Kirche kurz zu zögern und kletterte schließlich den Hang nach Süden hinauf. Dabei verringerte sich der Abstand zwischen dem eisernen Vogel und den vielen Löwenzahnwiesen immer mehr, die Maschine verlor konstant an Höhe und das Gelände schien nach der Boeing zu greifen. Als sie schließlich den höchsten Punkt des kleinen Talkessels, in dem Wellendingen lag, erreichte, passte kaum mehr ein Einfamilienhaus zwischen Wiese und Bauch der Maschine. Sie verschwand und mit ihr das Geräusch, mit dem sie die Luft zerschnitten hatte, gefolgt von einem breiten Schatten.
»Scheiße! Susanne, was war das?!«
Susanne stand kreidebleich und mit offenem Mund hinter ihrem Mann und starrte nach Süden, wo die Maschine lautlos wie ein Gespenst verschwunden war.
»Onkel Frieder? Was war das?« Lea stand an der Tür. Sie blickte zum Himmel und der Löffel in ihrer kleinen Hand zitterte.
»Wir müssen …« Was auch immer Frieder Faust sagen wollte, es blieb ungesagt. Die drei starrten auf die im Süden emporsteigende Rauchsäule. Sekunden später lag zuerst Rumoren, dann der Donner einer Explosion in der Luft.
Frieder wählte den Notruf der Polizei, ohne den schwärzer werdenden Rauch aus den Augen zu lassen. Der stieg in den klaren Maimorgen auf und es dauerte lange, bis er mit den wenigen Schön wetterwolken eine ungeliebte Liaison einging. Eine erste Amsel begann wieder zu zwitschern und im Dorf kläffte ein Hund dem Ungeheuer hinterher.
»Ich hab Angst.« Über Leas Wangen kullerten dicke Tränen. »Ich will zu meiner Mama.« Susanne nahm sie in den Arm.
»Tot.« Faust klappte das Handy zusammen und steckte es in die Hosentasche. »Nichts. Nicht einmal ein Freizeichen.«