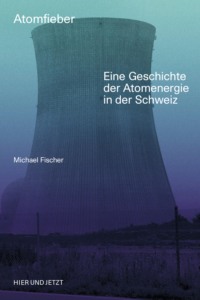Czytaj książkę: «Atomfieber»
Atomfieber
Der Verlag Hier und Jetzt wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2016–2020 unterstützt.
Mit weiteren Beiträgen haben das Buchprojekt unterstützt:

Dieses Buch ist nach den aktuellen Rechtschreibregeln verfasst. Quellenzitate werden jedoch in originaler Schreibweise wiedergegeben. Hinzufügungen sind in [eckigen Klammern] eingeschlossen, Auslassungen mit […] gekennzeichnet.
Umschlagbild: Kühlturm des AKW Leibstadt, 1984. Fotografie von Gertrud Vogler.
Lektorat: Rachel Camina, Hier und Jetzt
Gestaltung und Satz: Simone Farner, Naima Schalcher, Zürich
Bildbearbeitung: Benjamin Roffler, Hier und Jetzt
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Ulm
2. überarbeitete und ergänzte Auflage 2019
ISBN Druckausgabe 978-3-03919-472-8
ISBN E-Book 978-3-03919-952-5
E-Book-Herstellung und Auslieferung:
Brockhaus Commission, Kornwestheim
© 2019 Hier und Jetzt, Verlag für Kultur und Geschichte
GmbH, Baden, Schweiz
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
«Mit Atombomben bis nach Moskau fliegen!» Das Atomwaffenprogramm der Schweizer Armee 1945–1988
Der Traum vom eigenen Reaktor Die Schweizer Atomindustrie 1955–1969
Widerstand gegen Atomkraft Die Anti-AKW-Bewegung ab Anfang der 1970er-Jahre
Tschernobyl 1986 Die Katastrophe und ihre Folgen
Fukushima 2011 Der Ausstieg aus der Atomenergie
Strahlendes Erbe Die Entsorgung der radioaktiven Abfälle
Ausblick
Bilddokumente 1945–2017
Chronologie 1938–2018
Anhang
Einleitung
Kaum ein Thema hat die Schweiz während der letzten Jahrzehnte so bewegt, so tief gespalten und so viele emotionale Debatten ausgelöst wie die Atomenergie. Dem unerschütterlichen Glauben an Technologie und wirtschaftlichen Fortschritt standen zuerst pazifistische, dann regionalpolitische und schliesslich ökologische Bewegungen entgegen. Die anfängliche Euphorie, mit der das Atomzeitalter nach 1945 in der Schweiz begonnen hatte, ist nach vielen politischen Kämpfen und den Katastrophen in Tschernobyl und Fukushima einem politischen Pragmatismus gewichen. Nach dem Super-GAU in Fukushima beschloss der Bundesrat 2011 den schrittweisen Ausstieg aus der Atomenergie und leitete damit einen historischen Wendepunkt in der Schweizer Energiepolitik ein.
Die Atompolitik der Schweiz war in den ersten Jahrzehnten geprägt vom Kalten Krieg. Die Angst vor einem atomaren Angriff der Sowjetunion war der Auslöser des Schweizer Atombombenprogramms, das unmittelbar nach dem Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki 1945 seinen Anfang nahm und erst kurz vor dem Ende des Kalten Kriegs 1988 beendet wurde. In den 1950er-Jahren schossen die Atompilze nicht nur auf den atomaren Testgeländen in Ost und West in den Himmel, sondern auch in den Köpfen der Schweizer Armeeführung. Einige hochrangige Armeeangehörige waren davon überzeugt, dass sie ihr geliebtes Vaterland nur mit diesen verheerenden Waffen würden verteidigen können. Der Rüstungswettlauf in Ost und West und das durch den grassierenden Antikommunismus geschürte politische Klima der ständigen Angst vor einer sowjetischen Invasion begünstigten die massive staatliche Subventionierung der Atomindustrie.
Die Schweiz als eine «Insel der Seligen», wo die Demokratie und der Wohlstand blühen wie an keinem anderen Ort der Welt, diese idealisierte Vorstellung verdeckt den Blick darauf, dass die Schweiz ebenfalls einige dunkle Kapitel in ihrer Vergangenheit hat, die bis heute weitgehend im Verborgenen liegen. Die Atompolitik ist ein Beispiel dafür. Politische Interessen, militärisches Machtgebaren und die Nutzbarmachung technologischer Entwicklungen brachten während des Kalten Kriegs auch in der Schweiz die Atomindustrie hervor. Sie löste sich erst allmählich aus ihrer ursprünglichen Abhängigkeit von militärischen Interessen. Die enge Verflechtung von Staat, Wissenschaft und Industrie blieb jedoch weiter bestehen und entfaltete ihre Wirkung oft unbemerkt von der Öffentlichkeit.
Die Schweiz ist seit längerer Zeit von Kriegen und Katastrophen verschont geblieben. Auch in der Atomindustrie sind grössere «Zwischenfälle» bisher ausgeblieben, wenn auch die Schweiz bei der Kernschmelze in Lucens 1969 nur haarscharf an einer atomaren Katastrophe vorbeischrammte. Der Mythos, dass in der Schweiz alles viel sicherer und zuverlässiger abläuft als anderswo, ist bis heute intakt. Ab Mitte der 1970er-Jahre wurde die Atomenergie zu einem Spaltpilz, der einen tiefen Riss durch die Gesellschaft zog. Befürworter und Gegner bekämpften sich in den folgenden Jahrzehnten in zahlreichen politischen Schlachten. Die Besetzung von Kaiseraugst wurde 1975 für die Anti-AKW-Bewegung zum Symbol des Widerstands, für die Atomindustrie hingegen zum Stolperstein, der den weiteren Ausbau ihres AKW-Parks verhinderte.
Die Kühltürme der AKWs, die mit ihrer massiven Architektur wie monumentale Kathedralen des technischen Fortschritts in die Landschaft hineinragen, wurden nun zu Mahnmalen für das gefährliche und unberechenbare Zerstörungspotenzial der Atomtechnologie, das vom Menschen offenbar niemals vollständig kontrolliert werden kann. Der Super-GAU in Tschernobyl 1986 rüttelte die Bevölkerung in der Schweiz auf, denn die radioaktive Wolke verbreitete auch hier Angst und Schrecken. Die Katastrophe wurde jedoch bald wieder vergessen. Die Halbwertszeit eines Super-GAUs im kollektiven Gedächtnis der Menschheit dauert weit weniger lang als diejenige der radioaktiven Strahlung, die durch eine Reaktorkatastrophe freigesetzt wird.
Mit dem Super-GAU in Fukushima ereignete sich das Undenkbare 2011 zwar ein weiteres Mal, doch die Reaktionen der Empörung und des Vergessens, die offenbar zu einem Muster im Umgang mit Katastrophen geworden sind, begannen sich erneut zu wiederholen. So schnell, wie die Katastrophe da war, so schnell war sie auch wieder aus dem Bewusstsein verschwunden. Der «Fukushima-Effekt» verpuffte innerhalb weniger Jahre. Der Entscheid des Bundesrates, langfristig aus der Atomenergie auszusteigen, bedeutete allerdings eine historische Weichenstellung in der Energiepolitik. Nach den beiden Abstimmungen zur Atomausstiegsinitiative 2016 und zur neuen Energiestrategie 2017 ist es um das Thema wieder seltsam ruhig geworden. Es stellt sich daher unweigerlich die Frage, wie nachhaltig dieser politische Entscheid tatsächlich gewesen ist.
Die politische Sprengkraft der Atomenergie weckte mein Bedürfnis, historisch etwas tiefer zu bohren und gegen das allgemeine Vergessen anzuschreiben. Dieses Buch bietet erstmals einen umfassenden Überblick über die hoch spannende und wechselvolle Geschichte der Atomenergie in der Schweiz, von der ersten Atombombe bis zum Super-GAU in Fukushima und bis zur darauf folgenden politischen Debatte zum Atomausstieg. Bei meinen Recherchen konnte ich auf die Forschungen und Publikationen zahlreicher Historikerinnen und Historiker, Journalistinnen und Journalisten zurückgreifen, von denen ich zumindest einige namentlich erwähnen möchte: Thomas Angeli, Martin Arnold, Jost Auf der Maur, Silvia Berger Ziauddin, Susan Boos, Peter Braun, Thomas Buomberger, Marcos Buser, Dölf Duttweiler, Urs Fitze, Stefan Füglister, Monika Gisler, Bernd Greiner, Fredy Gsteiger, Stefan Häne, David Häni, Edgar Hagen, Urs Hochstrasser, Peter Hug, Peter Jaeggi, Patrick Kupper, Benedikt Loderer, Otto Lüscher, Sibylle Marti, Alexander Mazzara, Dominique Benjamin Metzler, Felix Münger, Roland Naegelin, Bruno Pellaud, Jean-Michel Pictet, Paul Ribaux, Roman Schürmann, Damir Skenderovic, Helmut Stalder, Helen Stehli Pfister, Bernd Stöver, Jürg Stüssi-Lauterburg, Jakob Tanner, Simon Thönen, Marc Tribelhorn, Tobias Wildi, Reto Wollenmann und Hansjürg Zumstein.
«Mit Atombomben bis nach Moskau fliegen!»
Das Atomwaffenprogramm der Schweizer Armee 1945–1988
Nach dem Abwurf der Atombomben in Hiroshima und Nagasaki träumten führende Köpfe des Schweizer Militärs davon, die Armee mit Atomwaffen auszurüsten. Pazifisten protestierten gegen den atomaren Wahnsinn, doch das Schweizer Stimmvolk lehnte 1962 – mitten im Kalten Krieg – ein Verbot von Atomwaffen ab. Die sogenannte Mirage-Affäre von 1964 stutzte den hochfliegenden Plänen für eine Schweizer Atombombe erstmals die Flügel. Auf Druck der beiden Supermächte musste die Schweiz 1969 den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnen. Das geheime Atomwaffenprogramm wurde dennoch weitergeführt und erst 1988 endgültig beendet.
Der englische Schriftsteller H. G. Wells hat in seinem Science-Fiction-Roman The World Set Free («Befreite Welt») bereits 1914 die Erfindung der Atombombe vorweggenommen. Drei Jahrzehnte bevor seine düstere Vision Realität wurde, prägte er den Begriff der «Atombombe». Im Roman lässt Wells den Physikprofessor Rufus das Bild von der durch die Atomenergie beglückten Menschheit zeichnen, das teilweise bis heute nachwirkt:1 «Ich habe nicht die Rednergabe, meine Damen und Herren, um der Vision des zukünftigen Wohlstandes der Menschheit Ausdruck zu verleihen. Ich sehe, wie die Wüsten fruchtbar werden, wie das Eis der Pole schwindet, wie sich die Macht des Menschen bis zu den Sternen erstreckt.»2 Im Roman bricht im Jahr 1958 ein weltweiter Atomkrieg («The Last War») aus, der die Menschheit fast vollständig zerstört. Wells sah bereits 1914 die Bedrohung der Menschheit durch einen apokalyptischen Atomkrieg voraus, ohne jedoch das ganze Ausmass der nuklearen Zerstörung und die Folgen einer radioaktiven Verstrahlung zu erahnen. Die Hoffnung, dass die Atomkraft die Welt von Elend, Armut und Gewalt befreien könnte, erweist sich im Roman als eine trügerische Illusion. Aus der Einsicht, dass ein Krieg im Atomzeitalter zur Selbstvernichtung der Menschheit führen muss, leitet er die Notwendigkeit ab, den Krieg durch andere Formen der Konfliktlösung zu ersetzen. Nach dem Krieg tritt daher im schweizerischen Brissago am Lago Maggiore ein globaler Friedenskongress zusammen, an dem die neue Weltregierung als erstes Dekret ein internationales Verbot atomarer Waffen erlässt.3
Die Erfindung der Bombe
Seit den 1890er-Jahren erforschten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie Wilhelm Röntgen, Henri Becquerel, Marie und Pierre Curie sowie Ernest Rutherford die Strahlenaktivität von Stoffen, die Radioaktivität. Am 17. Dezember 1938 entdeckte dann der deutsche Chemiker Otto Hahn – nach Vorarbeiten mit Lise Meitner – in Zusammenarbeit mit seinem Assistenten Fritz Strassmann am Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie in Berlin, dass sich Urankerne unter Neutronenbestrahlung spalten lassen. Am 11. Februar 1939 veröffentlichten Lise Meitner und Otto Frisch in der Zeitschrift Nature erstmals ihre kernphysikalische Deutung der Resultate. Die Kernspaltung wurde zu einer der folgenreichsten Entdeckungen der Physik des 20. Jahrhunderts, die eine neue Energiequelle bisher unbekannten Ausmasses erschloss.
Seit dem Frühjahr 1939 war den Physikern die Möglichkeit einer technischen Nutzung der Kernspaltung als Energiequelle oder auch als Waffe bekannt. Im September 1939, unmittelbar nach Beginn des Zweiten Weltkriegs, wurden Deutschlands führende Atomphysiker, so Werner Heisenberg und Carl Friedrich von Weizsäcker, nach Berlin in das Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik zitiert, um für das nationalsozialistische Regime eine Atombombe zu bauen. Damit wurde die Gefahr real, dass die Nationalsozialisten in Deutschland während des Kriegs in den Besitz der zerstörerischen Waffe gelangen könnten.4 In einem vom ungarisch-deutschen Physiker Leó Szilárd verfassten Brief warnte Albert Einstein den US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt bereits am 2. August 1939 davor, dass eine «Bombe neuen Typs» in die Hände Adolf Hitlers gelangen könnte, und gab damit den Anstoss zum Bau der ersten amerikanischen Atombombe.
Nachdem Werner Heisenberg dem dänischen Physiker Niels Bohr im September 1941 in Kopenhagen in einem Gespräch sagte, er habe erkannt, wie eine Atombombe gebaut werden könne, gab US-Präsident Franklin D. Roosevelt am 6. Dezember 1941 den Befehl, alles zu tun, um eine solche zu entwickeln – der Wettlauf begann. 1942 startete unter der Leitung von General Leslie R. Groves und J. Robert Oppenheimer, dem amerikanischen Physiker deutsch-jüdischer Abstammung, das «Manhattan-Projekt» in Los Alamos, New Mexico. Angetrieben von der Angst vor einer deutschen Atombombe arbeiteten bis Ende 1945 mehr als 150 000 Menschen unter Hochdruck und unter grösster Geheimhaltung an diesem militärischen Grossprojekt der Konstruktion der ersten amerikanischen Atombombe. Am 2. Dezember 1942 gelang dem italienischen Physiker Enrico Fermi an der Universität Chicago erstmals eine nukleare Kettenreaktion. Die Alliierten versetzten dem deutschen «Uranprojekt» einen schweren Schlag, als sie am 27. Februar 1943 die norwegische Produktionsanlage Norsk Hydro für schweres Wasser durch Sabotage zerstörten.
Während des Zweiten Weltkriegs lieferte der Schweizer Physiker Paul Scherrer, der Leiter des Physikalischen Instituts der ETH Zürich, aufgrund seiner engen Kontakte zu Werner Heisenberg Informationen zum Stand der Entwicklung der Atombombe in Nazideutschland an den damals in Bern stationierten Allan W. Dulles vom US-Geheimdienst Office of Strategic Services (OSS). Am 18. Dezember 1944 hielt Werner Heisenberg, der seit 1942 das Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik in Berlin-Dahlem leitete, auf Einladung Paul Scherrers eine Vorlesung an der ETH Zürich. Der US-Geheimdienst schickte daraufhin einen Spion, den früheren Baseballspieler Moe Berg, nach Zürich, um den Stand des deutschen Atomprogramms in Erfahrung zu bringen. Moe Berg hatte die klare Anweisung, Werner Heisenberg auf der Stelle zu erschiessen, sollte er zum Schluss kommen, die Deutschen stünden kurz vor dem Bau der Bombe.5
Adolf Hitler schwadronierte im letzten Kriegsjahr immer wieder von «Wunderwaffen», streng geheimen Waffen mit enormer Wirkung, mit denen er die sich abzeichnende Niederlage doch noch abwenden wollte. Nachdem die alliierten Truppen im März 1945 in Deutschland einmarschiert waren, wurden die am «Uranprojekt» beteiligten deutschen Atomphysiker Ende April, Anfang Mai 1945 im Rahmen der Alsos-Mission des US-Geheimdiensts verhaftet, zunächst nach Frankreich gebracht und dann auf dem englischen Landsitz Farm Hall nahe Cambridge verhört. Die abgehörten Gespräche der deutschen Atomphysiker machten deutlich, dass diese entgegen allen Befürchtungen bis zum Ende des Kriegs nicht in der Lage gewesen waren, eine einsatzfähige Atombombe zu bauen. Der Forschungsreaktor des «Uranprojekts» im schwäbischen Haigerloch wurde zwar Ende Februar 1945 in Betrieb genommen, eine nukleare Kettenreaktion konnte aber vor Ende des Kriegs nicht mehr herbeigeführt werden. Allerdings soll am 3. März 1945 unter der Leitung von SS-General und Geheimwaffenchef Hans Kammler im Konzentrationslager Ohrdruf in Thüringen ein letzter verzweifelter Test mit einer sogenannt schmutzigen Bombe stattgefunden haben, bei dem es grosse Zerstörungen und Hunderte von Toten unter den KZ-Häftlingen gab und durch die Explosion von konventionellem Sprengstoff Radioaktivität in der Umgebung freigesetzt wurde.6
Hiroshima und Nagasaki
Die erste amerikanische Atombombe wurde am 16. Juli 1945 im Rahmen des Trinity-Tests auf dem Testgelände White Sands im Süden des US-Bundesstaats New Mexico gezündet. Der Physiker Kenneth Bainbridge, der Leiter des Trinity-Tests, soll danach zu J. Robert Oppenheimer gesagt haben: «Jetzt sind wir alle Hundesöhne.»7 Drei Wochen später, am 6. und 9. August 1945, folgte der Abwurf der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki. Die beiden Atombomben zerstörten die japanischen Grossstädte beinahe vollständig und töteten um die 100 000 Menschen sofort. Bis Dezember 1945 starben in Hiroshima rund 140 000 und in Nagasaki 70 000 bis 80 000 Menschen. Die genaue Anzahl der Menschen, die an den Spätfolgen der radioaktiven Verstrahlung starben, wird sich nie genau ermitteln lassen.8
Der gleissende Blitz der Explosion brannte die Schattenrisse von Personen in die verbliebenen Hauswände. Die Menschen wurden mit der Druckwelle fortgerissen und zerfetzt oder durch die Hitze zu Asche verbrannt. Eine glühende Feuersbrunst zerstörte die beiden japanischen Städte in einem brennenden Inferno fast vollständig. In Hiroshima flohen viele Überlebende vor der unerträglichen Hitze an den Fluss, wo sie vom radioaktiv verseuchten Wasser tranken. Nach den Explosionen ging ein schwarzer, schmieriger Regen über den beiden Städten nieder. Die schwer verletzten Menschen, viele mit Brandwunden, waren auf sich allein gestellt. Viele von ihnen starben in den folgenden Stunden und Tagen einen qualvollen Tod. Den Überlebenden, welche eine tödliche Strahlendosis abbekommen hatten, fielen zuerst die Haare aus, dann bekamen sie purpurrote Flecken am ganzen Körper, die Haut begann sich in Fetzen von den Knochen zu lösen, und schliesslich verbluteten sie schmerzhaft an inneren Verletzungen. Zehntausende Überlebende, die sogenannten Hibakusha, starben in den darauffolgenden Monaten und Jahren an den Spätfolgen der radioaktiven Verstrahlung und erlitten Krebs, Leukämie, Tumore, Wachstums- und Entwicklungsstörungen, Tot- und Fehlgeburten, Erbkrankheiten, Blut- oder Hautkrankheiten, psychische Störungen, Angstzustände, Depressionen; sie wurden von Schuldgefühlen geplagt oder alterten frühzeitig.
Seit Hiroshima und Nagasaki ist die Atombombe zum Symbol für die Bedrohung der Menschheit durch sich selbst geworden. Der Einsatz der beiden Atombomben führte zwar zur sofortigen, bedingungslosen Kapitulation Japans und beendete den Zweiten Weltkrieg, militärisch gesehen war der Einsatz jedoch überflüssig, da die Japaner schon geschlagen waren. Der Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki war vor allem eine Machtdemonstration der USA gegenüber der Sowjetunion vor dem Hintergrund der bevorstehenden Neuordnung der Welt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Angst vor einem apokalyptischen Atomkrieg prägte in der Folge das Zeitalter des Kalten Kriegs.
Unmittelbar nach dem Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki übergab ein japanischer Gesandter am 10. August 1945 im Auftrag seiner Regierung dem Schweizerischen Bundesrat in Bern die Erklärung der bedingungslosen Kapitulation, damit diese von der Schweizer Regierung an die USA und an China übermittelt würde. Gleichzeitig wurde die Erklärung über Schweden an Grossbritannien und an die Sowjetunion weitergeleitet. Am 15. August 1945 verkündete Kaiser Hirohito offiziell die bedingungslose Kapitulation Japans, womit der Zweite Weltkrieg endgültig beendet wurde.
Die Nachricht vom Abwurf der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki wurde in der internationalen Presse sofort in dessen historischer Bedeutung erfasst, die Auswirkungen für die betroffene Bevölkerung allerdings weitgehend ausgeblendet. Ab dem 12. September 1945 verhinderte die Zensur der amerikanischen Besatzungsbehörden alle Berichte über die Zerstörung der beiden japanischen Städte und die Auswirkungen der Atombomben. Sämtliche Fotografien und Filmaufnahmen der zerstörten Städte mit ihren Ruinen, Trümmern und den verkohlten Leichenbergen sowie den verletzten und verstrahlten Menschen wurden konfisziert und durften nicht veröffentlicht werden. Gleichzeitig reisten Hunderte amerikanische Wissenschaftler, Ärzte und Soldaten nach Japan, um die Wirkung der neuen Waffen zu erforschen. Viele Überlebende wurden von den amerikanischen Militärärzten wie menschliche Versuchskaninchen akribisch genau untersucht, aber nicht behandelt.9
Der Schweizer Physiker Fritz Zwicky, der 1925 bei Paul Scherrer an der ETH Zürich promoviert hatte und seit 1942 als Professor für Astrophysik am California Institute of Technology (Caltech) tätig war, reiste 1945 im Auftrag der amerikanischen Luftwaffe zunächst nach Deutschland, wo er deutsche Wissenschaftler und Techniker – darunter etwa den Raketeningenieur Wernher von Braun – verhörte, und anschliessend nach Japan, wo er für den Oberbefehlshaber der amerikanischen Besatzungsbehörde, General Douglas MacArthur, einen geheimen Bericht über die durch die Atombombe verursachten Schäden und über mögliche militärische Abwehrmittel verfasste.10
«[…] die Börse wittert ein goldenes Zeitalter und lässt die Uranaktien steigen, doch vom Leichenfeld der getöteten 300 000 Einwohner von Hiroshima aus verbreitet sich böse Ahnung über die weite Welt.» National-Zeitung, 11./12.8.1945
Unmittelbar nach Abwurf der Atombomben entfaltete sich auch in der Schweizer Presse eine intensiv geführte Debatte über die Atomenergie. Fast alle Zeitungsartikel waren sich darin einig, dass mit dem Abwurf der beiden amerikanischen Atombomben der Anbruch eines neuen Zeitalters – des Atomzeitalters – begonnen hatte. Nebst dem Schrecken über die atomare Zerstörung stand die Faszination über die Möglichkeit einer technischen Nutzung der neuen Energieform.11 Am 11. August 1945 schrieb die Basler National-Zeitung unter dem Titel «Wunder und Wahnsinn»: «Amerikaner träumen von benzintankfreiem Autofahren und Fliegen, die Börse wittert ein goldenes Zeitalter und lässt die Uranaktien steigen, doch vom Leichenfeld der getöteten 300 000 Einwohner von Hiroshima aus verbreitet sich böse Ahnung über die weite Welt.»12
Die Berichterstattung der Schweizer Presse basierte weitgehend auf den offiziellen Stellungnahmen der USA und war geprägt von Vermutungen, Gerüchten und Halbwissen. Der Schweizer Physiker Ernst Carl Gerlach Stückelberg von der Universität Genf gestand am 15. August 1945 in der Neuen Zürcher Zeitung, dass die Schweizer Physiker von der Nachricht der Atombombe überrascht worden seien.13 Otto Huber und Peter Preiswerk von der ETH Zürich erklärten daraufhin in einem weiteren Zeitungsartikel vom 19. August 1945 in der Neuen Zürcher Zeitung, die nukleare Kettenreaktion der Atombomben sei nur durch eine Isotopentrennung des Urans im industriellen Massstab möglich geworden.14
Die Nachricht vom Abwurf der Atombomben in Hiroshima und Nagasaki führte dazu, dass sich die Schweizer Armee umgehend mit der Frage einer Atombewaffnung zu beschäftigen begann. «In den führenden Kreisen unserer Armee hat man mit sehr lebhaftem Interesse von der Verwendung von Atombomben durch die Amerikaner […] Kenntnis genommen», hiess es in der Basler Arbeiter-Zeitung vom 9. August 1945.15 Für die Armeeführung war klar, dass die Schweiz ebenfalls nach der Bombe streben musste. In einem Brief vom 15. August 1945 wandte sich Oberstkorpskommandant Hans Frick, der Chef der Ausbildung der Schweizer Armee, an FDP-Bundesrat Karl Kobelt, den Chef des Eidgenössischen Militärdepartements (EMD), und empfahl ihm, zu diesem Zweck eine «Studienkommission» zu gründen, der nebst dem Generalstabschef und dem Chef der Kriegstechnischen Abteilung (KTA) einige prominente Schweizer Atomphysiker angehören sollten. Diese «Studienkommission» sollte die theoretischen Grundlagen für eine Bewaffnung der Schweizer Armee mit Atombomben erarbeiten. Am 20. August 1945 wandte sich auch Otto Zipfel, der Delegierte für Arbeitsbeschaffung, an Bundesrat Karl Kobelt, um diesen über den Stand der Forschungen im Bereich der Atomphysik in der Schweiz zu informieren. Gleichzeitig schlug er Kobelt eine Besprechung mit dem Generalstabschef Louis de Montmollin und dem Chef der KTA, René von Wattenwyl, vor.
Am 3. September 1945 befasste sich die Landesverteidigungskommission (LVK) erstmals mit der Atombewaffnung. Am darauffolgenden Tag schrieb René von Wattenwyl in einem geheimen Schreiben an Bundesrat Kobelt: «Unsere Informationen über die Eigenschaften, Wirkungen und Produktionsmöglichkeiten der Atombomben müssen erweitert werden. Dafür empfiehlt es sich, eine leitende wissenschaftliche Kommission einzusetzen, welche alle Aspekte des Problems bearbeitet, also nicht nur die Uranbombe als Kriegsmaterial, sondern auch die Möglichkeit der Verwendung von Atomenergie für andere Zwecke.»16 Nebst dem Bau einer eigenen Atombombe sollte insbesondere der Schutz vor atomaren Angriffen, aber auch die zivile Nutzung der Atomenergie erforscht werden.
Im September und Oktober 1945 schrieb Bundesrat Kobelt allen Vorstehern der physikalischen und chemischen Forschungsinstitute, die sich in der Schweiz mit der Atomphysik beschäftigten. In seinem Schreiben bat er die Schweizer Physik- und Chemieprofessoren, sich an einer «Studienkommission» des Militärdepartements zu beteiligen, die sich mit der Atomenergie beschäftigen sollte. Am 5. November 1945 berief Kobelt im Bundeshaus eine Konferenz ein, an der die Studienkommission für Atomenergie (SKA) gegründet werden sollte. Professor Paul Scherrer informierte in einem Vortrag die anwesenden Wissenschaftler und Vertreter der Armee über den aktuellen Stand der Atomphysik, die vermutete Funktionsweise der amerikanischen Atombomben und weitere Anwendungen der Atomenergie. In seinem Vortrag machte Paul Scherrer darauf aufmerksam, dass die Entwicklung eines Atomreaktors oder einer Atombombe in der Schweiz grosse finanzielle Mittel und die Koordination aller Forschungen auf diesem Gebiet erfordern würde.