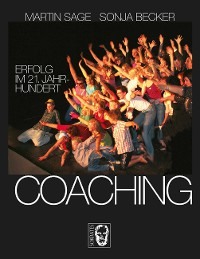Czytaj książkę: «Coaching»

COACHING
ERFOLG IM 21. JAHRHUNDERT
1. Auflage, ePUB, August 2014
© Sokrates Verlag München
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert, oder in elektronischen Systemen verarbeitet, eingespeichert oder vervielfältigt werden.
Erstausgabe der Printversion im Dezember 2006
| COACHING | ISBN 978-3-945562-00-0 | Gestaltung: |
|---|---|---|
| Alle Rechte der Ausgabe: | Wolfgang Rollmann | |
| © Sokrates Verlag München | Graphische Umsetzung: | |
| Web: www.sokrates-verlag.de | atelier kolar | |
| Shop: www.sokrates-verlag.com | Umschlag: Petra Tschorn | |
| Martin Sage | Autorenkontakt: | Sage University |
| info@sageuniversity.com | www.sageuniversity.com | |
| Sonja Becker | Autorenkontakt: | Wailea, München |
| High Performance | info@wailea.de | |
| Leadership Training | www.wailea.de |
MARTIN SAGE UND SONJA BECKER
Gute Mentoren haben nicht das Gefühl, schlau sein zu müssen. Das ist vulgär. Es zeichnet einen Menschen nicht aus, etwas zu wissen, was ein anderer nicht weiß oder wissen kann. Was gute Mentoren ausmacht, ist Menschlichkeit und Demut. Carlos Castaneda spricht in diesem Sinn von „Nicht-Tun“ oder auch von „kontrollierter Verrücktheit“ – etwas zu tun, ohne einen Grund dafür zu haben. Daraus erwächst zwangsweise etwas Neues.
Martin Sage, Mentor und Meister der Neugier, und Sonja Becker, Mentorin und Anthropologin, wollen mit diesem Standardwerk wache Menschen ermutigen. Ein Amerikaner und eine Deutsche sehen von Deutschland ausgehend die Kernzelle für eine neue Gesellschaftsepoche für Europa pulsieren!
In diesem Standardwerk wird die Sage-Lernmethode mit 100 Tools vorgestellt. Die „FührerInnen“ von morgen, die tatsächlich Menschen bewegen wollen, sind die Leser und Anwender dieses Buches. An dieser Stelle soll ausgeheilt werden, was das Talent der Deutschen ist: Führen = Leadership!
Sage und Becker coachen Menschen in die Richtung, was sie am liebsten tun, und vermitteln ihnen den Weg dorthin. Um den eigenen Stil zu finden, entwickeln sie Themen rund um Leitfragen wie „Was lieben Sie am meisten?“ oder auch „Was haben Sie überlebt? Was ist Ihre Botschaft?“. Wenn Sie einmal so weit sind, eine klare Antwort auf diese Fragen zu formulieren, wissen Sie auch, welche Art Coach Sie sind und wie Sie es verkaufen.
EIGENTLICH IST JEDER MENSCH EIN COACH in etwas: Es lohnt sich, es herauszufinden, denn dahinter könnte ein Millionengeschäft warten. Sie können sich selbst überraschen. Sie leben nur das halbe Leben, wenn Sie sich nicht zumindest diese Frage stellen.
Die meisten Menschen haben Angst davor, zu sehen, wer sie wirklich sind, weil ihre Wirklichkeit eine andere ist. Daher entwickeln sie einen Tunnelblick. Dazu gibt es ein berühmtes Zitat: „Angst killt Innovation“. Lassen Sie nicht die Ihre killen.
PROLOG
Wenn ihr’s nicht fühlt,
ihr werdet’s nicht erjagen,
Wenn es nicht aus der Seele dringt, und mit urkräftigem Behagen
Die Herzen aller Hörer zwingt.
Sitzt ihr nur immer! Leimt zusammen,
Braut ein Ragout von andrer Schmaus,
Und blast die kümmerlichen Flammen
Aus eurem Aschenhäufchen ´raus! Bewunderung von Kindern und Affen,
Wenn euch darnach der Gaumen steht -
Doch werdet ihr nie Herz zu Herz schaffen,
Wenn es euch nicht von Herzen geht.“
"What you don’t feel, you will not grasp by art,
Unless it wells out of your soul
And with sheer pleasure takes control,
Compelling every listener’s heart.
But sit - and sit, and patch and knead,
Cook a ragout, reheat your hashes,
Blow at the sparks and try to breed
A fire out of piles of ashes!
Children and apes may think it great,
If that should titillate your gum,
But from heart to heart you will never create.
If from your heart it does not come."
aus: Goethe, Johann Wolfgang von. Faust I.
Erich Trunz (Hg.), München 1982
DIALOG (Bliss: Charles Lloyd/Billy Higgins).
DIALOG – BLISS
Zwei Musiker auf dem Höhepunkt ihres Lebens. Der Saxophonist Charles Lloyd und der Schlagzeuger Billy Higgins sitzen in Lloyds Haus in Big Sur, Kalifornien, an der Küste des Pazifik. Der eine wird bald sterben. Beide wissen das. Und eine Woche lang haben sie zusammen im Wohnzimmer Musik gemacht. Immer, wenn Higgins die Kraft hatte, vom Bett aufzustehen, bringt er eines von Lloyds überall verstreuten Instrumenten mit und beginnt, sie zu traktieren. Es entsteht Musik, die sie noch nie vorher gemacht haben. Musik, die nicht populär ist. Aber das ist ihnen egal. Sie sind eins mit sich und ganz woanders: In Big Sur, auf dem Gipfel des Berges, über dem Pazifik.
CHARLES LLOYD: „There’s a feeling when you play, that I can’t describe – but there’s no feeling like it in the world.“
BILLY HIGGINS: „We did all those wonderful and all not those wonderful things together, but we come out of all that and here we are, on another plane now. So this is a different plane here.“
Lloyd ist einer der größten lebenden Saxophonisten, Higgins einer der größten Drummer im Jazz. Kein Titan am Jazzhimmel, mit dem Billy Higgins nicht in den vergangenen vierzig Jahren gespielt hat. Charles Lloyd, der einzige Jazzmusiker, der in Woodstock auf der Bühne stand. Der sich von Big Sur zurückzog und lieber am Strand mit seinem Nachbarn Larry Hagman Frisbee spielte. Der zu Beginn der Achtziger wieder die Bühne betrat und sie seitdem nicht wieder verließ. Der eine moderne Musik spielt, die die Frauen lieben. Die beiden sind alte Freunde. Jetzt ist die letzte Gelegenheit, zu spielen, wie sie schon immer spielen wollten.
LLOYD: „When I was in retreat, I had the benefits of all that experience to reflect to and also, to work continually. But what I really learned – when you slow down enough, you can understand volition and velocity better. And when you play, the timelessness of that becomes infused and your song has a natural rhythm that you can move through space in a different kind of way. (...) It is such a true high that causes great humility because you know it is not yours, and you can’t misuse it.“
HIGGINS: „Anything you do, if it is in the spirit, it’s going to be right. So you submit to the point where it’s not coming from me, it’s going through me ... Hey man, I’m telling you, that’s a whole suite right there! That’s two guys, just two guys sittin’ on the top of the mountain. You’re talkin’ about the journey’s end – the journey’s just beginning.“
LLOYD: „Can I say something to you in all sincerity? This is one of the greatest joys of my life – because what we have been able to do, to share it with you – and for you to peep that it’s real and that it’s blessed ... I mean, it just encourages us.“
HIGGINS: „Let me tell you something, please ... let’s please ... this might be the last time we do this. It made me understand a lot of what I’m trying to do ... but for us to be able to do it at the right time, in the right space ... What we doin’ is gettin’ our fire power to be able to do this on any level. We got to keep workin’ on this music.“
LLOYD: „Do you mean to tell me that you’re going to get up off the bed and come back to work on this with me?“
HIGGINS: „I didn’t say I would be there, but I will always be with you.“
Quelle:
Charles Lloyd/Billy Higgins: Which way is East.
ECM Records 2004.
PART 1 THEORIE
1. EINFÜHRUNG - DEUTSCHLANDS MELANCHOLISCHER MARKT
DEUTSCHLANDS MELANCHOLISCHER MARKT
„Der Mensch, welcher nicht zur Masse gehören will, braucht nur aufzuhören, gegen sich bequem zu sein; er folge seinem Gewissen, welches ihm zuruft: „Sei Du selbst! Das bist Du alles nicht, was Du jetzt thust, meinst, begehrst.“
„The man who doesn’t want to belong to the masses needs just to stop being comfortable with himself; he should follow his conscience that appeals to him: „Be yourself! From all what you are doing, meaning, longing for right now, nothing is yourself.“
(Friedrich Nietzsche, Unzeitgemäße Betrachtungen)
1. EINFÜHRUNG
Coaching und Erfolg im 21. Jahrhundert – wie hängt das zusammen? Eine zunächst schwierige Frage. Aber nehmen wir es sportlich. Schließlich ist „Coaching“ ein Begriff aus dem Sport, und Business ist im Prinzip auch eine Sportart.
Das zu beweisen, ist schwer, zumindest bei einem Blick auf den deutschen Markt. Die moderne Ökonomie, wie etwa in Deutschland, ist noch nicht dynamisch ausgerichtet. Wenn Konzernriesen neue Modelle entwickeln, die ihrem trägen System einen neuen Schub geben oder sie sogar retten sollen, versuchen sich hoch bezahlte, meistens denkbar unkreative Unternehmensberater als Rationalisierer zu profilieren. Die Menschen, die da in Massen entlassen werden, erschienen immer pünktlich zur Arbeit, versuchten, einen guten Job zu machen, sind auf Sicherheit und Vorsorge ausgerichtet und lebten in der ständigen unterschwelligen Panik, entlassen zu werden. Bis dieser Fall tatsächlich eintritt. Selbst erfolgreiche Manager werden immer öfter entlassen und wissen nicht, wie sie den Weg zurück finden können. Die Headhunter sind selbst arbeitslos, das Arbeitsamt mit dem inzwischen etwas flotter klingenden Namen „Bundesagentur für Arbeit“ präsentiert alte Hüte, keine neuen Jobs und immer höhere Arbeitslosenzahlen. Erfolgreiche Leute werden mit dem Prädikat „überqualifiziert“ abqualifiziert, Angestellte haben Angst, nie wieder Angestellte zu sein. Sie sollten froh sein: Das Leben hat gerade erst begonnen. Für all das gibt es in Deutschland meistens einen Schuldigen: Die Politik, die Regierung, wenn nicht gar der Bundeskanzler persönlich. Dies entspringt dem klassischen Denken im deutschen Kulturkreis, das schon immer den „Staat“ als größte übergeordnete Einheit wahrgenommen hat.
Der deutsche Generalzustand ist als melancholisch zu bezeichnen. Ein Blick in die Nachkriegsgeschichte und auch in die Kultur- und Mentalitätsgeschichte der Nation gibt darüber reichlich Aufschluss.
Deutschland 1954:
3, 2, 1, 0 ... Tor! Tor! Tor! Tor!
DEUTSCHLAND 1954:
3, 2, 1, 0 ... TOR! TOR! TOR! TOR!
Tor! Tor! Tor! Tor! Es ist aus! Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister!“ Fast jeder Deutsche kennt diese O-Töne des Reporters Herbert Zimmermann am 4. Juli 1954. In den letzten Minuten vor dem Schlusspfiff gelang der deutschen Nationalmannschaft auf wundersame Weise doch noch der entscheidende Siegtreffer zum 3:2-Endstand, nachdem das deutsche Team 0:2 zurückgelegen hatte. Das „Wunder von Bern“ verhalf den Deutschen wieder zu neuem Selbstbewusstsein, zum ersten Mal nach der Katastrophe des Nationalsozialismus. Keine Frage: Mentalitätsgeschichtlich betrachtet, ist dieser 4. Juli, an dem das „Wunder von Bern“ geschah, nicht nur der amerikanische, sondern auch der deutsche Nationalfeiertag.
Glücklicherweise trat bereits das nächste Wunder ein: Das deutsche Wirtschaftswunder. Nachdem die deutschen Trümmerfrauen nach 1945 aus Schutt und Asche die zerbombten Städte langsam wieder aufrichteten, gelang vor allem durch Fleiß und Akribie der neue industrielle Boom in den Fünfziger Jahren. Arbeit gab es genug, den Beruf konnte man sich aussuchen. Der Wohlstand breitete sich allmählich aus und sorgte für wellenartige Konsumbewegungen: Zeitgenossen erinnern sich noch gut an die „Fresswelle“, die „Autowelle“ und die „Häuserwelle“, bis man in den Siebziger Jahren in den Bereichen der Notwendigkeiten eine gewisse Marktsättigung feststellen konnte. Dann ging es darum, das jeweils bessere Produkt am Start zu haben, die modischeren Kleider zu tragen und das jeweils bessere Auto vor dem Reihenhaus zu parken als der Nachbar – „keepin’ up with the Jones“.
In den Achtziger Jahren brach schließlich die große Party namens „Lifestyle“ der „Young Urban Professionals“ aus – endlich durfte man ungeniert zeigen, was man hat, und die Champagnerkorken knallen lassen. Noch nie hatten junge Menschen derartige Chancen, innerhalb kurzer Zeit zu viel Geld zu kommen, statt wie ihre Eltern sich bis ins hohe Alter für ihr Häuschen und ihre Rente krumm und buckelig zu schuften.
Perestroika war das globale politische Wunder der Achtziger Jahre, dem Fall der Mauer folgte nach anfänglicher Euphorie für ein Stimmungstief, das mit der Rezession und dem ersten Golfkrieg zu Beginn der Neunziger Jahre einherging. Die von einem Bundeskanzler prophezeihten „blühenden Landschaften“ der ehemaligen DDR verdorrten, zahlreiche Milliardenprojekte verliefen im märkischen Sand Ostdeutschlands, das als „Mezzogiorno Deutschlands“, das hoffnungslos verarmte „Dunkeldeutschland“ galt. Und irgendwie verschwand die Partylaune der Achtziger Jahre, inklusive ihrer Gegenbewegungen, der künstlerischen Subversivität und Avantgarde, irgendwo in den Stromlinien bedingungsloser Anpassung an Marktgesetze von der korrekten Krawatte bis zur Manager-Etikette, an die neue Bescheidenheit und der „political correctness“. Man behalf sich mit Spaß und Ironie.
Die Neunziger Jahre waren vor allem langweilig und nicht so gemeint. Für kurze Zeit herrschte wieder Auftrieb, als die „New Economy“ Jüngst- und Kleinstunternehmer mit schnell geschriebenen Business-Plänen dank „Business Angels“ an die Börse trieb, die ihr von Aktionären hereingespültes Geld geschickt zu verschwenden wussten. Die vermeintlichen „Innovationen“, die dank der Digitalisierung ganzer Wirtschaftszweige wie Unkraut sprossen, erwiesen sich als Seiltanz, weil sie jeden unternehmerischen und verantwortungsvollen Denkens entbehrten – dazu war einfach schon zuviel Geld da. Der „Neue Markt“ ging sang- und klanglos unter.
11. September: Schluss mit lustig
11. SEPTEMBER: SCHLUSS MIT LUSTIG
Der 11. September 2001 besiegelte in Deutschland das Ende dieser „Spaßgesellschaft“, der pseudo-ironischen Kultur der Neunziger Jahre, die sich selbst auf die Nerven ging. Die Lage der Nation wird ernst und ernster. Immer mehr Arbeitsplätze gehen verloren, wer sich auf der Straße wieder findet, fühlt sich meistens hilflos. War es in den Neunziger Jahren für viele sogar ein Spaß, mal arbeitslos zu sein, nichts zu tun und vom Staat Geld zu kassieren, wirft die Regierung viele jener aus ihrer „sozialen Hängematte“ mit Kürzungen und Auflagen hinaus. Wenn es einen neuen Wert gibt, dann ist es der Euro, der von vielen „Teuro“ genannt wird. Fast alle Anbieter nehmen den Abschied von der Wirtschaftswunder-D-Mark zum Anlass, die alte Währung mit der neuen gleichzusetzen. Die meisten Konsumprodukte werden in Deutschland bis doppelt so teuer, gleichzeitig haben die meisten Menschen weniger Geld. Billig erlebt einen Boom wie nie, „value for money“ ist das Gebot der Stunde, „Geiz ist geil“ der bekannteste Slogan, ganze Märkte erleben einen Einbruch, weil die Konsumenten entweder preiswerte Wege zur Ware finden oder sie gnadenlos herunterhandeln. Die Profiteure sind Konsumketten, die schon immer billigst anboten. Gehörte es in den Achtziger Jahren zum guten Ton des Konsums, nach dem Motto „was nichts kostet, das ist nichts“ zu shoppen, ist es nun ein Zeichen der Intelligenz, das jeweils günstigste Angebot zu recherchieren und dann vielleicht doch nichts zu nehmen. Die Situation nimmt dann absurde Züge an, wenn Politiker angesichts der wirtschaftlichen Talfahrt ihre Bürger zu „mehr Konsum“ auffordern. Diese haben entweder kein Geld – oder einfach Angst.
Deutschland befindet sich in einem gewaltigen Umbruch: Man klammert sich verzweifelt an die alten Jobs, auch wenn sie immer redundanter werden. Bürokratische Institutionen und Gewerkschaften lähmen notwendige Prozesse und wissen, dass sie an alten Zöpfen hängen. Die bittere Pille der Reformen liegt zur Einnahme bereit, an ihr führt kein Weg mehr vorbei, und jeder weiß es. Aber wer es sich nach wie vor einfach machen will, schiebt weiter die Schuld auf die „Regierung“. Das Problem Deutschlands, wenig Eigenverantwortung zu entwickeln – im Gegensatz etwa zu den Vereinigten Staaten – liegt an der traditionellen Fixierung auf das System „Staat“ und seiner Elemente im deutschen Kulturkreis, innerhalb derer man sich selbst nicht als Agierenden, Verändernden in die Situation einbezieht, sondern lediglich auf das Agieren des Staates wartet. Diese dem „Vater Staat“ zugeschriebene Übermächtigkeit generiert das Gefühl der eigenen Ohnmächtigkeit.
Das Gefühl, selbst nichts ändern zu brauchen, hat eine lange Tradition in der deutschen Mentalitätsgeschichte. Der Grundcharakter der Deutschen ist nach wie vor ihre weltberühmte und viel zitierte Melancholie: Wir sitzen da, geben die Schuld für alles Übel selten uns selbst und warten auf das nächste Wunder. Die Gründe für diese Befindlichkeit? Möglicherweise liegen sie tief in unserer Vergangenheit verankert. Viele Zitate aus unserer Kulturgeschichte sprechen dafür. Um dieses Phänomen zu verstehen, reicht ein Sprung in die deutsche Mentalitätsgeschichte seit Martin Luther.
Die lange Karriere der deutschen Melancholie
DIE LANGE KARRIERE DER DEUTSCHEN MELANCHOLIE
Gehorsam ist bei ihnen nicht Knechtschaft, er ist Regelmäßigkeit, charakterisiert die französische Philosophin und Chronistin Madame de Staël die Deutschen in ihrer viel beachteten Analyse „Über Deutschland“ (37) zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Das ist ein schockierender Befund. Es handelt sich aber um eine Entwicklung, die man in Deutschland bereits seit dem Mittelalter nachvollziehen kann.
Die kulturelle „Prägung“ Deutschlands ist sprichwörtlich zu nehmen. Als Johannes Gutenberg um 1400 in Mainz eine Weinpresse in eine Maschine umwandelt, mit der man jeden Buchstaben einzeln zu Wörtern und Sätzen zusammensetzen kann, erfindet er die beweglichen Lettern, mit denen man beliebige Texte mit schwarzer Flüssigkeit auf ein Stück Papier oder Pergament in beliebiger Anzahl „drucken“ kann. Mit der Einführung der beweglichen Lettern beginnt die Wirkungsgeschichte der Medien.
In Deutschland wurde mit dem Buchdruck eine gigantische Medien- und Mentalitätsverschiebung in Gang gesetzt. Der durchschlagende Erfolg des Buchdrucks beruht weniger auf der Entwicklung von grafischen und textlichen Grundlagen, sondern ihrer Verbreitung. So vermutet man, dass die Kunde von der Entdeckung Amerikas am Ende des 15. Jahrhunderts und die Nennung ihrer Protagonisten kaum so schnelle Verbreitung und Nachahmung gefunden hätte, wenn nicht bald danach eine große Anzahl von Mitteilungsblättern, Text- und Kartenmaterial in Europa kursierten, die schnell in den Druckerpressen Spaniens, Italiens und Deutschlands angefertigt wurden.
Buchdruck bedeutet Orientierung. Mit Johannes Gutenberg, dem „Mann des Jahrtausends“ (TIME Magazine 2000), kommt die „Macht der Ideen“ in die Welt. Das erste große Druckwerk Gutenbergs ist eine lateinische Bibel. Einer der ersten, der die Dimensionen dieser neuen Technik erkennt, ist der Reformator Martin Luther. Der Philosoph Johann Gottlob Fichte betrachtet Luthers Reformation in seinen „Reden an die deutsche Nation“ im Jahr 1806 als die „letzte große, und im gewissen Sinne, vollendete Welttat des deutschen Volkes“.
Die neue Religion verändert das Gesicht Deutschlands mental und fundamental. Die katholische Kirche schlug die Brücke zwischen Gott und den Menschen, die protestantische Kirche hält sich nun aus allem heraus, um die Eigenständigkeit des Menschen als mündiges Wesen zu bestärken. Das hat seinen Preis: Keine Vertretung Gottes auf Erden, der irdische Bezug fällt weg, nichts steht zwischen Gott und Mensch. Nun liegt es an jedem einzelnen Individuum, wie er/sie die unmittelbare Beziehung zu Gott gestaltet. Die einzige Instanz ist das Gewissen, und es ist meistens ein schlechtes Gewissen, das die protestantischen Menschen verfolgt. Aber im Dialog zu Gott – etwa durch das Gebet oder die Andacht – entsteht ein Moment, das eine neue Realität hervorbringt: die „Innerlichkeit“. Auf sich selbst geworfen zu sein und allein mit dem Gewissen vor Gott sind Freiheit und Fluch der Protestanten. Luthers populärste Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ (1520) geht von Paulus‘ Paradox aus: „Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan“.
Zwischen Gewissen und Gott, Innerlichkeit und Wirklichkeit, Freiheit und Untertänigkeit entsteht das neuzeitliche Deutschland protestantischer Prägung. Luthers „Welttat“ hat also einen tragischen Kern. Ohne den wirklichen Rückhalt der Kirche ist man mit seinem Gewissen auf sich gestellt. Der innerliche Bezug zu Gott wird dabei wirklicher als der Bezug zur Wirklichkeit. Gott allein ist ihr metaphysischer Mittelpunkt. Jetzt tut es dringend Not, die Bewegung vom Epizentrum Wittenberg auf Deutschland auszudehnen. Dies geschieht durch die Verbreitung der Lehre Luthers mit Bibel und Bildung. An den Universitäten entwickelt sich ein weltliches Pendant zur göttlichen Ordnung: Ein abstrakter, unpersönlicher Herrschaftsapparat: der “Staat“.
Luther bringt mit den Mitteln der Zeit „den Ernst in die Welt“, wie der Soziologe Helmut Plessner im 20. Jahrhundert beschreibt. Publikumswirksam schlägt Martin Luther seine Thesen gegen den Ablass an eine Tür. Dann nutzt er die frische, wenn auch noch unausgegorene Technik des Buchdrucks, sein Wort Gottes zu übersetzen und zu verbreiten.
Und damit es dabei auch auf Dauer nicht bleibt, unternimmt er mit Hilfe von Philip Melanchthon das Großprojekt „Verbreitung der Reformation“. Ort des Geschehens: Die Universität Wittenberg, die kurz vorher erst das Gründungsprivileg erhielt. Wittenberg wird zum Epizentrum des deutschen neuzeitlichen Denkens, dessen gepflegte Innerlichkeit von hier aus Schule und Staat macht. 1508 kommt Martin Luther auf Ersuchen des Generalvikars Johann von Staupitz als studierender Mönch und Lektor für Philosophie aus dem großstädtischen Erfurt an die Universität. 1512 erhält er an der Universität eine Bibelprofessur. Bereits 1516, im Jahr des bis heute geltenden Deutschen Reinheitsgebots für Bier, betont Luther die Aufwertung nichttheologischer Fächer und die Notwendigkeit einer Bereinigung der Universität von altscholastischen Zöpfen. Das war ausnahmsweise nicht allein Luthers Idee. Mit den katholischen „Burgen des Teufels“, wie er die Universitäten nannte, wollte er früher nichts zu tun haben. Bis Philip Melanchthon kommt. Luthers anfänglicher Hass auf die Universitäten schlägt durch Melanchthons Einfluss in den Plan um, vor Ort mit der Reformation anzusetzen.
Die Universitäten besaßen politische Autorität, weil Absolventen meistens Staatsdiener und Berater wurden, so dass die Kaste der Intellektuellen und die Regenten die politische Sache traditionell unter sich ausmachten. Unter Luther sollte das so bleiben – natürlich nach allen Regeln der Reformation. In erster Linie ging es nun darum, die Universität von der dort gelehrten Scholastik und dem Einfluss Roms zu befreien. In zweiter Instanz wollte man die tiefsten Wurzeln des Christentums aus der Antike ausgraben. Der Wittenberger Rückzug in die Tiefe war der Gegenschlag zum Katholizismus, der die Sünde immer im Beichtstuhl ortete.
Für das isolierte schlechte Gewissen vor Gott allein aber musste ein neues Medium her. An der Universität Wittenberg, Luthers und Melanchthons Wirkungsstätte, entsteht das Modell Deutschland. Denn von hier aus machen Martin Luther und Philip Melanchthon Staat und Schule.