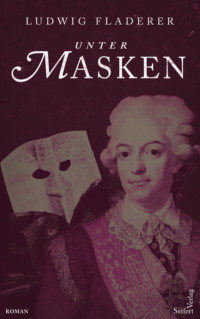Czytaj książkę: «Unter Masken»
UNTER MASKEN
LUDWIG FLADERER
unveränderte eBook-Ausgabe
© 2022 Seifert Verlag
1. Auflage (Hardcover): 2020
ISBN: 978-3-904123-60-0
ISBN Print: 978-3-904123-36-5
Umschlaggestaltung: Michi Schwab, Union Wagner, Wien, unter Verwendung eines Fotos von commons.wikimedia.org
Sie haben Fragen, Anregungen oder Korrekturen? Wir freuen uns, von Ihnen zu hören! Schreiben Sie uns einfach unter office@seifertverlag.at
Seifert Verlag GmbH
Ungargasse 45/13
1030 Wien
INHALT
Danksagung
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Epilog
Meinen Eltern
PROLOG
Nur zu gut kannte er die trügerische Wärme des Schnees. Auch diesmal überwand er die Versuchung, in der Mulde hinter der Birke liegen zu bleiben, und stemmte sich gegen die Decke aus weißem Pulver. Die Kälte drang mit derartiger Wucht in seine Glieder, dass er selbst nun nichts anderes mehr war als eben diese große, erhabene Qual. Erst der zarte Fall der Kristalle auf den schneebedeckten Boden, den er vernahm wie den Klang von etwas anderem, das nicht Schmerz war, gab ihm die Kraft, sich ganz aufzurichten. Nun trieb ihn der Hunger, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Schritt auf Schritt, so langsam, dass er Angst hätte haben müssen, von den anderen verspottet und angegriffen zu werden, wenn er sich ihres tiefen Schlafes nicht sicher gewesen wäre. Satt und für einige Stunden noch harmlos, ruhten sie unweit des Weges – den Jägern der Fremdlinge zum Spott.
Der Hunger führte ihn, überlagerte das Stechen in Lunge und Gliedern und setzte ihn in Trab. Der Nebel über dem zugefrorenen See würde ihn den Blicken seiner Opfer entziehen, aber trug ihn die Eisdecke? Nach einem warmen Herbst hatten zwar Schnee und Kälte die Herrschaft angetreten, aber die Speichen des großen Sonnenrades warfen immer wieder Wärme auf das Eis. Milchig und verheißungsvoll lockte es ihn, in das Nichts zu gehen. Dorthin, wo er seinen geschundenen Körper nicht mehr spürte. In seiner Jugend – wie herrlich waren da die Kämpfe. Vor seinem klaren Blick hatten alle Respekt gezeigt. Sie senkten die Häupter, wenn er in ihre Mitte trat. Immer war er der schnellste, entschlossenste, wenn es galt, die Schwächen des Gegners zu erkennen, ihm den Fluchtweg abzusperren. In den Nächten der Großen Helle rief er sein Gefolge zusammen, da sangen sie, tanzten sie, ließen himmelhoch ihre Rufe ertönen, die sie eins machten mit der Bläue, an der die Große Helle mild über ihnen hing. Keiner hatte damals gedacht, geplant oder die Vorsicht der Kümmerlinge gezeigt: Alle vereint ergaben sie sich der Macht des Himmels, wenn sie ins Unbekannte liefen, über knotige Wurzeln des Sommerbodens oder das schorfige Eis langer Nächte. Sie flogen dahin, bis Himmel und Erde eins wurden.
Damals war er ihr strahlender Held – jetzt Einsamkeit, banges Spähen nach Opfern, die noch hilfloser waren als er, deren ängstliche Ausdünstung allein sie gerettet hatte, denn sie waren es nicht wert, seine Gegner zu heißen.
Das Revier, in dem er sich noch behaupten konnte, lag am Fuße einer sich weit nach Norden ziehenden Bergflanke, die zur Weite im Osten hin die Grenze bildete. Sein ehemaliges Gefolge hatte sich ohne ihn nie über diesen Bergkamm hinausgewagt. Er war es gewesen, der vor vielen Jahreskreisen einmal den Übergang erzwungen hatte – zu ihrem und seinem Verderben.
Ein hartes Knacken hinter ihm riss ihn aus seinen Träumen. Flach duckte er sich in die nächste Mulde, die noch warm war von etwas Feuchtem. Es roch nach dem Fremden, dem er immer öfter begegnete. Er spähte über den Rand der Vertiefung. Das gelbe Augenpaar eines Luchses, der sich für den Moment eines Herzschlags ihm zuwandte, ehe er in die Wälder des Berghanges eintauchte, warnte ihn: Er war nicht allein. Würde er nicht bald zu Nahrung kommen, könnte ihn sein Gefolge ausmachen – hungrig, jung und ohne Gnade.
Um den See herum war der Schnee niedergetrampelt, vom Geruch der Fremdlinge durchtränkt – sein Gefolge mied diesen Weg, wie er selbst ihn in Zeiten des Glücks gemieden hatte. Doch jetzt trugen ihn dort seine Beine leichter. Im Licht der Großen Helle, das sich nun durch den Nebel gekämpft hatte, lagen die Schatten der Bäume als Zuflucht auf dem weißen Boden. Wenn er den Saum des Waldrandes entlangpirschte, konnte er in dieser Dunkelheit Atem holen und Kraft gewinnen. Im Gehen schmerzte die Lunge mehr und mehr, wie weit konnte man das Rasseln seines Atems wohl hören? Fremde Spuren waren durch den Schnee der letzten Tage unsichtbar, nur die Schatten boten Gewissheit. Bei den drei Birken verließ der Weg das Seeufer und wand sich in sanfter Krümmung eine Anhöhe empor, die er bis jetzt immer umgangen hatte. Dort oben musste der Schrei eines Hähers oder des hier nistenden Adlers jede Hoffnung ersticken, unentdeckt zu bleiben. Die Winternacht war freilich unendlich lang, von den Vögeln noch nichts zu befürchten. Hinter der Anhöhe schimmerte etwas, von dem er wusste, dass es nicht vom Himmel kam, etwas Neues, das ihn nach oben zog. Die Beine, schon gefühllos bis zu den Knien, gehorchten nicht mehr ihm. Sie hatten sich dieser hellen Verheißung ergeben: Nahrung oder Tod durch die Fremdlinge, deren Leben einem Gesetz gehorchte, das weder er noch sein Gefolge je verstanden hatte.
Den Blick dem Licht zugewandt, bemerkte er nicht, wie das Blut aus seiner Lunge den Weg sprenkelte und in erkalteten Klumpen liegen blieb – willkommene Fährte sogar für den Schwächsten unter seinen Verfolgern. Er bog um die letzte Hecke, die das Licht der Fremdlinge noch kurz abschirmte, und stand dann vor einem kristallenen Palast, vor einer Wand aus Karfunkeln, hinter der unzählige kleine Sonnen ihre Strahlen auf eine gläserne Fläche warfen. So schön wie der Eispalast seines großen Ahnen, in dem seine Seele aufgenommen sein würde.
Der Mann wartet im Schatten einer Tanne. Die Kälte tut nichts zur Sache. Sie hält ihn wach, denn er muss denken, immerzu denken. Den schweren Pelzmantel hat er noch von seinem Vater, der ihn nur selten trug. Über seine Bücher gebeugt, in der überheizten Bibliothek brauchte er ihn ebenso wenig wie die Büchse, die der Alte gerade ihm, dem missliebigsten seiner Söhne, vererbt hatte. Er trägt die Waffe heute offen und frei – die Diener des Hofes müssen ihn so für einen Jäger halten, wenn sie ihn hier aufspüren. Doch das ist auszuschließen, denn von seinem Spitzel weiß er zuverlässig, dass man allen Lakaien und Wächtern in dieser Nacht Urlaub gewährt hat. Immer wieder war er hierhergeschlichen, sorgsam bemüht, seine Fährte zu verwischen. Er musste den passenden Abstand finden zu dem anderen, für den die Kugel schon geschmiedet war. Die Distanz, der richtige Winkel, der Stand des Mondes – alles war genau zu bedenken, immer wieder zu bedenken. Und noch nie haben sie ihn entdeckt.
Er, ein Jäger – wie absurd. Unendlich langweilig war ihm stets das Geprahle seiner Standesgenossen über Bären und Wölfe gewesen, die sie auf ihren Gütern erlegt haben wollten. Andererseits – Wolfsjagd trifft ja auch zu. Er hetzt die Bestie hinter den hohen Glasfenstern des Schlosses, den Schwächling mit dem ewigen Lächeln und dem hinkenden Gang, der zum Sterben verurteilt ist, da er ihm alles genommen hat.
Ein Geräusch im Unterholz lässt ihn herumfahren. Seine Augen, noch geblendet vom Licht aus dem Schloss, müssen sich erst an die Finsternis gewöhnen, aber er weiß auch so, dass sich der alte Wolf auf die Lichtung gewagt hat. Oft sah er ihn auf seinen Streifzügen, wenn er mit gesenktem Schweif den Waldsaum wie ein geprügelter Hund entlangschlich. Das räudige Vieh kreuzt seine Wege, es muss weg. Er legt an, ein Schuss kracht. Der Mann zieht sich in den Wald zurück. In der Nacht war nichts geworden, aber immerhin – ein Schädling der Menschheit weniger.

Polizeiminister Sivers schloss seine in blaues Leder gebundene Mappe. Er hatte seinen Vortrag über die Sicherheitslage in den einzelnen Vierteln von Stockholm beendet, aber wie so oft hier draußen auf Schloss Haga kein Gehör beim König gefunden. Ohne Diener oder Höflinge um sich zu dulden, saß Gustav III., der König der Schweden, Goten und Finnen, allein vor der gläsernen Veranda des Palasts am Brunnsviken und starrte in die Winternacht.
»Sire, Sie werden sich erkälten. Möchten Sie eine Decke?«
Der König antwortete nichts. Sivers erhob sich und kontrollierte, ob die Glasfenster auch fest verriegelt waren. Da fiel der Schuss.
»Sivers, Sie haben doch auch den Schuss gehört. Sollten Sie nicht um mein Leben besorgt sein?«
»Majestät, meine Polizeidiener halten Wache rund um den Palast und auf der Straße nach Stockholm. Man wird den alten Wolf erschossen haben, der sich hier herumtreibt.«
»Mein treuer Freund, wissen Sie denn nicht, dass wir heute ihren Leuten Urlaub gewährt haben. Mögen sie sich ruhig in der Stadt amüsieren. Nur wir beide sind hier – den Schützen da draußen kennen wir nicht. Mir scheint, der Vorhang hebt sich zu einem kurzweiligen Spiel.«
Der Polizeiminister wusste das Lächeln seines Herrn zu deuten. Keine Worte mehr, er verbeugte sich und ging ab.
Tagebucheintrag des Ersten Kammerherrn Hans von Essen
Mein Bericht muss heute kürzer ausfallen: Ich befinde mich äußerst unwohl, leide an Kopfschmerzen und Gliederreißen. Die lässige Adjustierung der Pagen wird mir immer mehr zur Last: Gerade an der Haupttreppe, auf welcher der König die Conduite der Jünglinge genauestens zu beachten pflegt, entdeckte ich gestern vor dem Diner abgerissene Knöpfe und mehrfach eine unzulässige Erweiterung der offiziellen Hoftracht mit französischen Seidenbändern in den unmöglichsten Farben. Natürlich war auch das modische Blau-Weiß-Rot der französischen Trikolore darunter. Mein Donnerwetter muss man von der Stiege bis hinunter in die Wache der Leibgardisten gehört haben. Jedenfalls wurde ich von den dummen Kerls aus den vornehmsten Häusern Schwedens länger auf der Treppe aufgehalten als mir lieb. Sie zieht die Luft von draußen in die erste Etage des Schlosses hinein, beinahe wie der Blasebalg der Orgel in der Tyska Kirkan – der Eishauch machte mir gleich zu schaffen.
Um sieben Uhr das Diner in kleinerem Service. Anwesende Mitglieder der königlichen Familie waren die Brüder seiner Majestät, die Herzöge Carl mit Gattin Hedvig Elisabeth und Herzog Frederik. Anwesende von Stand waren der Gesandte des Königreichs Neapel, dann Graf Gustav Mauritz Armfelt, Elis Schröderheim, Graf Axel von Fersen und Oberst Munck. Bereits nach dem Karpfen in Schwarzer Sauce befiel mich Schwindel, vom Hühnerfrikassee konnte ich nichts mehr zu mir nehmen. Der König schien von meiner Unpässlichkeit nichts bemerkt zu haben und zeigte sich in alter Frische. Als er mich mit seinen großen, klaren Augen anblickte, schämte ich mich meines Unwohlseins und dachte an das Wort des Beaumarchais: »Die Schweden werden seiner Weisheit und überlegenen Vernunft immer folgen.« Ach, wäre es nur so! Polizeimeister Sivers macht derzeit dunkle Andeutungen über eine bevorstehende Revolte in Adel und Offizierskorps. Er lässt aber niemanden von uns in seine Karten schauen. Der König selbst zeigte sich gestern davon völlig unbeeindruckt. Ihn beschäftigte nur die Lage in Frankreich, denn er ließ die Depesche unseres Gesandten in Paris, Baron Staël-Holstein, zwei Mal während des Diners rezitieren. Vielleicht hatte ich auch deshalb keinen Appetit auf das Frikassee, denn alles deutet darauf hin, dass man sich in Frankreich nicht mehr um die erst wenige Monate alte Verfassung schert. Wirrköpfe und schöngeistige Träumer arbeiten den Machtmenschen entgegen. Das Leben von König Ludwig ist weniger wert als das Papier, auf dem man dort die Gesetze schreibt. »Was heute in den Straßen von Paris zählt«, so schloss der Bericht, »sind die Gefühle der Menge, die sich durch die Flucht des Königs und der Königin nach Varennes verletzt sieht.«
Nach dem Vortrag stockte die Konversation. Graf Fersen, dem der König die Planung der gescheiterten Fahrt nach Varennes anvertraut hatte, sah man an, dass er am liebsten aufgesprungen wäre. Herzog Frederik lächelte süffisant, jeder weiß, dass er nach seiner gescheiterten Werbung um die Schwester des Grafen mit den Fersens noch eine Rechnung zu begleichen hat. Das Gesicht unseres edlen Monarchen war gerötet, als er sagte: »Marie-Antoinette, welch kluge und tolerante Königin, die Schönheit und Inspiration als das Wesentliche der condition humaine erkannt hat!«
Niemandem fiel nun eine passende Erwiderung ein. Da erhob sich der Gesandte des Königreichs Neapel: »Ein herrliches Bonmot, Sire, aber bedenken Sie, dass Sie es waren, der den Olymp von Geist und Geschmack in Stockholm errichtet hat!«
Der Einfaltspinsel hatte wohl zu dick aufgetragen, der König sank in seinen Stuhl zurück, die Farbe war ihm gänzlich aus dem Antlitz gewichen, sein Mundwinkel zuckte. Die Szene war mehr als peinlich, hatte sich der Gesandte doch eine anerkennende Replik erwartet. Graf Armfelt, geistesgegenwärtig wie immer, erhob sich: »Ein Toast auf die Königin Marie-Antoinette und zum Teufel mit den Philosophen. Sie sprechen über Toleranz und sind doch intoleranter als ein ganzes Kardinalskollegium!«
Der König fasste sich wieder oder, besser gesagt, spielte den charmanten Gastgeber, aber niemand konnte seine Angst übersehen, die Angst um das Leben von Königen.
Ich muss jetzt abbrechen. Lundgren meldet mir gerade den Doktor Salomon. Aber das Wichtigste, Schönste muss ich noch festhalten. Der König nahm mich knapp vor dem Aufbruch beiseite: »Seien Sie Schwede, Essen, überwinden Sie wie der alte Gustav die Widerstände, die sich Ihnen in den Weg stellen. In Ihrem Fall denke ich an die Eroberung der charmanten Gräfin Carlotta de Geer – unseren Segen haben Sie!«
1
Fritz Engelke, man merke, Leibbursche Fritz Engelke, balancierte ein Tablett mit Kaffee, Zwieback und Butter von der Offiziersmesse zur Kommandantur und rief dort mit vollem Bass: »Tür auf!« Wie so oft war er der Erste gewesen, der für seinen Herrn, Oberstleutnant Lilljehorn, das Frühstück ausgefasst hatte. Vielleicht gefiel er trotz seiner Glatze der drallen Küchenmagd, oder die tat ihm den Gefallen, weil sie aus Pommern war wie er und allein hier in Stockholm.
Die schweren Pranken des Fritz umklammerten das Geschirr, dass die Knöchel weißlich hervortraten, denn jetzt kam die steile Stiege, und die musste er rauf, ohne was zu verschütten. Pech, wenn ihm ausgerechnet jetzt einer der Herren Offiziere begegnete, das Salutieren und gleichzeitig das Servieren wollte ihm nicht in den Kopf. Rotgesichtig kletterte er Stufe um Stufe empor. Wenn er nur brav und laut genug daherpolterte, würde sein Herr ihn hören und ihm selbst die Tür öffnen, sollten die anderen nur witzeln, aber er log nicht, so war sein Herr.
Ein kalter Luftzug und das hohe Tor, das unten in der Vorhalle laut ins Schloss fiel, schließlich ein knapper Wortwechsel, das verhieß nichts Gutes. Umdrehen konnte er sich nicht, das war auch nicht nötig, denn die forschen Schritte auf der Stiege kamen gleichzeitig wie der Befehl: »Zur Seite, Mann!« Fritz presste sich an die Wand, um den diensthabenden Offizier passieren zu lassen. Danach kam ein junger Herr mit widerborstigem Haar, der aussah wie einer, der stets zuerst durch die Tür geht. Dahinter eine Frau, sie verbreitete einen Duft, der dem Mann den Verstand nimmt.
2
Carl Pontus Lilljehorn, Oberstleutnant der königlichen Leibgarde, war ein empfindsamer Mensch. Wie er die Monotonie des Militärdienstes verabscheute, so liebte er die Dichtung. Denn die große, erhabene Heimat fand er in den Versen Shakespeares, Ossians und Goethes. Nicht weniger liebte er seinen König Gustav III., der doch selbst Dichter war, und dessen Größe er nicht nach den Siegen auf dem Schlachtfeld, sondern nach dem Esprit seiner Dramen und Opern bemaß. Vielleicht schätzte der König ihn als seinesgleichen, denn eine geheime, segensreiche Macht hatte ihn, den unbedeutenden Freiherrn, über alle Intrigen hinweg immer wieder befördert. Konnte es Zufall sein, dass er im Russischen Krieg nie einen Angriff führen, nie meuternde Truppen zur nächsten Attacke zwingen musste? Während andere, ehrgeizigere Kameraden an dieser Tatenlosigkeit zerbrochen wären, sehnte sich Lilljehorn nach dem nächsten Sonett. Freilich – hinter seinem Rücken zerrissen sie sich die Mäuler: Lilljehorn sei Protegé des Königs, weil die Königinwitwe Lilljehorns Mutter zur Amme Gustavs bestimmt habe – Milchbruder Lilljehorn! Was wussten sie schon von der Macht der Poesie, davon, dass der König ihn sicherlich für höhere Aufgaben vorhergesehen hatte im unsterblichen Reich des Lichts und der Gedanken.
So dachte Lilljehorn, der im Grunde seines Herzens nicht nur ein empfindsamer, sondern auch ein einfacher Mann war. An diesem späten Novembermorgen des Jahres 1791 spähte er durch das Fenster in den Innenhof, ob Fritz sich nicht schon mit seinem Frühstück zeigte. Der Tag zog nebelig durch die Arkaden und Winkel des Schlosses. Ein paar Happen Zwieback und heißer Kaffee konnten da vor dem lästigen Besuch des Grafen Ribbing nicht schaden. Die Übersetzung von Goethes Werther ins Schwedische war ihm bis auf ein paar Tintenklecksern heute noch nicht gediehen, also wozu Konvention und liebenswürdige Artigkeiten.
Endlich stapfte Fritz die Treppe herauf, doch Lilljehorn unterschied auch andere Schritte, und ihm war klar, dass Frühstück und Werther für heute verloren waren. Rasch postierte er sich hinter seinem Schreibpult und kritzelte immer noch Wort und Wörter, als der Offizier schon längst salutiert hatte. Er meldete ihm die Ankunft von Graf Adolf Ludwig Ribbing und Gräfin Carlotta de Geer. Man lässt bitten, aber Ribbing steht schon da. Er füllt den Raum der Kommandantur. Der feine Zobel seines Mantels reflektiert die Schneekristalle, die gleich als Wassertropfen zu Füßen des Grafen eine Pfütze bilden würden. Lilljehorn, von dem ironischen Lächeln des Grafen und der anschwellenden Wasserlache gleichermaßen verunsichert, bleibt hinter seinem Pult.
»Verehrter Lilljehorn, es ist mir eine vorzügliche Ehre, Ihnen die Gräfin De Geer vorstellen zu dürfen. Ich habe ihr schon oft vom dichtenden Offizier erzählt, unserem Homme de lettres unter den Augen und Ohren des Königs.«
Lilljehorn brachte trotz der Enge der Stube einen passablen Kratzfuß zustande, obwohl – worauf spielte Ribbing an?
»Mein lieber Oberstleutnant«, die Gräfin legte ihre Hand auf seinen Unterarm, »schon seit Tagen freue ich mich auf das Vergnügen, mit Ihnen die Schönheit unserer Heimat zu empfinden. Mein Gefährte hat von einer Tour gesprochen. Aber Sie sind noch in Uniform?«
Es war das erste Mal, dass Carlotta ihn sah und gleich »lieber Oberstleutnant« nannte. Es stimmte. Ribbing hatte ihn am Montag, als sich abzeichnete, dass die harte Schneedecke eine Schlittenfahrt erlauben würde, zu einer Tour in das Solnaer Holz eingeladen. Eine Begleitung der Gräfin war aufgrund ihrer Verpflichtungen am Hof aber nie erwähnt worden.
Zu Ribbing gewandt: »Aber Graf, bedrängen Sie den Oberstleutnant nicht mit Ihren Komplimenten. Die Herzen der Dichter lieben den Schleier des Verborgenen. Und überhaupt – dichtender Offizier, ist das nicht etwas degoutant, da wir unter einem dichtenden König leben?«
»Meine Freundin, Sie sind wie immer im Recht« – er deutet einen Handkuss in Richtung Carlotta an. »Streiten wir uns nicht, sonst verkommt uns Lilljehorn noch hier in seiner Stube. Also, mein Freund, hinaus in die Freiheit!«
Lilljehorn schloss das Tintenfass und sperrte das Manuskript in den Sekretär. Fritz half seinem Herrn in die Stiefel, richtete Pistolen und Mantel. Als die Herrschaften aufgebrochen waren, suchte er einen Lappen, um den verschütteten Kaffee aufzuwischen.
Der Schlitten des Grafen wartete unmittelbar vor dem Eingang zur königlichen Wache. Sein schneebedecktes Verdeck hob sich im fahlen Vormittagslicht kaum vom Innenhof des Schlosses ab. Nach einem farbentrunkenen Herbst war in diesem November des Jahres 1791 der Winter rasch und hart gekommen. Ribbing hatte sich für den Freitag im Mietsstall des Olof Engzell einen Zweispänner reserviert und am Vortag seinen Knecht Norberg mit zwei Pferden von seinem Gut nach Stockholm vorausgeschickt. So war alles vereinbart worden, doch warum hatte er die Gräfin mitgebracht? Ihr »lieber Lilljehorn« begleitete den Oberstleutnant an den Wachposten vorbei, dämpfte den Peitschenknall Norbergs. Auf weißer Watte glitt der Schlitten vom Slottsbaken über den Vedgardsbron hinunter nach Norrmalm. Carlotta saß Lilljehorn gegenüber. Ihre Blicke ruhten auf dem Oberstleutnant, zwei grüne Augen, zwei Degenstiche.
Lilljehorn schenkte den winterlichen Gassen der Königsstadt keine Aufmerksamkeit. Was hätte er in Norrmalm schon gesehen? Die Steinblöcke vor dem neuen Opernhaus warteten auf ihre Verwendung für ein weiteres Theater, ein Handelskontor oder für das neue Schloss des Königs in Haga, das die Pracht seiner dorischen Fassade auf den Brunnsviken werfen und ihn endgültig zu einem Heiligtum der Schönheit adeln würde. Dann Schankjungen, kaum älter als zwölf, die wie jeden Morgen vor ihren Kneipen den Schnee fegten, umgeben von einem Gestank aus Aquavit und Erbrochenem. Eine farblose Herde von Dienstboten mit ihren Wäschebutten und Holzkörben, Bettler, die sich um offene Feuerstellen drängten und sich mit Tritten gegen Straßenköter zur Wehr setzten. Herren von Stand in Pelz und Seide auf dem Weg zur morgendlichen Aufwartung in den hohen Häusern. In den besseren Schenken servierten die Mägde Kaufleuten aus Stockholm, Danzig und England Kalte Platten mit Austern.
Am Ende von Norrmalm führte die Straße nach dem Stalmastergarden in einer weit gezogenen Linkskurve ins Weide- und Bauernland. Der Kutscher hatte Mühe, die Pferde in der Mitte des Weges zu halten, um dem Straßengraben auszuweichen. Sie fuhren langsamer. Bauernhäuser mit rot gestrichenen Holzbrettern unterbrachen das weiße Einerlei, mit ihren klapprigen Zäunen bildeten sie lächerliche Verwerfungen in der weißen Weite.
Ribbing holte aus dem Korb zu seinen Füßen eine Flasche Champagner hervor. »In Frankreich, sagt man, köpft man sie mit dem Säbel, aber hier ist es für einen Hieb wohl zu eng. Wie überhaupt in Schweden.« Den Knall des Korken milderte er mit seinem Bisammuff. »Courage, mein schweigsamer Colonel! Dieser Tropfen wird Sie inspirieren.«
»Sie erwähnen Frankreich. Alle Welt blickt derzeit dorthin, aber wenn ich durch unser armes Schweden fahre, will mir die parfümierte Aufgeregtheit dieses Volkes doch exotisch erscheinen. Man kommt ins Grübeln. Sehen Sie da draußen die einfachen Häuser armer Leute. Meinen Sie, Rousseau, Voltaire, Raynal, und wie sie alle heißen, haben jemals für ein Volk empfunden? Ja, sie denken über Völker nach, aber im Grunde ist ihnen doch ein geschliffenes Bonmot mehr wert als ein ganzes Dorf. Als Günstlinge des Adels spucken sie in die Hand, die sie füttert. Auch unser König hat das erkannt. Das Neue muss aus dem Volk kommen, aus seinen tiefen Empfindungen. Daher seine schwedischen Theater, seine Akademie.«
»Aber Lilljehorn, Sie reden sich in Rage. In Frankreich geht es den alten Zöpfen nun an den Kragen, man atmet freiere Luft. Und bei uns, was ist denn besser geworden? Am letzten Reichstag hat unser erlauchter Landesherr den Adel entmachtet. Will er denn mit Bauern regieren? Wer sind denn Ihre schwedischen Bauern? Blicken sie geistig über Uppland hinaus?«
»Mon cher Louis«, ließ sich Carlotta vernehmen, »Sie reden ja wie einer dieser Poeten aus Deutschland. Aber im Ernst, was kann man denn tun, als Haltung zeigen, wenn sich der Pöbel rührt. Sollten sie mir den Kopf abschlagen, so hoffe ich doch, dass ich ein harmonisches Ensemble für mein Büßerkleid gewählt habe. Apropos Farbe, mein lieber Lilljehorn, Ihr blauer Frack mit gelber Weste nach der Fasson des armen Werther – Sie erlauben meine offenen Worte –, doch sehr direkt, nicht wahr?«
Lilljehorn hätte sich den Kopf vor Wut einstoßen mögen. Erst jetzt fiel ihm das changierende Resedagrün des Kleides der Gräfin auf, vor dem sich ihr weiß gepudertes Dekolleté makellos abhob.
»Lassen Sie uns von angenehmeren Dingen sprechen, meine Herren. Graf Armfelt soll ja Herzog Carl nun endgültig in der Gunst bei Madame Rudenschöld übertroffen haben. Der Herzog trägt’s mit Fassung, seine Gattin weniger, da er seine Aufmerksamkeit nun ganz ihr zuwendet, was sie doch einigermaßen langweilt. Vergleicht man Carl mit seinem Bruder Frederik, dann ist dieser doch ein armer Tropf: Er gab den zerknirschten Jüngling, als ihn die Fersen sitzen ließ, wirklich sitzen ließ. Stellen Sie sich die Komödie vor: Frederik geht zum älteren Bruder, unserem Gustav, bittet ihn, sechsspännig bei den Fersens vorzufahren und den Brautwerber zu spielen. Der König tut ihm den Gefallen, kommt zu den Fersens. Dort ist man loyal, der alte Fersen bittet die Majestät mit Brüderchen devot zum Tee. Frederik und die Fersen verschwinden in ihrem Boudoir, der Prinz kommt errötet zurück, die Fersen will nicht ins Königshaus heiraten. Der alte Fersen fragt, ob man Majestät noch Zucker reichen dürfte, die Jugend sei eben eigensinnig, da ließe sich nichts machen. Die Fersen bleibt in ihren Gemächern, König und Brüderchen fahren zurück ins Königsschloss, Vorhang fällt. Darüber sollten Sie schreiben, Lilljehorn!«
Lilljehorn versuchte eine Entgegnung, hatte sich die Worte auch schon zurechtgelegt, als der Schlitten sich stark nach rechts neigte und völlig zum Stehen kam.
»Norberg, du versoffener Tölpel!«, brüllte Ribbing, »kannst du nicht auf dem Weg bleiben?«
»Verzeihen Sie, Herr, der Schlitten ist mir auf einer Schneewechte weggerutscht.«
Ribbing und Lilljehorn kletterten aus dem Fuhrwerk. Sie befanden sich jetzt mitten im Solnaer Wald, aus dem sich der Morgennebel noch nicht gehoben hatte. Mitten auf dem Weg türmte sich ein Hügel aus Eis und Schnee auf – braun gesprenkelt und härter als der umliegende Neuschnee. Der Oberstleutnant kniete nieder, um sich ein Bild zu machen, wie man den Schlitten wieder in die Spur heben könnte. »Wir waren nicht die Ersten. Sehen Sie die Mulden im weichen Schnee, die Vertiefungen, die Fußspuren? Wir tun gut daran, rasch wegzukommen. Der Schneehügel wurde absichtlich zusammengetragen. Man will unvorsichtigen Fuhrwerken auflauern.«
»Ich führe immer zwei Pistolen mit mir«, entgegnete Ribbing, »und werde den Banditen mit meinem Blei die Haut gerben.«
»Ich möchte Sie schon im Interesse der Gräfin bitten, zuerst den Schlitten flottzubekommen.«
Auf einen Wink Ribbings versuchte der Kutscher mit einem Fichtenast als Hebel den Schlitten so weit zu heben, dass die Pferde ihn ein Stück zur Wegmitte ziehen konnten. Doch beim ersten Versuch brach der Ast an der Stelle entzwei, wo Norberg ihn am Schlitten angesetzt hatte. Als Ribbing dem Kutscher eine Ohrfeige geben wollte, ertönte der erste Pfiff. Ein kurzes, sich einmal senkendes, dann wieder steigendes Signal. Was der Kutscher nun tat, hätte niemand erwartet, am allerwenigsten die Gräfin, deren Kopfschmuck am Fenster sichtbar wurde. Bedächtig lehnte Norberg sich mit dem Rücken gegen den Schlitten, vergrub beide Hände im Schnee, fasste die eingesunkene Kufe und hob das Fahrzeug langsam in die Waagrechte. Für einen Augenblick verschwand die Perücke der Gräfin vom Fenster. Zweiter Pfiff. Lilljehorn ließ geistesgegenwärtig die Peitsche über den Pferden knallen. Sie fassten Fuß und zogen den Schlitten ruckartig in die Spur. Die Tiere dampfen, der Kutscher sitzt schon auf dem Bock. Ribbing und sein Gast schwingen sich auf das Trittbrett des jäh anfahrenden Schlittens. Da lösen sich aus dem nebeligen Umkreis der Baumriesen konturlose Gestalten. Sie johlen, pfeifen. Es fliegen Äste und Knüppel, die aber die Kutsche verfehlen. Ribbing feuert seine Pistolen ab. Die Pfiffe werden leiser.
Was Lilljehorn in Erinnerung blieb, waren weniger die unflätigen Beschimpfungen als der ohnmächtige Hass, der dem Schlitten und seinen Insassen noch anhaftete, als die Reisenden ihr Ziel, die Schenke »Zum Bacchusjünger«, schon sicher erreicht hatten.
Bericht des Polizeimeisters Sivers an Graf Armfelt
Exzellenz, meine Informanten berichten von Unruhen in der Provinz Östergötland. Bauern haben auf dem Fahrweg des Grafen Horn Seile gespannt, um seinen Schlitten aufzuhalten. Der Graf konnte sich mit gezogenem Säbel gerade noch freie Bahn verschaffen. Die Informanten erklären, der Graf habe die Arbeitszeit in seinen Berggruben auf zwölf Stunden erhöht und bezahle mit Papiergeld.