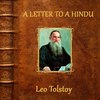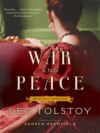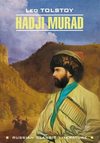Czytaj książkę: «Anna Karenina, 2. Band», strona 39
6
Da Sergey Iwanowitsch nicht wußte, wann er Moskau würde verlassen können, hatte er nicht an seinen Bruder telegraphiert, daß man ihn abhole.
Lewin war nicht daheim, als Katawasoff und Sergey Iwanowitsch in einem kleinen Tarantaß, der auf der Station gemietet worden war, staubbedeckt wie Araber um zwölf Uhr mittags vor der Freitreppe des Herrenhauses von Pokrowskoje vorfuhren.
Kity, welche mit ihrem Vater und der Schwester auf dem Balkon gesessen hatte, erkannte den Schwager und eilte hinunter, ihn zu bewillkommen.
„Wie unrecht von euch, uns nicht Nachricht zu geben,“ sagte sie Sergey Iwanowitsch die Hand reichend und ihm die Stirn darbietend.
„Wir sind ganz wohlbehalten hierher gelangt und haben euch nicht erst Umstände gemacht,“ antwortete Sergey Iwanowitsch. „Ich bin so voll Staub, daß ich mich fürchte, jemand anzurühren. Ich war auch so beschäftigt, daß ich nicht einmal wußte, wann ich mich würde losmachen können. Aber ihr haltet es nach altgewohnter Weise,“ lächelte er, „ihr freut euch eures stillen Glückes fern von Zeitläuften in eurem stillen Heim. Da hat sich auch mein Freund Fjodor Wasiljewitsch endlich mit aufgemacht.“
„Ich bin indessen kein Neger, sondern werde mich waschen – und dann einem Menschen ähnlich sehen,“ sagte Katawasoff mit seinem gewohnten Humor, einen Händedruck wechselnd und mit seinen schimmernden Zähnen in dem geschwärzten Gesicht eigentümlich lächelnd.
„Mein Konstantin wird sich sehr freuen. Er ist nach dem Vorwerk hinaus und muß bald kommen.“
„Er beschäftigt sich nur mit der Landwirtschaft; so macht man es eben hier,“ sagte Katawasoff, „bei uns in der Stadt aber ist außer dem serbischen Kriege auch nichts weiter zu sehen. Wie geht es denn meinem Freunde? Was macht er? Ein wenig Sonderling, nicht?“ —
„Nun, ja, ein wenig;“ antwortete Kity etwas verlegen werdend, mit einem Blick auf Sergey Iwanowitsch, „doch ich will nach ihm schicken. Auch Papa ist bei uns auf Besuch. Er ist erst unlängst aus dem Ausland angekommen.“
Nachdem Kity befohlen hatte, nach Lewin zu schicken, die staubbedeckten Gäste zur Toilette zu führen, den einen in das Kabinett, den anderen in Dollys ehemaliges Zimmer, und ein Frühstück für sie zu servieren, eilte sie, wieder in dem Vollbesitz hurtiger Beweglichkeit, dessen sie in der Zeit ihrer Schwangerschaft beraubt gewesen war, auf den Balkon hinauf.
„Es ist Sergey Iwanowitsch und Katawasoff, der Professor,“ sagte sie.
„O weh,“ sagte der Fürst.
„Er ist aber sehr liebenswürdig, Papa, und Konstantin hat ihn sehr lieb,“ sagte Kity lächelnd, ihm gleichsam zuredend, indem sie den Ausdruck von Ironie auf dem Gesicht des Vaters bemerkte.
„Nun, meinetwegen.“
„Geh doch zu ihnen Herzchen,“ wandte sich Kity zu ihrer Schwester, „und unterhalte sie. Sie haben Stefan auf der Station gesehen, er befindet sich wohl. Ich aber will zu Mita laufen. Wie unangenehm aber, ich habe seit dem Thee nicht wieder angelegt. Der Kleine wird jetzt wach geworden sein und wahrscheinlich schreien,“ und mit schnellen Schritten ging sie, den Andrang der Milch verspürend, nach der Kinderstube.
Sie hatte in der That den Andrang der Milch nicht bloß vermutet – sie legte das Kind noch an – sondern kannte an dem Andrang der Milch bei ihr die Zeit des Bedürfnisses bei demselben genau.
Sie wußte, daß der Kleine schrie, noch bevor sie zur Kinderstube gelangt war. Und wirklich schrie er. Sie vernahm seine Stimme und beschleunigte ihren Schritt, aber je schneller sie ging, um so lauter schrie das Kind. Seine Stimme war gut, gesund, nur hungrig und ungeduldig.
„Schreit es schon lange?“ frug Kity eilig die Kindermuhme, sich auf einen Stuhl setzend und zum Anlegen vorbereitend. „Gebt es schnell her. Ach, Muhme, wie langweilig Ihr doch seid; nun, bindet doch das Häubchen später!“
Das Kind zappelte schreiend vor Gier.
„Das geht aber nicht, Matuschka,“ sagte Agathe Michailowna, die fast stets in der Kinderstube zugegen war. „Man muß es hübsch ordentlich putzen;“ „Eia, eia“, sang sie über dem Kinde, ohne von der Mutter Notiz zu nehmen.
Die Kinderfrau trug das Kind zu der Mutter. Agathe Michailowna folgte ihm mit vor Zärtlichkeit leuchtenden Zügen.
„Er weiß es ja, er weiß es; glaubt mir bei Gott, Matuschka Katharina Aleksandrowna, er hat mich erkannt!“ rief Agathe Michailowna dem Kinde zu.
Doch Kity hörte ihre Worte nicht. Ihre Ungeduld war ebenso hoch gestiegen, wie die des Kindes, und vor Ungeduld wollte die Sache lange nicht von statten gehen. Das Kind faßte nicht, wo es fassen sollte und wurde ungebärdig.
Endlich aber, nach einem verzweifelten, erstickten Schrei und hohlklingenden Schmatzen war es gelungen, und Mutter wie Kind fühlten sich gleichzeitig befriedigt und wurden still.
„Er ist doch ganz in Schweiß gebadet, der arme Kleine,“ sprach Kity, das Kind befühlend. „Weshalb denkt Ihr denn, daß das Kind euch kennt?“ fügte sie hinzu, seitwärts auf die verschmitzt, wie ihr schien, unter dem emporgerückten Häubchen hervorschauenden Äuglein des Kindes, die taktmäßig schwellenden Bäckchen und sein Ärmchen mit der roten Hand blickend, mit dem es kreisende Bewegungen machte. „Kann nicht sein! Wenn es schon jemand erkännte, so müßte es mich erkennen,“ sagte Kity auf die Versicherung Agathe Michailownas hin und lächelte.
Sie lächelte darüber, daß sie, wenn sie auch sagte, es könne noch niemand erkennen, in ihrem Herzen wußte, es kenne nicht nur Agathe Michailowna, sondern wisse und verstehe alles, wisse und verstehe noch mehr von Dingen, die niemand kenne, und die nur sie, die Mutter selbst, nur dank dem Kinde kennen lernte und begriff. Für Agathe Michailowna, die Kinderfrau, den Onkel und selbst ihren Vater war der kleine Mitja nur ein lebendiges Wesen, welches für sich lediglich materielle Pflege verlangte, aber für die Mutter war es schon längst ein Geschöpf mit Charakter, in dem sich bereits eine ganze Geschichte seelischer Beziehungen abgespielt hatte.
„Er erwacht, gebe Gott, daß Ihr es selbst seht! Wenn ich es so mache, glänzt er nur so auf, der Liebling. Er glänzt so auf wie der helle Tag,“ sprach Agathe Michailowna.
„Nun gut, gut: wir werden ja dann sehen,“ flüsterte Kity, „geht jetzt; der Kleine schläft ein.“
7
Agathe Michailowna ging auf den Zehen hinaus, die Kinderfrau ließ die Gardinen herab, verscheuchte die Fliegen aus dem nesseltuchenen Wiegenvorhang des Bettchens und eine Bremse, die sich am Fensterrahmen stieß und setzte sich, mit einem welken Birkenzweig der Mutter und dem Kinde zufächelnd.
„Die Hitze, die Hitze; wenn doch Gott Regen gäbe,“ sprach sie.
„Ja, ja, sch – sch – sch,“ antwortete Kity nur, das dralle Ärmchen, welches Mitja noch immer leise bewegte indem er die Äuglein bald öffnete, bald schloß, leicht schüttelnd und zärtlich drückend.
Dieses Händchen machte Kity unentschlossen; sie wollte es küssen, scheute sich aber, es zu thun, um das Kind nicht zu wecken. Das Ärmchen hörte endlich auf, sich zu bewegen und die Äuglein schlossen sich. Nur bisweilen erhob das Kind, seine Thätigkeit fortsetzend, die langen gebogenen Wimpern und blickte die Mutter mit seinen in der Dämmerung schwarz erscheinenden, feuchtschimmernden Augen an.
Die Kinderfrau hörte auf zu fächeln und begann zu träumen. Von oben wurde das Lachen der Stimme des alten Fürsten und Katawasoffs vernehmbar.
„Sie sind auch ohne mich in Unterhaltung gekommen,“ dachte Kity, „aber es ist doch ärgerlich, daß Konstantin nicht da ist. Er wird wohl wieder nach dem Bienengarten gegangen sein. Obwohl ich beklage, daß er so oft dort ist, freue ich mich doch auch, denn es zerstreut ihn. Er ist jetzt viel heiterer und angenehmer geworden, als er im Frühjahr war. War er doch sonst immer so finster und peinigte sich, daß es mir recht bang um ihn wurde. Und wie komisch er ist!“ flüsterte sie lächelnd.
Sie wußte, was ihren Mann quälte; es war sein Unglaube. Obwohl Kity, wenn man sie gefragt hätte, ob sie überzeugt sei, daß er, im Falle seines Unglaubens im ewigen Leben der Vernichtung anheimfallen werde, hätte einverstanden damit sein müssen, daß er untergehe – so bildete sein Unglaube doch kein Unglück in ihren Augen, und sie gedachte, obwohl sie sich zugestand, daß es für den Ungläubigen kein Seelenheil geben könne, und die Seele ihres Mannes über alles in der Welt liebend, mit Lächeln seines Unglaubens, und sagte sich selbst, er sei komisch.
„Wozu studiert er ein ganzes Jahr hindurch nur Philosophie,“ dachte sie. „Wenn dies alles in jenen Büchern geschrieben steht, dann kann er sie auch verstehen. Wäre Unrichtiges darin, wozu sollte er sie dann lesen? Er selbst sagt, daß er glauben möchte. Weshalb glaubt er dann nicht? Gewiß deshalb, weil er zu viel denkt? Aber er denkt zu viel wegen seiner einsamen Lebensweise. Er ist stets, stets einsam. Mit uns kann er freilich nicht von allem reden. Ich denke aber, der Besuch wird ihm willkommen sein, besonders Katawasoff. Er liebt es, mit ihm zu disputieren,“ dachte sie und versetzte sich dann sogleich in den Gedanken, wo sie gerade Katawasoff am bequemsten zum Schlafen unterbringen könne – separat oder zusammen mit Sergey Iwanowitsch? Und dann kam ihr plötzlich wieder ein Gedanke, der sie vor Aufregung erzittern ließ und selbst Mitja erschreckte, der sie dafür ernst anblickte. „Die Wäscherin scheint die Wäsche noch nicht gebracht zu haben und für die Gastbetten ist noch keine Bettwäsche da. Wenn man da nicht anordnet, wird Agathe Michailowna dem Sergey Iwanowitsch gewöhnliche Wäsche geben,“ und bei diesem Gedanken stieg Kity das Blut ins Gesicht. „Ja, ich muß es anordnen,“ beschloß sie, und besann sich dann, wieder zu ihrem vorigen Gedanken zurückkehrend, daß etwas Wichtiges doch noch nicht bis zum Schluß von ihr überdacht sei. Sie sann nun nach, was es gewesen war. „Ach ja, Konstantin ist ungläubig!“ sagte sie, abermals lächelnd. „Nun, also ungläubig! Mag er lieber stets so bleiben, als so werden, wie Madame Stahl war, oder ich im Auslande einmal werden wollte. Nein er kann nicht mehr heucheln!“ Ein Zug von seiner Güte tauchte aus jüngster Zeit lebendig vor ihr auf.
Vor vierzehn Tagen war ein reuiges Schreiben Stefan Arkadjewitschs an Dolly angekommen. Stefan beschwor diese darin, seine Ehre zu retten, und ihr Gut zu verkaufen, damit er seine Schulden bezahlen könne.
Dolly war in Verzweiflung; sie haßte ihren Mann, verachtete und beklagte ihn, und entschloß sich zur Scheidung, wollte sich von ihm lossagen, willigte aber schließlich doch in den Verkauf eines Teils ihres Gutes ein. Und nun vergegenwärtige sich Kity mit unwillkürlichem, gerührtem Lächeln die Ratlosigkeit ihres Gatten, seine mehrmaligen unbeholfenen Anläufe in dieser Sache, die ihm am Herzen lag, und wie er endlich, als einziges Mittel, Dolly zu helfen, ohne sie zu verletzen, den Ausweg erdacht hatte, Kity vorzuschlagen, sie möchte ihr Teil an dem Vermögen – sie selbst hatte vorher gar nicht hieran gedacht – hingeben.
„Was wäre das für ein Ungläubiger? Mit solchem Herzen, solcher Besorgnis, einen Menschen zu verletzen, ja nur ein Kind! Alles thut er für seine Nächsten, nichts für sich! Sergey Iwanowitsch denkt, es sei Konstantins Pflicht, für ihn den Verwalter zu spielen. Auch seine Schwester denkt so. Jetzt befindet sich Dolly mit ihren Kindern unter seiner Vormundschaft. Alle die Bauern, welche täglich zu ihm kommen, ist er gleichsam verpflichtet zu bedienen. Bleibe du nur so,“ fuhr sie fort, Mitja der Kinderfrau übergebend und des Kindes Wange mit ihren Lippen berührend.
8
Seit jener Minute, da Lewin beim Anblick des geliebten sterbenden Bruders zum erstenmal auf die Frage des Lebens, wie des Todes durch jene – wie er sie nannte – neuen Überzeugungen hindurchblickte, die, unmerklich für ihn, während der Zeit von seinem zwanzigsten bis zum vierunddreißigsten Jahre, seine Überzeugungen aus der Kinderzeit wie die seines Jünglingsalters ausgelöst hatten, erschrak er nicht so sehr vor dem Tode, als vor einem Leben, über das er nicht die geringste Kenntnis, woher es stamme, warum es sei und was es sei, besäße.
Der Organismus, die Verrichtungen desselben, die Unerschöpflichkeit der Materie, das Gesetz der Erhaltung der Kraft, die Entwicklung – so lauteten die Begriffe – die für seinen alten Glauben eingetreten waren.
Diese Worte und die mit ihnen verbundenen Vorstellungen waren recht gut für Verstandeszwecke, für das Leben aber ergaben sie nichts und Lewin fühlte sich plötzlich in der Lage eines Menschen, der einen warmen Pelz für einen Kattunanzug vertauscht hat, und zum erstenmal in der Kälte untrüglich, nicht durch logische Erwägungen, sondern in seiner ganzen Wesenheit davon überzeugt wird, daß er geradezu nackt und einem unvermeidlichen, qualvollen Untergang verfallen sei.
Seit jener Minute hatte Lewin, ohne sich indessen davon Rechenschaft zu geben, und indem er sein Leben wie bisher fortsetzte, fortwährend diese Angst über sein Nichtwissen empfunden.
Außerdem aber empfand er voll Unruhe, daß das, was er seine Überzeugungen nannte, nicht nur Unwissenheit war, sondern eine Richtung im Denken, unter welcher ihm die Erkenntnis dessen, was ihm nötig war, unmöglich wurde.
In der ersten Zeit hatte seine Heirat, sowie ungekannte Freuden und Pflichten die er dabei kennen lernte, diese Gedanken vollständig in ihm erstickt, aber seit kurzem, nach der Niederkunft seiner Frau, während er müßig in Moskau gelebt hatte, war bei Lewin immer häufiger, und immer nachdrücklicher, diese Frage, eine Entscheidung verlangend, aufgetaucht. Die Frage bestand für ihn hierin: „Wenn ich jene Antworten nicht anerkenne, die das Christentum auf die Fragen über mein Leben erteilt, welche Antworten erkenne ich dann an?“ Und in dem gesamten Arsenal seiner Überzeugungen vermochte er weder die geringste Antwort zu finden, noch etwas, was einer solchen ähnlich gewesen wäre.
Er befand sich in der Lage eines Menschen, der Nahrung sucht in Spielzeugmagazinen oder Waffenläden.
Unwillkürlich und ihm selbst unbewußt suchte er jetzt in jedem Buche, bei jedem Gespräch, in jedem Menschen Beziehungen zu diesen Fragen und Lösungen derselben.
Am meisten setzte ihn hierbei der Umstand in Zweifel, daß die Mehrzahl der Menschen seines Kreises und Alters, die doch ebenso wie er, frühere Überzeugungen mit eben solchen neuen vertauscht hatten, wie er sie besaß, hierin kein Unglück sehen, sondern vollkommen zufrieden und ruhig waren, und so kam es, daß Lewin neben der Hauptfrage auch noch Nebenfragen quälten. Ob diese Menschen aufrichtig waren? Ob sie sich nicht verstellten? Oder ob sie etwa anders als er, klarer, die Antworten aufgefaßt hatten, welche die Wissenschaft auf die ihn beschäftigenden Fragen gab? Geflissentlich studierte er die Meinungen dieser Menschen und die Bücher, welche diese Antworten gaben.
Eins, was er seit der Zeit, seit der ihn diese Fragen beschäftigt, gefunden hatte, war dies, daß er sich geirrt habe in jener Annahme, die noch auf den Erinnerungen aus dem Jünglingskreis auf der Universität beruhte, die Religion habe sich überlebt und existiere gar nicht mehr. Sowohl der alte Fürst, wie Lwoff, den er so lieb gewonnen hatte, und Sergey Iwanowitsch und alle Frauen, auch sein Weib, glaubten so, wie er in seiner Kindheit geglaubt hatte; neunzig Hundertstel des russischen Volkes, ja, jenes ganze Volk, dessen Leben ihm die höchste Achtung einflößte, glaubte.
Ein Zweites war dies, daß er sich nach der Lektüre vieler Bücher überzeugt hatte, die Menschen, die mit ihm gemeinsame Anschauungen hatten, könnten sich unter diesen nichts anderes denken, und verneinten jene Fragen einfach, ohne sie zu erklären, jene Fragen, ohne deren Beantwortung er – er fühlte es – nicht leben könne, und bemühten sich, ganz andere dafür zu lösen, die seine Fragen gar nicht interessieren konnten, wie zum Beispiel die über die Entwicklung der Organismen, über die mechanischen Offenbarungen der Seele u. s. w.
Außerdem hatte sich aber noch während der Niederkunft seiner Frau etwas für ihn Ungewöhnliches ereignet. Er hatte dabei, ohne Glauben, zu beten begonnen und während der Minute in der er betete, auch geglaubt. Diese Minute war indessen vorübergegangen und er vermochte jener Stimmung von damals in seinem Leben nicht wieder stattzugeben.
Er vermochte nicht zuzugestehen, daß er damals das Rechte erkannt habe, jetzt aber irre; weil ihm, sobald er ruhig darüber nachzudenken begann, alles in Trümmer fiel. Er vermochte auch das nicht zuzugestehen, daß er damals geirrt habe, weil er seine seelische Stimmung von damals hochschätzte, während, indem er sie für eine Folge seiner Schwachheit anerkannte, jene Minuten entweiht haben würde.
Er befand sich in einer qualvollen Disharmonie mit sich selbst und spannte alle Geisteskräfte an, aus derselben herauszukommen.
9
Diese Gedanken peinigten und quälten ihn bald mehr, bald weniger, nie aber verließen sie ihn ganz. Er las und dachte, und je mehr er las und sann, desto weiter entfernt von dem verfolgten Ziele fühlte er sich.
Nachdem er sich in jüngster Zeit in Moskau und auf dem Dorfe überzeugt hatte, daß er bei den Materialisten keine Antwort finden werde, las er immer aufs neue wieder Plato und Spinoza, Kant, Schelling, Hegel und Schopenhauer, die Philosophen, welche das Leben nicht materialistisch erklärten. Diese Ideen erschienen ihm fruchtbringend, mochte er nun lesen, oder selbst Gegengründe gegen die Lehren anderer aussinnen, insbesondere gegen die materialistischen. Doch kaum hatte er gelesen und sich selbst eine Antwort auf die Fragen ausgedacht, da wiederholte sich bei ihm stets ein und dasselbe. Indem er der gegebenen Bestimmung unklarer Begriffe, wie „Geist, Wille, Freiheit, Substanz“ folgte und absichtlich in die Wörterfalle ging, die ihm die Philosophen oder auch er selbst sich gestellt hatte, begann er einigermaßen zu begreifen.
Aber er brauchte nur den künstlichen Gedankengang zu vergessen, und sich zu dem zu wenden, was im Leben befriedigte, wenn er dem gegebenen Faden folgend, nachdachte – und plötzlich stürzte der ganze kunstvolle Bau zusammen wie ein Kartenhaus, und es wurde ihm klar, daß der Bau aus denselben Worten bestand, die nur umgestellt, und unabhängig waren von Etwas, das im Leben viel bedeutungsvoller war, als der Verstand.
Bei der Lektüre Schopenhauers setzte er einmal an Stelle des Begriffs eigner Wille, den der Liebe, und diese neue Philosophie machte ihm zwei Tage lang, so lange er sich mit ihr beschäftigte, Vergnügen. Sie fiel aber gleichsam zusammen, als er darauf aus dem Leben heraus auf sie blickte, und es zeigte sich wieder jenes kattunene Gewand, das nicht warm hielt.
Sein Bruder Iwanowitsch riet ihm, die theologischen Werke Chomjakoffs zu lesen. Lewin las den zweiten Band derselben und war, ungeachtet der ihn anfangs abstoßenden, polemischen, eleganten und scharfsinnigen Diktion, überrascht von Chomjakoffs Lehrmeinung über die Kirche. Ihn überraschte anfangs die Idee, daß die Erlangung der göttlichen Wahrheiten dem Menschen nicht verliehen sei, sondern nur einer Gemeinschaft von Menschen, vereint in der Liebe – der Kirche.
Er freute sich bei dem Gedanken, wie viel leichter es wäre, an eine vorhandene, gegenwärtig lebendige Kirche zu glauben, welche alle Glaubensbekenntnisse der Menschen in sich begreife, und Gott zum Haupte habe, infolge dessen aber heilig und unfehlbar sei, und von ihr nun den Glauben an Gott erst zu empfangen, den an die Schöpfung, den Sündenfall, und die Erlösung – als wenn man mit Gott, dem weit entfernten, geheimnisvollen Gott, der Schöpfung &c. begänne.
Als er nun aber dann die Kirchengeschichte eines katholischen und die eines rechtgläubigen Schriftstellers las und gewahrte, daß beide Kirchen, jede unfehlbar in ihrem Wesen, sich gegenseitig negierten, da verzweifelte er auch an Chomjakoffs Kirchenlehre und das ganze Gebäude wurde von dem gleichen Staub bedeckt, wie die philosophischen Gebäude.
Während dieses ganzen Frühlings hatte er so mit sich selbst im Kampfe gelegen und schreckliche Augenblicke durchlebt.
„Ohne zu wissen, was ich bin und warum ich hier bin – kann man nicht leben! Erfahren aber kann ich es nicht, folglich kann ich nicht leben,“ sprach Lewin zu sich selbst. „In der Unendlichkeit der Zeit, der Unendlichkeit des Stoffes, der Unendlichkeit des Raumes bildet sich die organische Zelle; dieses Bläschen wird eine Zeitlang bestehen und dann zerplatzen; – das bin ich.“
Dies bildete das einzige Resultat jahrhundertelanger menschlicher Denkarbeit nach dieser Richtung.
Es war die letzte Überzeugung, auf welcher sich alle Forschungen des menschlichen Denkens in fast allen ihren Ausläufern aufbauten. Es war die herrschende Überzeugung und Lewin machte dieselbe vor allen anderen Erklärungen als die immer noch klarste, unwillkürlich und ohne zu wissen wann und wie, zu der seinigen.
Aber dies war nicht nur falsch, sondern vielmehr der hartherzige Hohn einer bösen Macht, einer so bösen, widrigen, daß er sich ihr nicht unterordnen konnte.
Man mußte sich befreien von dieser Macht, und die Befreiung lag in den Händen eines jeden. Es galt, diese Abhängigkeit vom Bösen zu beseitigen, und dafür gab es nur ein Mittel – den Tod.
Als glückliches Familienoberhaupt, als ein gesunder Mensch, war Lewin mehrmals dem Selbstmord so nahe, daß er die Schnur versteckte, damit er sich nicht an ihr hing, und sich fürchtete, mit der Flinte zu gehen, um sich nicht zu erschießen.
Doch Lewin erschoß sich weder, noch hing er sich, sondern lebte weiter.