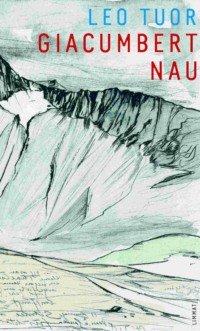Czytaj książkę: «Giacumbert Nau»

Leo Tuor, geboren 1959, verbrachte vierzehn Sommer als Schafhirt auf der Greinahochebene. 1989–2000 Arbeit an einer sechsbändigen Werkausgabe des rätoromanischen Dichterfürsten und Historikers Giacun Hasper Muoth. Leo Tuor lebt in Val. Er schreibt Erzählungen, Kurztexte und Essays, sie wurden vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Schillerpreis und dem Hermann-Lenz-Stipendium.
Peter Egloff, 1950 in Zürich geboren, ist freier Journalist und lebt in Sumvitg, wo er seit 1975 auf die Jagd geht. Er hat von Leo Tuor auch «Giacumbert Nau. Bemerkungen zu seinem Leben» und «Onna Maria Tumera oder Die Vorfahren» übersetzt. Zuletzt ist von ihm «Der Bischof als Druide. Berichte aus Graubünden» erschienen.
LEO TUOR
GIACUMBERT
NAU
Bemerkungen zu seinem Leben
Aus dem Rätoromanischen von Peter Egloff

Quatemberkinder lernen viel leichter in der Schule, und später sehen sie Geister und Hexenspuk.
Fünf Sommer habe ich das weisse Pferd von Blengias gesucht, fünf Sommer lang. Ich habe es herausgefordert, provoziert, gereizt, habe es herbeigeflucht und herbeigebetet, geködert und gelockt, ihm aufgelauert. Nichts! Auch in drei Teufels Namen nicht!
Sähe ihn gern einmal, den Schimmel von Blengias, um nachher anständig krepieren zu können.
Ich erinnere mich.
Er war nicht gerade gross und nicht besonders schön. Schmale Schultern hatte er für einen Mann, und keine Haare auf der Brust. Ein Bein war etwas zu kurz, deshalb erkannte man ihn schon von weitem am Gang. (Obschon Hirt, ging er selten rasch. Vielleicht wegen diesem Bein, vielleicht weil er die Gewohnheit hatte, immer wieder stehenzubleiben, den Feldstecher zu nehmen und zu spiegeln.)
Eine feine Hand hatte er. An seiner Linken waren aber, bis auf den Daumen, alle Finger ab. Für mich war eigentlich nur etwas an ihm schön: die Augen. Es brauchte jedoch viel, bis er jemandem in die Augen schaute, denn er hatte die Tiere lieber als die Leute. Er hasste die Leute, und ganz besonders hasste er, was man «Volk» zu nennen pflegt, diese blinde, blöde Herde, die sich so leicht in die Richtung dirigieren lässt, die den Pfaffen und Politikern behagt.
Nein, Denken ist nicht die Stärke der Leute. Ora et labora und denk nichts. Arbeit haben und dumm bleiben und den immergleichen Brei bis zum Erbrechen wiederkäuen: So sind die Leute.
Hass, Hohn und Gelächter waren seine Waffen gegen die Dummheit. Schliesslich aber musste er wie ein verletztes Tier in die Berge weichen und dann verschwinden, verschwinden wie der Schnee vom letzten Jahr. Fragt nicht wohin.
Glauben hatte er keinen, und er vertraute nur seinem Hund. Als Albertina einmal sagte, dass sie ihn besuchen komme, meinte er: «Ich glaube es erst, wenn ich dich sehe.» Sie wehrte sich: «Wenn ich sage, ich komme, dann komme ich!» Er hatte nur leise und bitter gelacht und dann gesagt (zu Albertina? zu sich? – ich weiss es nicht): «Heisst es nicht, dass die, die auf den Alpen leben, einen eigenen Glauben haben?» Und noch hinzugefügt: «Glauben macht selig, und Sterben macht steif.»
Bereits mit siebzehn hatte er aufgehört, an den Gott der Katholiken zu glauben, den Gott der Sünden und der Beichtstühle, der immer zu den Pfaffen hielt, weil die Pfaffen sagten, was Gott sage. Früh hatte er aufgehört, an gepredigte Wahrheiten und an die Gerechtigkeit zu glauben.
Und noch etwas:
Er glaubte nicht, dass der Mensch gut sei.
«Ich weiss, dass ich schlecht bin.»
Das war einer seiner seltenen Sätze. Der Klang der sechs Wörter liess mich schaudern, und seine wunderschönen Augen glühten in meinen, als er hinzufügte: «Auch du weisst, dass du schlecht bist.»
Da wusste ich es.
Seine Seele schmerzte ihn oft, das verriet mir seine Stimme. Karg waren seine Worte, kaum jemals ganze Sätze. Man verstand nicht immer, was er sagte, was er meinte. Ich habe alles so aufgeschrieben, wie ich es gehört und gesehen habe. Seine Worte drangen mir ins Blut, ohne dass ich sie immer verstanden hätte.
Aber muss man immer alles verstehen? Giacumbert war sein Name, und denselben Anfangsbuchstaben hatten die Namen seiner Weiden.
Stolz war er auf seine Tochter, die er mit einer Verheirateten gemacht hatte. Stolzer noch war er darauf, dass er ein Kind mit genau der Frau hatte, mit der er es haben wollte, dass er sich dabei einen Dreck um Moral und Gesetz gekümmert und dass niemand nichts gemerkt hatte, nicht einmal der Alte (wie er ihren Mann zu nennen pflegte). So hatte er erstens sein Gaudi gehabt, hatte zweitens dafür gesorgt, dass sein Schlag nicht aussterben würde, und hatte obendrein alle Klatschmäuler gestopft. Warum er’s mir erzählt hat, weiss ich: Damit ich es aufschriebe, wenn er fort wäre, und so doch noch alle dahinterkämen.
Giacumbert ist fort, und die Weiden, die mit demselben Buchstaben begannen, sind zerstört.
Erinnere mich noch an einen Vierzeiler, den er gerne hersagte (wegen dem Klang der Wörter vielleicht, ich weiss es nicht):
Lag ich just in Träumen flott auf dem Altar beim grossen Gott, hab der Gerechten Schlaf gestört und mich an deinem Leib betört?
Als ich ihn zum letzten Mal sah, rief er:
«Wir sehen uns noch, spätestens in der Hölle.
Die Schönen sind dort unten. Addio!»
Rot & Weiss waren seine liebsten Farben.
Du kommst zu mir,
du fragst mich, wer Giacumbert sei.
Was soll’s. Nenn Giacumbert einfach den Mann
der Gaglinera.
Die Gaglinera ist dort, wo die Hühner einen Hirten haben.
Wer ist Giacumbert?
Wer ist die Gaglinera?
Vielleicht erfährst du es, indem du es erspürst, und sonst eben nicht, in Gottesnamen.
Aber wenn du einmal über den Pass kommst, dann wird dein Auge die Kargheit des Bodens sehen und die Kargheit der Wörter, und vielleicht spürst du dann die vage Seele jenes Menschen aus Fleisch, den ich Giacumbert nenne.
Wenn du das spürst, dann bist du selber Giacumbert oder Albertina, und dann sind deine liebsten Farben
Rot & Weiss.
Wenn du über den Diesrut kommst und das Auge dafür hast, dann siehst du in der Ebene auf kleinem Hügel den Steinhaufen, der einmal die Hütte des Rosshirten war.
Wenn du das Auge hast.
Dein Auge, deine Seele.
Giacumbert schiebt den Hut zurück.
Die Ebene interessiert Giacumbert nicht,
Piano della Grena.
Giacumbert geht in einem fort.
Giacumbert zwängt sich verbissen den schwarzen Pfad hinan, wie seine Tiere, schiebt den Hut noch weiter aus der Stirn, rammt den Stock auf die Steine, zwischen die Steine, in den Rasen.
Giacumbert zwängt.
Giacumbert lauscht, wie es flüstert, erzählt,
lauscht in sich gekauert,
Giacumbert lauscht dem Hirten,
dem Tal, seinem Raunen.
Der Geist und das Tal sterben nie.
Wohin führen deine Pfade, Giacumbert? Und die Pfade in deinem Kopf? Und dein harter Schädel?
Wie dein Hirn winden sich deine Pfade, folgen einander nicht am Schnürchen wie deine Tiere.
Aber müssen die Pfade nicht wie die Tiere gehen, gehen, vergehen?
Was hältst du die Nase in die Luft?
Bist kein Barometer. Dieses Gespür hatten die Alten. Das Gespür fürs Wetter hast du nicht mehr.
Geh in deine Hütte, geh schlafen und lass das Wetter machen!
Das Wetter findet im Freien statt.
Wo ist das Läger für die Nacht,
wo sollen sie ruhen,
wo?
Sie sind aufgestanden, stehen reihenlang am morgengrauen Horizont. Gereckte Hälse, Köpfe, wie Männchen auf dem gletscherrunden Fels.
Die weissen Schnüre bewegen sich herab.
Eine, zwei, plötzlich vier,
eine rascher.
So viele längliche Perlen.
Das also wäre die Gaglinera.
Es ist sechs Uhr, und Giacumbert ist schon ganz verschwitzt.
Schaut und schaut, staunt und staunt
in den jüngsten Tag.
Giacumbert schaut finster und eilt wie ein Teufel über Höcker und Furchen der Gaglinera. Mal siehst du Giacumbert, mal nur seinen Hut, mal siehst du gar nichts von Giacumbert.
Es muss nach Schnee riechen.
Von den Bauern keine Spur.
Giacumbert flucht, um sich zu wärmen.
Es riecht nach Schnee.
Die Gaglinera wird weiss.
Wo sind deine Tiere, Giacumbert?
Wo ruhen deine Tiere heut nacht?
Stumm legt sich der Schnee in die Gaglinera, glättet ihr Gesicht.
Giacumbert? Bist eingenickt?
Über deinem Tisch bist du eingenickt, Giacumbert?
Aber was solltest du im Bett!
Dein Bett in dieser Henkershütte ist zu kurz. Du hast es schlechter als deine Hunde, die schon lange schlafen und nur ab und zu mit einem Auge blinzeln, um zu schauen, ob du nicht bald die Lampe löschen wirst.
Giacumbert schleift die Alte hinter sich her.
Heute geht’s zur andern Hütte.
«Aah-ti-ti-ti-ti-tit-aaaaaaaaaaa!»
Sie hat’s nicht eilig, die Alte, zupft rechts noch vom Pfad ein Kräutchen und links vom Pfad einen Halm, reckt den Hals nach diesem Strauch und rupft an jenem Büschel. Ihr mä-hää wird gedehnter und kürzer, je nachdem wie stark der Strick sie würgt. Zurück schaut er, Giacumbert, finster, am Ende schon fast mit seiner Geduld, halsüberkopf stolpernd übers kleine Zicklein, das bald hinten, bald vorn ihm zwischen die Beine gerät aus Vorwitz.
Liegt auf dem Bauch am Boden jetzt er, Giacumbert, Hirt seiner Ziegen.
Nur Geduld, bis zum Abend sind wir vielleicht dort, wo wir möchten. Ah-ti-tit!
Das Zicklein leckt ihm das Ohr aus.
Giacumbert kaut sein Brot.
Hartes Brot ist nicht hart,
auch nach zweidrei Wochen nicht.
Giacumbert kaut sein trockenes Brot.
Hartes Brot gibt es nicht.
Giacumbert nagt feierlich an seinem Brot
und schlingt und schluckt an seinem gelben Speck
und bricht im Brot die Messerklinge ab.
Was ist, Giacumbert? Du hast kein Fleisch mehr. Ohne Fleisch bist du nichts. Du kannst nicht leben von Früchten und Gemüse und solchem Zeugs, du brauchst Fleisch. Deine Ahnen stammen ab vom Wolf, Fleisch brauchst du, Fleisch.
Bist nimmersatt, brauchst Fleisch.
« I »
«i i i i i – i i i i i»
Giacumbert schleift den Hund an den Ohren aus dem Bett:
«i i i i i i i i i i i»
«Raus, du Schwein!»
«i i i i i i i»
«Lump!»
Giacumbert steht Spalier neben der langen Perlenschnur, die sich den Pfad herunterschlängelt. Giacumbert schaut und schaut entzückt auf die lange Prozession, die geht, wie sie zu gehen hat. Giacumbert steht ganz allein Spalier neben der langen Prozession, nicht wie an Sankt Placi, wo nur wenige in der Prozession gehen und alle anderen gaffen und herumschwärmen mit Kameras und Klimbim, knien und rutschen und sich bücken und beugen, kriechen vor Kreuz und Fahne und Geschell.
Giacumberts Tiere haben ihre Rituale bewahrt.
Nur die Menschheit steht Spalier,
die Dekadenz.
Die breite Front aus Wolle bewegt sich vorwärts über Höcker und Hügel. Frisst die zarteren Gräser bis auf die Wurzel ab. Die dumme Laune eines einzelnen Tieres reicht, um der ganzen schreckhaften Schar eine andere Richtung zu geben.
Und dann geht es wieder vorwärts, als ob nichts gewesen wäre. Manchmal hebt ein Tier den Kopf, misstrauisch weitermahlend. Die wenigen Schellen klimpern ihr tin tin. Weiter bewegt sich die Front
avanti avanti
avanti popolo
ohne Ruh
ohne Ruh.
Lässt die Nachtweide hinter sich und den Hügel, lässt Mist hinter sich und zähes Borstgras, lange Büschel, und ihr bäh bäh.
Hier ist der Wind mit dir
S c h s c h u u
s c h s c h i u
s c h w v v i u i u v v
s c h s h i w s s s s c h v v
S s s s s s s s s s s s s s s
s f v s f v s c h
Zerzaust den Hund,
entblösst den Hirten,
treibt es mit allen,
der wüste Gesell,
Bise und Föhn zugleich.
Auf Wetters Scheide bist du,
zwischen Nord und Süd.
Hier macht es, was es will,
und keiner kommt mit ihm zurecht.
Ich sehe ein Getümmel von unbeschlagenen Pferden, von Beinen und Bäuchen, Kruppen und Schweifen und Mähnen. Der Wind wiehert durch das mutwillige Gewühl aus Leben und Fleisch. Harngetränktes Moor, rote Mäander spiegeln den keuchenden Spuk. Ich sehe gespannte Muskeln, meine gereizten Nüstern wittern beissende Wogen. Ich sehe schlanke Köpfe, füllige Bäuche, gebleckte Zähne, lange Kiefer, schimmernde Augen im Schnauben des Wirbelwinds. Die weite Ebene ein Stampfen und Stieben gen Süden.
Die Schneekrone des Coroi tötet meinen Blick.
Die Val dil Draus zerzaust meinen Geist, entblösst mein Hirn.
Bin nurmehr Fleisch.
Ich sehe gelben Auges das Wasser,
das Brühe wird und stockt, erstarrt.
Höre Pferde im Lauf, und auf dem Hügel
steht rotmähnig der Rosshirt.
Ist es ein Mann, ist’s eine Frau?
Sehe nur undeutlich die Hüften,
erinnere mich nicht an Brüste.
Das Tier kann nicht mehr. Die Stunde ist da. Verschwollene Augen, trockenes Maul. Fette Fliegen summen.
Der Rabe wartet. Die Stunde ist da.
Das Tier lässt sich von Giacumbert streicheln. Legt seinen Kopf auf einen flachen Stein, als ob es sagen wollte: Mach ein Ende.
Giacumbert streicht lange über den kranken Kopf.
Die Stunde ist da.
Wieder und wieder ist die Axt auf den Schädel niedergekracht.
Die Steine sind rot.
Lange hat Giacumbert die Axt an der Wolle abgewischt.
Der Mohr hat seine Arbeit getan. Der Mohr kann gehen!
Giacumbert Nau war sieben Sommer auf der Alp weniger vierzehn Tage.
Was bringt ihr ihm den Blick?
Bist du ein Blick-Leser? Soll den Blick lesen, wer will.
Interessieren dich nackte Frauen auf Papier? Nicht besonders! Musst Fleisch in Händen haben, Fleisch im Bett, sonst bist du nicht zufrieden. Und wenn du dann gehabt hast, was du willst, gehst du deiner Wege.
Bestialisch bist du, bestialisch wie Pizarro und seine Satansbrut. Ein Mann bist du, Giacumbert.
Aber kein Blick-Leser.
Du willst die Sensation leben, nicht lesen.
Lest euren faulen Blick an Werk-und Sonn-und Fest-und Feiertagen, ihr Holzköpfe, lest und werdet noch dümmer als dumm. Und fürchtet nicht, damit an Grenzen zu stossen, denn die Dummheit ist überall und grenzenlos.
Wenn du oben ganz zuhinterst im Engpass stehst, verläuft deine Weidgrenze so, wie das Wasser fliesst, drei Ave lang schräg hinauf gleich über jenem grossen Stein, kannst es gar nicht verfehlen. Dein Auge fällt sofort auf den Coroi, den stolzen, behäbig breiten.
Am Nachmittag schimmern seine feinen Runsen blaugrau in der Sonne. Schneeflecken leuchten neben grünen Bleisen. Fleck neben Fleck, jedes Jahr ein wenig anders. Breit macht sich der Coroi in die Ebene hinaus, wie die gescheckte Glucke. Ein Riesenhuhn. Und gegenüber die weite, weite Gaglinera.
Wart.
Wart, ich komme.
Ich muss sie nur noch aufhalten, sonst entkommen sie mir gegen den Gletscher hinauf. Wart nur noch eine Minute, ich eile. Muss nur das Leittier wenden, das mit der Schelle. Wart. Eines nur wenden, dann macht die ganze Herde, was ich will.
Wart nur eine Minute.
Aber das verfluchte Gerippe mochte nicht warten auf Giacumbert. Er sah nur noch Kiefer, Zähne,
die Sense, die krumme.
Eine Kleinigkeit wär’s gewesen: Seine Schafe vom Pfad treiben, nur jenes eine mit der Schelle noch. Aber kichernde Kieferknochen hielten Giacumbert am Boden fest wie an gefrorenem Eisen. Zuschauen musste er, wie seine Herde in die falsche Richtung zog.
Die Sense, die krumme,
sie hatte ihn eine Minute zu früh ereilt. Giacumbert starb langsam, den brechenden Blick auf seinen Schafen, die den steilen Pfad hinauf in die falsche Richtung drängten. Er starb, ohne seine Pflicht erfüllt zu haben.
Er starb im Imperfekt.
Kommt eines Tages ein Mann zu Giacumbert, packt ihn an der Gurgel, sagt:
«Was ist?»
(Pause)
«Deine Sprache ist schief.»
(Pause)
«Dein Blick ist gebrochen, dein Körper ein Sumpf. Aber du musst durchhalten.»
Geht eines Tages eine Frau fort von Giacumbert, sagt nichts, geht.
Meine Seele, ein zerrissenes Spinnweb.
Die Edelweiss sind in der glatten Wand.
Das Felsband wird schmaler und schmaler.
Die Hand tastet nach vorn, immerzu nach vorn.
Brennende Begierde treibt ihn in die Wand hinaus.
Geh zurück, Hund, geh!
Aber es gibt kein Zurück für den Hund, und es gibt kein Zurück für ihn.
Rechts dröhnen die Wasser der grossen Kaskade.
Geh zurück, Hund, geh! Geh, Diabola, geh!
Sie schaut und schaut, winselt, zögert:
Es geht nicht mehr. Die Wasser schäumen.
Weiss und weiss, die Wände grau, die Blumen grau, der Hund weiss, die Nebel gelb.
Noch ein wenig vorwärts, und noch ein wenig.
Gierig streckt sich die Hand nach den Stielen, reisst und knickt und bricht und stopft sie in den Mund.
Die Augen glänzen wie bei einem Tier, das Fieber hat.
Möchte hiermit bestätigen, dass die zwei Schafe des Obgenannten (eins davon das Leittier) am 26. August auf der Gaglinera erfallen sind, rechts oben in den Preits, etwa in der Fortsetzungslinie des Tälchens, das die Weide begrenzt, vis-à-vis vom Crap Gries. Sie waren zu weit in die Wand des Vonn hineingeraten, als es zu schneien begann, wollten dann hinunter statt hinauf. Der Hirt konnte nichts machen. Nur zuschauen, wie sie kaputtgegangen sind.
Darmowy fragment się skończył.