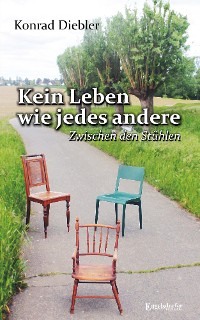Czytaj książkę: «Kein Leben wie jedes andere»
Konrad Diebler
KEIN LEBEN WIE JEDES ANDERE
Zwischen den Stühlen
Engelsdorfer Verlag
Leipzig
2021
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Copyright (2021) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Titelbild © Konrad Diebler
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Kind sein
Schulkind sein
In Lehre sein
Vater und auf zack sein
Selbständig sein
Im Fieber des Jahrhunderts sein
Privatier und im Bilde sein
Dankbar sein
Vita
KIND SEIN
„Sie können keine Kinder mehr bekommen“, sprach der Frauenarzt zu meiner Mutter. Dieser Diagnose verdanke ich mein Leben.
Meine Mutter wurde im Alter von 40 Jahren schwanger und ich kam am 10. März 1953 und damit zwei Monate zu früh auf die Welt. So früh, dass sie mich in einen Inkubator legten, den es zu dieser Zeit zum Glück schon gab.
Meine Schwester Martina war damals schon 14. Sie war eine Hausgeburt gewesen und hatte ebenfalls als Siebenmonatskind das Licht der Welt erblickt. Die Aussage der Hebamme: „Die erlebt den nächsten Morgen nicht.“ Doch hatte sie die Rechnung ohne die Großeltern gemacht. Oma Ida sprach zu Opa Alwin, in einem Ton, der keine Widerrede duldete: „Geh in den Keller, hole Anbrennholz und Brikett und heize den Berliner Ofen an.“ Und so geschah es, dass am 8. August, einem heißen Sommertag, der Säugling in einen Wäschekorb gelegt und dieser auf den warmen Ofen gestellt wurde. Das winzige Mädchen erlebte den nächsten Morgen.
Historisch gesehen war meine Geburt fünf Tage nach Stalins Tod. Doch was weiß man schon, wenn man in den Inkubator gelegt wird und bis Pfingsten auf der Neugeborenenstation der Universitätskinderklinik Leipzig liegt.
Während dieser Pfingstfeiertage fuhren mich meine Eltern und meine Schwester erstmals im Kinderwagen aus. Die Schwangerschaft meiner Mutter war nicht auffällig gewesen. Es war Winter, meine Mutter vollschlank, ich klein und der Wintermantel verdeckte den Rest. So entstand das Gerücht Martina, meine Schwester, wäre mit 14 Jahren die Mutter.
1953 sollte ein turbulentes Jahr werden. Stalins Tod und der Arbeiteraufstand am 17. Juni stellten einiges auf den Kopf. Mein Vater war selbständiger Tischlermeister und führte einen Betrieb mit 10 Mitarbeitern. Darum sollte er die Behandlung im Inkubator bezahlen.
Zum Glück wurden die Forderungen bald fallen gelassen. Denn nach dem 17. Juni hatte sich die politische Lage etwas gedreht.
Ich dagegen drehe die Zeit noch etwas weiter zurück und widme mich meinen Vorfahren.
Mein Vater Martin wurde am 23. März 1908 in Tautenhain bei Geithain in Sachsen als sogenanntes Häuslerkind geboren. Häusler waren die Dorfbewohner, die weder zu den Bauern noch zu den Handwerkern gehörten und so über keinen Hof verfügten. Sie wohnten in einem kleinen Haus, deshalb Häusler. Meines Vaters Vater Robert, der dem Jahrgang 1876 entstammte war, was man damals einen Handarbeiter nannte. Er arbeitete im Sommer im Kalkbruch oder als Helfer auf dem Bau. Im Winter gab es für ihn meistens gar keine Arbeit. Seine Frau Hulda, geboren 1877, nähte für andere Leute und führte verschiedene Hilfstätigkeiten aus. Es herrschte eine große Armut in der achtköpfigen Familie. Die neben den Eltern aus drei Jungen und drei Mädchen bestand. Eine vierte Tochter war unehelich und einige Jahre älter. Sie wohnte jedoch nicht mehr zu Hause.
Gehe ich geschichtlich noch weiter zurück, so waren die Vorfahren meines Großvaters Robert aus der Steiermark nach Thüringen eingewandert. Sie ließen sich erst in Gera und später in Weida nieder.
Die Vorfahren meiner Großmutter Hulda hingegen stammten aus Oberwiesenthal im Erzgebirge.
Wie mein Großvater von Weida nach Tautenhain kam, ist nicht bekannt. Hulda war als Kind mit ihren Eltern auch dorthin gezogen. Robert und Hulda verliebten sich und trotz des unehelichen Kindes nahm Robert seine Hulda im Februar 1903 zur Frau.
Fünf Jahre später kam mein Vater zur Welt und Ostern 1914 wurde er eingeschult. Im darauffolgenden September musste sein Vater Robert für den deutschen Kaiser in den Weltkrieg ziehen, was die Not der Familie noch vergrößerte. Da auch viele Lehrer in den Krieg ziehen mussten, teilte man den Unterricht, vormittags Klasse 1 bis 4 und nachmittags Klasse 5 bis 8, wobei diese Klassenstufen jeweils zusammen unterrichtet wurden.

Robert Diebler Soldat im 1. Weltkrieg
Man schrieb das Jahr 1922, als mein Vater aus der Schule kam. Gegen seinen Willen musste er Knecht werden, ein sogenannter Osterjunge, bei einem Tautenhainer Bauern. Seinem Wunsch, ein
Handwerk zu erlernen, wurde nicht entsprochen. Sein älterer Bruder Karl hatte es da besser. Er erlernte den Maurerberuf, wohnte noch zu Hause und die Eltern beköstigten ihn. Diese Ausgaben konnten die Eltern nur einmal tragen. Beim Bauern hatte mein Vater immerhin freie Kost und Logis.

Familie Robert Diebler um 1920
Doch nach zwei Jahren als Knecht hatte er genug von der Landwirtschaft. Er verließ den Bauern und machte sich selbst auf die Suche nach einer Lehrstelle.
In Geithain hatte er Erfolg bei einem Stellmacher, bei dem er die vierjährige Lehre antreten konnte.
Endlich ein Handwerksberuf. Darüber war er froh. Lohn bekam er nicht, hatte dafür aber freie Kost und Logis. Dazu kam, die Frau des Meisters betrieb einen Lebensmittelladen. In diesem musste er aushelfen und bekam dafür etwas Geld. Brauchte er ein paar neue Schuhe oder etwas zum Anziehen, so waren diese größeren Dinge das Weihnachtsgeschenk des Meisterpaares.
1928 konnte mein Vater die Lehre als Stellmachergeselle abschließen. Wurde von seinem Lehrmeister leider nicht mehr übernommen, da dieser bereits im Rentenalter war und den Betrieb nicht weiterführte.
Nach einigen weiteren Stationen kam mein Vater zu Beginn der 1930er Jahre dann nach Leipzig.
Dort lebte auch meine Mutter. Sie wurde am 5. Januar 1912 in der Messestadt geboren.
Ihr Vater Alwin Pehnert, Jahrgang 1886, war Geschirrführer. Ein Beruf, der dem heutigen Berufskraftfahrer entspricht. In dieser Zeit wurden die meisten Transporte noch mit Pferd und Wagen durchgeführt. So transportierte mein Großvater große Rollen Zeitungspapier vom Güterbahnhof in die Zeitungsdruckereien. Auch am Bau des Völkerschlachtdenkmals war er mit Baustofftransporten beteiligt gewesen.
Meine Großmutter Ida, die Alwins Frau war, wurde 1889 geboren. Sie wusch für feine Herrschaften in deren Haushalt die Wäsche, bügelte und spannte Gardinen. Auch in der Küche wurde sie tätig. Ihre Herrschaften waren Inhaber der Gaststätte „Zum Thüringer Hof“ und während der Leipziger Messen kochte auch sie mit in der traditionsreichen Gaststätte.

Ida Pehnert
Alwin und Ida stammten aus dem Dorf Mölbis südlich von Leipzig. Das einige Jahrzehnte später in der DDR traurige Berühmtheit erlangte. Es lag hinter dem Braunkohlenveredlungswerk Espenhain. Damit lag es in der Hauptwindrichtung. Viel Dreck und giftige Abgase zogen in das Dorf und machten die Bewohner, und besonders die Kinder, krank.
Die Eltern von meinem Opa Alwin bewirtschafteten in Mölbis einen kleinen Bauernhof.
Meine Oma Ida hingegen war das uneheliche Kind einer Magd in Mölbis. Es ging die Kunde, ein Butterhändler, der über die Dörfer zog und hier und da ein Kind zeugte, sei der Vater gewesen.
Auch hieß es, der Dorfpfarrer habe der leiblichen Mutter den Säugling gegen ihren Willen weggenommen und ihn Pflegeeltern im Dorf übergeben. Dies war ein traumatisches Erlebnis für die leibliche Mutter.
Nach Abschluss der Dorfschule ging meine Oma nach Leipzig in Stellung, d.h. sie wurde Dienstmädchen in einem vornehmen Haushalt. Putzen, waschen, kochen zählten zu ihren Aufgaben.
Doch dann passierte es: Ihre Mutter hatte herausgefunden, wo sie wohnt, und wollte Kontakt mit ihr aufnehmen. Diesen Versuch hat meine Oma jedoch brüsk abgewiesen. Sie sagte ihr: „Ich habe keine Mutter!“
Meine Großeltern, die nach eigenen Aussagen in Mölbis keinen Kontakt hatten, lernten sich in Leipzig kennen, lieben und heirateten 1911.
1914 musste auch Alwin in den Weltkrieg ziehen. Er war bis 1918 an der Westfront, in Belgien und Frankreich im Einsatz. Er hat nie viel erzählt. Die Grauen im Schützengraben wurden nicht thematisiert, obwohl er zwei Mal verwundet wurde. Die einzige Schilderung über diese Zeit widmete er dem Essen.
So erzählte er: „Im Winter lagen da im Freien große Berge gefrorener Rüben. Die Köche kamen mit dem Spaten und stachen welche ab. Die gaben sie so in den Kessel, so dass sie zusammen mit der Erde und den Ratten aufgetaut und gekocht wurden!“

Hochzeit Alwin und Ida 1911
Die Grauen des ersten Weltkrieges haben nach Erzählungen meiner Großeltern viele Menschen dazu veranlasst, aus der Kirche auszutreten. Auch meine Großeltern kehrten der Kirche von da an den Rücken. Ihre Tochter Herta wurde noch getauft, aber nicht mehr konfirmiert.

Familie Pehnert um 1918
Nach ihrem Schulabschluss 1926 erlernte meine Mutter den Beruf einer Kontoristin, Bürokauffrau nennt man diese Tätigkeit heute.
Anfang der dreißiger Jahre geschah es. Da lernten sich im Volkshaus in der Leipziger Südvorstadt meine Eltern beim Tanz kennen. Vater war arbeitslos und meine Mutter arbeitete in ihrem Beruf in einer Spedition.
Als mein Vater seine Herta heiraten wollte, hielt er bei Alwin „um ihre Hand an“, d.h. er erbat das Ja für die Hochzeit.

Herta und Martin als junge Menschen
Mit der Frage: „Wie willst du sie denn ernähren?“, verweigerte ihm Opa Alwin ihm die Zustimmung.
Um der Arbeitslosigkeit zu entgehen, machte sich Vater 1933 selbständig. Als Stellmacher baute er Handwagen und Fahrradanhänger. In dieser Zeit wurde der Skisport gerade populär. Dies brachte ihn auf die Idee, Skier zu reparieren, insbesondere abgebrochene Spitzen wieder anzubringen und einen Skiservice durchzuführen. Obendrein stellte er auch selbst Holzskier her, die in Sporthandlungen verkauft wurden.
Seine erste Werkstatt war ein kleines Hofgebäude in der Johannastraße 11 in Leipzig Dösen.
1935 dann übernahm er einen Kohle- und Holzhandel in der Leinestraße in Leipzig Dölitz.

Hochzeit Martin und Herta 1935
Dort richtete er sich seine Werkstatt ein. Neben dem Verkauf von Brikett und Feuerholz verlegte er sich bald auf den Bau von Wochenendhäusern. Diese wurden in der Werkstatt gebaut, auf dem Hof auf- und anschließend wieder abgebaut, zum Standort transportiert und dort endgültig errichtet.
Wie gut die Geschäfte liefen! Er verdiente Geld und bekam 1935 von Opa Alwin die Erlaubnis zur Hochzeit, die im gleichen Jahr am 13. April gefeiert wurde.
Der Zweite Weltkrieg beendete jäh diese Entwicklung. Ein Jahr nach Kriegsbeginn wurde Vater zur Wehrmacht eingezogen, musste in den Krieg ziehen. Nach sieben langen Jahren kehrte er 1947 aus russischer Kriegsgefangenschaft endlich in die Heimat zurück.
Der Anfang nach dem Krieg war schwer. Zerstörte Städte, große Winterkälte und Hungersnöte verlangten den Menschen viel ab.
Opa Alwin und Oma Ida stammten vom Dorf und kannten sich mit Tierhaltung und Gartenbau aus. Sie fütterten eine Ziege, Hühner und Kaninchen. So war kein Mangel an Milch, Eiern oder Fleisch. Im Garten wuchs Gemüse und Kartoffeln wurden gepflanzt. Aus der Ziegenmilch stellte Opa Alwin Ziegenkäse her. Im Connewitzer Wald bekamen die Selbstversorger eine Fläche zugewiesen, von der sie sich mageres Gras als Futter holen konnten. Die Urgroßeltern in Mölbis konnten auch mit etwas Essbarem aushelfen.
Dadurch brauchten weder meine Eltern, noch meine Schwester Martina so großen Hunger leiden, wie die Leipziger Stadtbevölkerung.
Mein Vater brachte seine Tischlerei wieder zum Laufen. Er hatte zehn Gesellen und war besonders auf den Leipziger Messen wirtschaftlich erfolgreich. Mit dem Bau von Wochenendhäusern war es nach dem Krieg erst einmal vorbei, die Menschen hatten jetzt andere Probleme.
1953 legte er seine Meisterprüfung ab. Als Tischlermeister, obwohl er den Tischlerberuf – er war ja Stellmacher – nie erlernt hatte. Und somit sind wir wieder in meinem Geburtsjahr angelangt.

Konrad - 1. Foto 1953
Die ersten Lebensjahre verbrachte ich viel bei Oma und Opa. Meine Mutter erledigte in der Tischlerei die Büroarbeiten. Da meine Großeltern gegenüber der Werkstatt wohnten, gab mich Mutter früh dort ab und nahm mich nach Feierabend wieder mit nach Hause.

Familie Diebler um 1957
Für ein Jahr besuchte ich ab 1958 den Kindergarten in Dölitz. An zwei Sachen erinnere ich mich bis heute, an das Essen und Schlafen. Wir mussten immer aufessen und auch das fette Fleisch durfte nicht auf dem Teller bleiben. Nach dem Essen kam die Mittagsruhe, geschlafen habe ich nicht, das fette Fleisch hatte ich oft noch im Mund. Im Garten habe ich es dann in einem unbeobachteten Moment in ein Gebüsch gespuckt. So sind mir gerade die negativen Erinnerungen geblieben.
Auf dem Hof der Tischlerei hielt Opa Alwin noch Hühner und einen Hahn, diese Tiere waren aus der Nachkriegszeit übrig geblieben. Meinem Vater gefiel dies gar nicht. Die Hühner liefen über den Hof, kackten auf die Holzstapel und passten einfach nicht in eine Tischlerei. Das größte Problem war jedoch der Hahn. Er sprang Mitarbeitern oder Kunden, die auf den Hof kamen, in den Rücken. Auch ich ängstigte mich vor ihm. Eines Tages sprang der Hahn wieder einem Kunden in den Nacken. Meinen Vater packte die Wut, er ergriff den Gockel am Hals, ging in die Werkstatt und hackte ihm auf einer Hobelbank mit der Axt ruck zuck den Kopf ab.
Diese spontane Tat war der Anfang vom Ende der Hühnerhaltung. Meine Oma war alles andere als glücklich, aber es half nichts, ein Huhn nach dem anderen wurde geschlachtet und landete im Topf und auf den Tellern.
Das Jahr 1959 brachte für meinen Vater einschneidende Veränderungen. Über den Selbständigen schwebte die Gefahr der Enteignung durch den Staat. Dies beschäftigte ihn sehr, er trat die Flucht nach vorn an und schloss sich mit zwei weiteren Tischlermeistern zu einer Produktionsgenossenschaft des Handwerks – einer PGH – zusammen, was das Ende seiner Selbständigkeit bedeutete. Er war nun PGH-Vorsitzender und Gehaltsempfänger, blieb aber, was ihm wichtig war, der Chef. Die anderen zwei Tischlereien brachten einen Haupt- und einen Lohnbuchhalter mit. So endete auch für meine Mutter die Arbeit im Büro. Ab 1959 war sie Hausfrau und Mutter eines Schulanfängers, mich.

Ida und Alwin um 1960

Konrad mit Mutter 1953

Hulda u. Konrad 1956

Robert u. Hulda um 1950
SCHULKIND SEIN
„Dann weht ein anderer Wind!“ Und: „Wenn du nicht fleißig lernst oder Dummheiten in der Schule machst, gibt es Schläge“, solche Sätze sagte nicht nur mein Vater, es war damals üblich, den Kindern Angst vor der Schule zu machen. So trat ich mein Schülerdasein mit gemischten Gefühlen an.

Schulanfang 1959
MAMA am Fenster, MIMI am Tisch, diese ersten Worte im Lesebuch brachte uns Herr Martin bei, unser erster Lehrer. Noch im Rentenalter unterrichtete er die Schulanfänger im Lesen, Rechnen und Schreiben. Schon vor 1933 war er Lehrer gewesen, wurde in der Nazizeit jedoch aus dem Schuldienst entlassen. Nach 1945, politisch unbelastet, konnte er den Lehrdienst wieder antreten. Das tat er mit einer Beinprothese, die von seiner Kriegsverletzung herrührte.
Unsere ersten Schreibübungen machten wir noch mit Federhalter und Tinte. In den schweren, massiven Schulbänken befanden sich Öffnungen für die Tintenfässer. In diese tauchten wir unsere Schreibfeder ein und brachten mühsam die ersten Buchstaben zu Papier. Nicht ohne große Kleckse im Schulheft, auf der Schulbank, der Kleidung oder an den Händen zu hinterlassen.
Ich hatte zwei Probleme. Alle Kinder trugen einen neuen Schulranzen, in der Art wie damals üblich, helles Leder und zwei Schnallen. Ich hatte einen schwarzen mit nur einer Schnalle, welchen meine Schwester schon getragen hatte. Zweitens besaß ich keine Federmappe, sondern ein kleines
Holzkästchen für die Stifte, diese klapperten beim Laufen. So wurde ich von den Schulkameraden gehänselt, sie riefen: „Konrad mit dem schwarzen, altmodischen Ranzen und dem klappernden Holzkistchen.“ Mein Vater deutete die Situation so um, ich hätte das Bessere und die anderen Kinder seien nur neidig.
Nach Abschluss der ersten Klasse ging Herr Martin in den wohlverdienten Ruhestand. Unsere neue Klassenlehrerin wurde Fräulein D., eine junge Frau, welche gerade ihr Studium absolviert hatte.
In Klasse drei war wieder Lehrerwechsel, Frau N., eine Frau mittleren Alters, unterrichtete uns als neue Klassenlehrerin.
Das Jahr 1963 sollte mein Glücksjahr nicht sein. Im Februar bekam ich starke Bauchschmerzen. Ein Heizkissen auf dem Bauch sollte die Schmerzen lindern, das Gegenteil war jedoch der Fall. Unsere Hausärztin konnte keine Diagnose stellen, überwies mich also in die Universitätsklinik Leipzig. Noch am Abend fuhr mich mein Vater mit dem Auto in die Liebigstraße. In Leipzig waren die Temperaturen unter minus 20 Grad gesunken und es schneite heftig.
Nach mehreren Untersuchungen stellte dann ein Arzt die Diagnose: Blinddarmentzündung. Noch in der Nacht wurde ich notoperiert, der Blinddarm war vereitert und bereits geplatzt. Am nächsten Tag teilte der Arzt meinen Eltern mit, dass es eine halbe Stunde später – zu spät gewesen wäre.
Nach einer Woche in der Universitäts-Kinderklinik wurde ich zwar entlassen, musste zu Hause aber noch das Bett hüten.
An einem Abend klingelte das Telefon, es war Onkel Karl, der Bruder meines Vaters. Er teilte mit, dass Vater Robert, mein Großvater, verstorben war. Nur eine Woche war er mit Grippe im Bett krank gewesen. Sein Tod kam allen sehr plötzlich. Der Kontakt zu ihm war nicht so eng wie zu meinen Großeltern mütterlicherseits. Vielleicht 4 bis 6 Mal im Jahr besuchten wir ihn in Tautenhain.
Da hatte er mir, seinem jüngsten Enkel, immer seine Kaninchen gezeigt. Sein Tod machte mich sehr traurig. Großmutter Hulda war bereits 1956 verstorben, an sie habe ich keine Erinnerung.
Der Februar überzog das Land mit eisigen Temperaturen und viel Schnee. Die Tiefsttemperatur fiel unter minus 30 Grad. In den Braunkohletagebauen rund um Leipzig stockte die Kohleförderung, gleichzeitig aber wurde mehr Heizmaterial verbraucht. Aus diesem Grund schlossen die Schulen und der Unterricht fiel aus. Ich verpasste durch meinen Blinddarm keinen Schulunterricht. Außerdem führte man nun das Schulfernsehen ein.
Meine Blinddarmwunde heilte, die Temperaturen stiegen und der Frühling zog ins Land. Doch ein Unglück kommt selten allein.
Am Sonnabend, den 16. März wollte ich mit meinen Freunden Fahrrad fahren. Hier muss ich einfügen, dass damals die meisten Leute im Winter nicht Fahrrad fuhren. Im Herbst wurde das Rad geputzt, eingeölt und im Keller oder auf dem Hausboden zur Überwinterung abgestellt. Bei Familie Diebler überwinterten die Fahrräder auf dem Dachboden. Ich bettelte meine Eltern, mir mein Rad vom Boden zu holen. Nach längerem Betteln gaben sie nach und holten mir mein Fahrrad.
Ich fuhr zum Treffpunkt und wir starteten in die Fahrradsaison.
Nach einigen Radrunden machte ein Junge den Vorschlag, mit dem Radfahren aufzuhören und lieber Verstecke zu spielen. Gesagt, getan. Los ging es! Das Gemeinschaftsgrundstück in der Bergmannssiedlung, auf dem wir uns befanden, war mit einem Holzzaun eingefriedet. Vor dem Zaun stand eine große Kiste, welche ungefähr bis zum oberen Zaunriegel reichte. Ich kletterte auf die Kiste und stellte den linken Fuß auf den Riegel zwischen zwei Zaunlatten, dabei verlor ich das Gleichgewicht und stürzte nach vorn. Mein linker Fuß steckte jedoch noch im Zaun. Der Zaun war stabil. Und ich hatte günstiger Weise noch hohe Schuhe an.
Ich schaute nach oben direkt auf meine Schuhspitzen. Freunde befreiten mich aus der misslichen Lage. Doch hatte ich höllische Schmerzen im Bein und konnte nicht auftreten. So setzten mich die Jungs auf mein Fahrrad und schoben mich nach Hause. Der linke Unterschenkel bewegte sich zwischen Knie und Knöchel hin und her. Der Kommentar der Freunde, „das ist nicht so schlimm, höchstens verstaucht“, sollte mich trösten. Zu Hause angekommen, sah mein Vater sofort, was passiert war. Beide Unterschenkelknochen, Schien- und Wadenbein waren gebrochen.
Jetzt war keine Zeit zu verlieren. Vater legte mich in seinen Wartburg-Kombi und fuhr in das St. Elisabeth-Krankenhaus nach Leipzig-Connewitz. In der Notaufnahme wurde das Bein stabilisiert und ich kam auf Station. Zuerst in ein Kindergitterbett, da ein größeres nicht frei war.
Am Sonnabend und dem darauffolgenden Sonntag passierte erst mal nichts. Am Montag sollte der Knochenbruch gerichtet werden. Dies bereitete sehr starke Schmerzen. Ich wurde daher in den OP geschoben und bekam eine Äthernarkose. Als ich aufwachte, war um mein Bett ein Eisengestell errichtet worden, durch die Ferse ging ein Nagel, das Bein war ca. 45 Grad nach oben geneigt. Ein Seil war an dem Nagel befestigt, dieses ging über eine Rolle und am Ende war ein Gewicht angebracht und zog so das Bein auseinander, ein sogenannter Streckverband. Ich konnte mich kaum bewegen, jede Bewegung verursachte starke Schmerzen. Die Röntgenkontrolle ein paar Tage später zeigte, dass die Knochen nicht richtig zueinander standen. Es folgten ein zweiter Versuch, dies zu richten, starke Schmerzen, ab in den OP, Äthernarkose … Nach dem Aufwachen, was nach Äthernarkosen unter starker Übelkeit und Erbrechen geschieht, sah ich mich in der gleichen Lage wie zuvor, im Streckverband.
Das nächste Röntgenbild ergab, dass die Knochen immer noch nicht zusammenpassten. In einer Operation sollten dann die Knochenenden richtig zusammengefügt werden. Ich erhielt diesmal eine Lachgasnarkose. Nach dem Aufwachen, diesmal ohne Übelkeit und Erbrechen, war mein linkes Bein vom Fuß bis ganz, ganz oben unter der Pobacke in Gips. In der Operation waren vier Schlingen aus Silberdraht um mein Schienbein gewickelt worden. Das Wadenbein war glatt gebrochen und benötigte somit diese Prozedur nicht.
Die letzte Operation hatte zwei Wochen nach dem Unfall und Einlieferung ins Krankenhaus stattgefunden.
Nun lag ich acht Wochen mit dem Gipsbein im Bett.
Das St. Elisabeth war ein katholisches Krankenhaus. Die Oberin der Station und ihre Stellvertreterin waren Ordensschwestern. Sie trugen eine bodenlange, schwarze Ordenstracht mit Haube, bei der nur das Gesicht zu sehen war.
Es herrschte ein strenges Regime. Vor der Visite wurden die Betten gerichtet, danach mussten wir still auf dem Rücken liegen und die Arme parallel zum Körper auf der Bettdecke ablegen.
Besuchszeiten waren mittwochs von 15 bis 16 Uhr und sonntags von 14 bis 16 Uhr. Bis zur Besuchszeit war das große Tor in der Biedermannstraße verschlossen. Punkt 14 Uhr wurde es geöffnet und die davor wartenden Angehörigen stürmten auf das Klinikgelände und ins Haus auf die einzelnen Stationen. Dabei konnten schon mal mehrere Minuten der wertvollen Besuchszeit vergangen sein.
Zum Ende der Besuchszeit ging die Oberin mit einem Gong von Zimmer zu Zimmer und forderte die Besucher strikt zum Gehen auf.
Ich lag auf der chirurgischen Männerstation in einem Kinderzimmer mit acht Betten. Brauchte man hier aber ein Bett, wurde ich in einem „Männerzimmer“ mit 16 Betten untergebracht. Vermutlich deshalb, da ich schon die längste Zeit im Krankenhaus lag.
Dort sah ich viel Leid, war aber auch Zeuge von derben Witzen. Eine Krankenschwester betrat einmal in ihrer Freizeitkleidung das Zimmer. Das Kleid besaß einen tiefen Rückenausschnitt, was einen Patienten spontan zu der Äußerung veranlasste: „Schwester, Sie haben Ihr Kleid verkehrt herum an.“
Nach acht Wochen im Krankenbett bekam ich einen sogenannten Gehgips. Der hieß so, weil am Fußende ein Metallbügel eingegipst war und so durfte ich zwei Wochen nach Hause. Nach zehn Wochen im Liegen konnte ich mich nun erstmals wieder mühsam fortbewegen.
Aber ich musste noch einmal ins Krankenhaus. Da sollte der Gips entfernt werden und ich wieder nach Hause gehen dürfen. Der Arzt nahm eine große Schere, um den Gips aufzuschneiden. Dieser war sehr hart geworden. Der Versuch misslang. Der Doktor bekam einen Wutanfall und sagte nur: „Ab, auf Station!“
So war ich schneller wieder im Krankenhaus, nichts mit Gips ab und nach Hause.
Am nächsten Tag legte man mich in eine Badewanne voll warmen Wassers und der Gipsverband löste sich. Zum Vorschein kam ein Bein, das in allen Farben schimmerte. Im Knie konnte ich es nicht beugen. Für die Entzündung gab es Salbe und für das steife Knie Krankengymnastik. Auf dem Bauch liegend beugte der Therapeut das Bein im Kniegelenk, was stark schmerzte.
In Woche 14 nach Einlieferung sollte ich dann endlich entlassen werden. Am Vortag der Entlassung löste sich ein Grind an der Operationsnarbe am Schienbein. Oh Schreck, ein Stück Silberschlinge schaute heraus! Nichts mit Entlassung. In einer weiteren Operation wurde die Schlinge entfernt. Diese Aktion verlängerte den Krankenhausaufenthalt um weitere zwei auf insgesamt 16 Wochen.
Inzwischen war es Mitte Juli und in den großen Ferien. 14 Wochen hatte ich die Schule nicht besucht. Meine Eltern vereinbarten mit der Klassenlehrerin, dass ich nicht nach Klasse 5 versetzt werde.
So besuchte ich ab dem 1. September 1963 nochmals die 4. Klasse. Der Lehrer Herr P., ein noch junger Mann, hatte die Klasse nicht im Griff, sondern die Klasse ihn. Mein Vater sah sich die Geschichte bis zum Halbjahreszeugnis vor den Winterferien 1964 an. Mit dem Schuldirektor Erich Pöschel war er per Du und so reichte eine kurze Bitte: „Erich, nimm meinen Jungen aus der 4 c.“ Und so geschah es, ab dem zweiten Halbjahr besuchte ich die 4 a bei Frau K.
Meine Oma Ida kenne ich nur als herzkranke Frau, man sagte: „Sie hat ein schwaches Herz von der vielen Arbeit.“ Das Laufen fiel ihr schwer, längere Strecken waren nicht möglich, da fiel es ihr leichter, mit dem Fahrrad zu fahren.
Als „Findelkind“ in schweren Verhältnissen bei Pflegeeltern aufgewachsen, hatte sie nur ein Ziel, im Leben etwas zu erreichen.
Aus diesem Grund wollte sie auch nur ein Kind bekommen und großziehen. Damals, in der vorwiegend kinderreichen Zeit, eine Seltenheit. Sie wusste, Kinder kosten Geld und schränken ihre Erwerbstätigkeit ein.
Oma Ida und mein Vater verstanden sich gut, Schwiegermutter und Schwiegersohn waren aus dem gleichen Holz geschnitzt, beide hatten große Not in der Kindheit und Jugend kennengelernt.
Mit starkem Willen, Ehrgeiz, Fleiß und der notwendigen Geschäftstüchtigkeit erarbeiteten sie sich einen bescheidenen Wohlstand.
Meine Großeltern kenne ich nur im Rentenalter. Oma Ida konnte wegen ihrer angeschlagenen Gesundheit nur noch ihren Haushalt versorgen.
Opa Alwin hingegen arbeitete noch in der Tischlerei als Hofarbeiter. Dort sorgte er für Ordnung und Sauberkeit auf dem Holzlagerplatz und in der Werkstatt. Im seinem Wohnhaus, der Leinestraße 2, war er Hausmeister, kehrte Fußweg, Hof, Keller und Trockenboden und schob im Winter Schnee. Dafür bekam er von der Hausbesitzerin einen Mietnachlass, musste nur 20 statt 30 Mark monatlich zahlen.
In den 60er Jahren waren elektrische Waschmaschinen noch eine Seltenheit, die Wäsche wurde mit der Hand auf dem Waschbrett gewaschen. Die große Wäsche machten Oma Ida und meine Mutter für beide Haushalte zusammen in der Leinestraße. Sie dauerte drei Tage lang.
Der Ablauf war wie folgt: Zunächst gab es einen Eintrag im Kalender, der im Treppenhaus hing. Jeder Mieter schrieb dort ein, wann er waschen wollte und somit Waschhaus und Trockenplatz benötigte.
Am ersten Tag wurde die Wäsche mit Sil oder Gemol eingeweicht, so sollte sich der Schmutz schon lösen.
Am zweiten Tag spannte Opa Alwin die Wäscheleine auf dem Hof, diese musste sehr straff gespannt werden, damit die nasse, schwere Wäsche nicht durchhing. Danach heizte er den Waschhauskessel an.
Die Holzwannen wurden mit warmem Wasser aus dem Kessel gefüllt, da hinein kamen Waschpulver und die vorgeweichte Wäsche. Das Ganze wurde mit einem keulenähnlichen Gegenstand aus Holz mehrfach kräftig umgerührt. Je nach Wäscheart und Verschmutzung kam die Wäsche dann aufs Waschbrett, wurde gerubbelt, geknetet und aneinander gerieben. Nach dem Waschgang musste mehrfach und gründlich mit klarem Wasser gespült werden, bis keinerlei Waschmittelrückstände mehr vorhanden waren.
Nach dem Spülgang kam die Wringmaschine zum Einsatz. Zwei drehbare Zylinder standen mit kleinem Abstand übereinander. Mit einer Kurbel wurden die Zylinder gedreht und durch den Spalt die nasse Wäsche gezogen, so dass das Wasser herausgedrückt wurde. Die noch feuchten Wäschestücke kamen auf die Leine und wurden mit hölzernen Klammern befestigt.
Bei Regen konnte die Wäsche nicht auf dem Hof getrocknet werden, wenn möglich, wartete man noch einen Tag länger, d.h. nur, wenn an dem Tag dann kein anderer Mieter den Trockenplatz für sich beanspruchte. Anderenfalls musste die ganze Wäsche auf dem Trockenboden unter dem Dach trocknen. War die Wäsche trocken, kam sie zusammengelegt in den Wäschekorb.