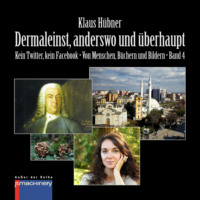Czytaj książkę: «DERMALEINST, ANDERSWO UND ÜBERHAUPT»
Klaus Hübner
Dermaleinst, anderswo und überhaupt
Kein Twitter, kein Facebook – Von Menschen, Büchern und Bildern – Band 4
Außer der Reihe 44
Klaus Hübner
Dermaleinst, anderswo und überhaupt
Kein Twitter, kein Facebook
Von Menschen, Büchern und Bildern
Band 4
Außer der Reihe 44
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe: März 2021
p.machinery Michael Haitel
Titelbild: Leonhard Schorer, Maler des Gemäldes (Johann Christoph Gottsched, 1744, Wikipedia); Alban1989 (Kirche Heiliger Uros und Mulla-Veseli-Moschee in Ferizaj, Kosovo, 2014, Wikipedia CC BY-SA 3.0); Iris Wolff (Privatfoto, iris-wolff.de); ID 942784 (Bild 1006903, Pixabay)
Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda
Lektorat & Korrektorat: Michael Haitel
Herstellung: global:epropaganda
Verlag: p.machinery Michael Haitel
Norderweg 31, 25887 Winnert
www.pmachinery.de
ISBN des Paperbacks: 978 3 95765 235 5
ISBN des Hardcovers: 978 3 95765 236 2
ISBN dieses E-Books: 978 3 95765 860 9
Vorwort
In der Wochenzeitung Die Zeit vom 10. Januar 2019 charakterisiert der 1995 mit dem Büchnerpreis bedachte Dichter Durs Grünbein unsere Gegenwart so: »Jeder sein eigener Handy-Sklave, jeder sein eigener von Computern und Tablets gesteuerter Idiot in der rund um die Uhr aktiven Netzwerkgemeinschaft.« Mir ist das zu pauschal. Jeder? Es gibt viele, die Handy, Computer und Tablet nutzen und trotzdem keine Sklaven oder Idioten sind. Und es gibt eine Menge Leute, die über ihr Tun nachdenken und zu manchem einfach »Nein« sagen. Wer zum Beispiel weder Twitter noch Facebook noch andere angeblich soziale Medien nutzt, wird schon seine Gründe haben. Ein im moralischen Sinne besserer Mensch ist er deswegen noch lange nicht. Ein ignoranter Technik- und Modernitätsverweigerer wohl auch nicht. Was aber dann? Man muss ihn sich nicht zwingend als einen Menschen vorstellen, der eher von Künstlern, Büchern, Bildern, Städten und Landschaften angeregt wird als von noch schnelleren Rechnern und noch spezielleren Apps. Aber man darf. Auch als einen, der weiß, dass es nicht wenige Zeitgenossen gibt, denen es ähnlich geht. Für solche Menschen ist dieses Buch gedacht.
»Das Buch mag den neuen, scheinbar körperlosen, sein Erbe beanspruchenden, in überbordendem Maß Informationen zur Verfügung stellenden Medien in vielem unterlegen und ein im ureigenen Sinn des Wortes konservatives Medium sein, das gerade durch die Abgeschlossenheit seines Körpers, in dem Text, Bild und Gestaltung vollkommen ineinander aufgehen, wie kein anderes die Welt zu ordnen, manchmal sogar zu ersetzen verspricht«, schreibt die 1980 geborene Judith Schalansky im Vorwort ihres 2018 erschienenen Buchs Verzeichnis einiger Verluste. Dass weniger Bücher, vor allem weniger literarische Texte gelesen werden als noch vor zehn oder zwanzig Jahren, ist ein Faktum. Das verheißungsvoll und schön klingende Wort »Sprachkunstwerk« hört sich heute sehr gestrig an. Wer ist neugierig auf Sprachkunstwerke? Und – um die Schraube noch weiter zu drehen – wer liest heute überhaupt noch Bücher über Bücher? Allzu viele Leute werden es nicht sein. Aber die sind wichtig. Wäre ich davon überzeugt, dass eine umfangreiche Sammlung von Interviews mit Literaten, literarischen Essays, Künstlerporträts, Glossen und Streiflichtern aller Art und obendrein auch noch vielen Buchrezensionen ein altmodisches und tendenziell nutzloses Unterfangen ist, hätte ich auf die Arbeit an diesem Projekt verzichtet und mich stattdessen – lesend natürlich – in einen wundermilden Biergarten zurückgezogen. Oder sonst wohin. Aber ich weiß ganz sicher, dass es immer noch einige, darunter auch relativ junge Leute gibt, die mit Interesse und manchmal mit Begeisterung genau das suchen: Begegnungen mit Literatur, mit Malerei, mit Kulturgeschichte – und mit den Menschen, die sie machen und gestalten. Auch die weiterhin enorme Aufmerksamkeit für Literaturfeste, Autorenlesungen, Ausstellungen und andere Kulturevents spricht dafür. Trotz des allenthalben konstatierten und oft bitter beklagten gesellschaftlichen Bedeutungsverlusts von Kunst und Literatur können sich nur wenige Zeitgenossen ein Leben ganz ohne sie vorstellen. Und, nennen Sie mich ruhig einen Träumer, einen Fantasten oder einen hoffnungslosen Idealisten: Auch heute noch – und höchstwahrscheinlich auch in nächster Zukunft – lassen sich der Kunst und der Literatur soziale Funktionen zuschreiben, die nicht die allerunwichtigsten sind. Die Förderung der Wachheit und Aufmerksamkeit für ein lebenswertes und vielleicht sogar schönes Leben – nicht nur für sich selbst – könnte man da anführen, die Erweckung und Intensivierung von Empathie für nicht konforme Mitmenschen und zunächst fremd anmutende Kulturen, die Weiterentwicklung verantwortungsvollen Handelns in Politik und Gesellschaft und noch manches mehr. Ich bin zum Beispiel ziemlich sicher, dass die deutsche Einwanderungs-, Flüchtlings- und Asylpolitik anders und besser aussehen würde, hätten die maßgeblichen Politiker und andere wichtige Entscheidungsträger die spätestens seit den 1990er-Jahren kaum noch zu übersehende interkulturelle Literatur – mit ihren vielfältigen Blicken »von außen« – wirklich wahrgenommen. Ich bin auch recht sicher, dass die intensive Lektüre von Literatur und Dichtung dazu führen kann, die überall festgestellte und kritisierte Verrohung der öffentlichen wie der privaten Sprache zu erkennen, nicht auf sie hereinzufallen oder ihr sogar bewusst entgegenzutreten. Und ich bin … oh weh, doch ein hoffnungsloser Idealist? Urteilen Sie selbst, fangen Sie einfach an zu lesen …
Das Projekt Kein Twitter, kein Facebook ist auf vier Bände angelegt und enthält ungefähr zwei Drittel meiner in den letzten beiden Jahrzehnten entstandenen Texte. Alle wurden leicht überarbeitet. Irgendwelche Positionierungen auf politischen, wissenschaftlichen oder kulturellen »Feldern« sind mit diesem Projekt nicht beabsichtigt. Nachweise der Erstpublikationen finden sich am Ende jedes Einzelbandes. Die Regelkonformität der Rechtschreibung ist der Lesbarkeit untergeordnet. Das modische Thema »Sprache und Gender« bleibt außen vor. Zu danken wäre vielen Freunden und Kollegen, auch wenn sie von meinen Plänen nichts wussten. Einer, der davon wusste, war der Schriftsteller Tiny Stricker, der mich zu diesem Projekt fast schon überreden musste und das mit Feingefühl und Beharrlichkeit getan hat. Danke, Tiny! Voilà, hier ist der vierte Band …
München, im Januar 2021
Klaus Hübner
Nicht nur Literaturgeschichten
Doch ist der Ruf erst ruiniert …
Vor dreihundert Jahren wurde Johann Christoph Gottsched geboren
Es gibt wohl kaum einen bedeutenden deutschen Schriftsteller und Universalgelehrten, der im literarischen Gedächtnis der Nation eine derart katastrophale Wirkungsgeschichte hat wie der am 2. Februar 1700 in Juditten bei Königsberg als Sohn des dortigen Pfarrers geborene Johann Christoph Gottsched. Sein Name steht zwar nach wie vor in allen Literaturgeschichten – aber was da steht, ist in aller Regel wenig dazu angetan, sich mit dem Werk dieses zeitlebens unglaublich produktiven Mannes näher zu befassen. Auch der immer mal wieder, zuletzt mit einer schönen Ausgabe ihrer Briefe von 1730 bis 1762 versuchte Umweg über Gottscheds für die damalige Zeit durchaus ungewöhnliche Frau, die hoch gebildete, selber dichterisch tätige Louise Adelgunde, verschafft nicht den für viele Zeitgenossen unbedingt nötigen »human touch«. Gottscheds Ideal einer »geschickten Gehülffin« an seiner Seite und Louises Idee einer auf Gleichberechtigung basierenden Ehe seien letztlich »unvereinbar« gewesen, schreibt die Brief-Herausgeberin Inka Kording, und man kann sich schon vorstellen, wie die beiden tagaus tagein vor sich hinwerkelten am Rohbau der deutschen Gelehrtenrepublik und der Beförderung einer deutschen Nationalliteratur. Starr, spröde und trocken sei es zugegangen bei den langweiligen und pedantischen Gottscheds, sagt man. Und bald hat auch ihr Werk genau diesen, also einen schlechten Ruf weg. Und man muss, bei allem Respekt, auch heute sagen: weitgehend zu Recht.
Als der junge Gottsched zusammen mit seinem Bruder 1724 vor den Soldatenwerbern aus Ostpreußen nach Leipzig floh und sich dort, ausgestattet mit Empfehlungsschreiben und gefördert von Professoren wie Johann Burkhard Mencke, peu à peu als Schriftsteller, Herausgeber, Übersetzer, Bibliograf und Literaturtheoretiker etablierte, schien alles noch in Ordnung. Bald galt er als einflussreicher Repräsentant einer Kunst- und Dichtungslehre, die der rationalistischen Philosophie seiner Zeit verpflichtet war – die Schriften von Locke, Grotius, Pufendorf, Thomasius und Wolff hatte er intensiv studiert. Emsig beschäftigt mit allerlei literarisch-philosophischen Aktivitäten, mit Beiträgen und Übersetzungen für seine Wochenschriften und mit der Reform des deutschen Theaters (oder wenigstens der Neuberschen Truppe), wurde Gottsched 1730 Außerordentlicher Professor für Poesie und Beredsamkeit und 1734 dann Ordentlicher Professor für Logik und Metaphysik. Doch in den schlechten Ruf eines Dogmatikers geriet er schon in den Vierzigerjahren, als er in seinen Streitereien mit den Zürcher Kritikern Johann Jacob Bodmer und Johann Jacob Breitinger über die poetologischen Kategorien des Wunderbaren und des Wahrscheinlichen immer mehr ins Hintertreffen geriet – wozu er selbst, rechthaberischer und verbitterter werdend, kräftig beitrug. Der große Lessing hat den Theaterreformer, wie man weiß, in seinem 17. Literaturbrief in Grund und Boden verdammt, und Goethe, dessen Verdikte über Zeitgenossen bekanntlich sehr lange nachwirkten, hat den alten Professor in Dichtung und Wahrheit lächerlich gemacht – unvergesslich die Szene mit dem kahlköpfigen Gottsched, der sich die »große Allongeperücke« reichen lässt und seinen armen Bedienten ohrfeigt. Aber abgesehen davon: Fast zwei Jahrhunderte lang war die deutsche Frühaufklärung sowieso ziemlich verpönt, und als sie es dann seit den Sechzigerjahren des 20. Jahrhunderts nicht mehr war, wies man dem alten Gottsched oft einen kulturhistorischen Ort zu, der den Barockdichtern des 17. Jahrhunderts näher war als den meisten seiner Zeitgenossen. Als Verfasser panegyrischer Auftragsdichtung wurde er überhaupt nicht mehr ernst genommen, als genuiner Lyriker auch nicht, und dem Verfasser von Dramen wie dem nach 1732 für lange Zeit äußerst erfolgreichen Sterbenden Cato wird sogar vom Herausgeber des Stückes jegliche Zukunftsfähigkeit abgesprochen. Man könne Gottscheds wohlgesetzte Alexandriner heute kaum anders denn leblos und klappernd empfinden, schreibt Horst Steinmetz, und die Regelmäßigkeit dieses Werks erscheine nur noch als »erstarrte Gleichförmigkeit«; über den dichterischen Wert oder vielmehr Unwert des Sterbenden Cato (und, so darf man ergänzen, aller anderen Bühnenwerke Gottscheds) gebe es seit Langem keine Diskussionen mehr. Vor allem sei eine Aufführung dieses Dramas heute »undenkbar« – und das von Bodmer als mit »Kleister und Schere« verfertigtes Machwerk verspottete Stück ist auch, so weit man sieht, seit ewigen Zeiten nicht mehr aufgeführt worden. Als eigenständiger Poet ist sein Verfasser wohl ganz zu Recht vergessen, und eigentlich ist er das schon seit Miss Sara Sampson.
Aber da war doch noch der Versuch einer Critischen Dichtkunst vor die Deutschen, 1730 erstmals erschienen und bis 1751 mehrfach umgebaut und erweitert – ein Werk, in dem der Literaturtheoretiker all die Gesetze und Regeln übersichtlich dargestellt hatte, ohne deren Beachtung angeblich keine Dichtung bestehen konnte? Das Prinzip der Naturnachahmung wird dort erläutert, die Forderung nach Wahrscheinlichkeit, das Gesetz von den drei Einheiten, vor allem aber das Gebot, dass Dichtung einen moralischen Lehrsatz veranschaulichen und dem Publikum nahe bringen müsse – womit sie in den Dienst des moralpädagogischen Erziehungs- und Bildungsprogramms der Aufklärung gestellt wird. Und der Autor gleich dazu: »Eine gar zu hitzige Einbildungskraft macht unsinnige Dichter, dafern das Feuer der Fantasie nicht durch eine gesunde Vernunft gemäßiget wird.« Als historisch bedeutende »Wirkungspoetik« hat Horst Steinmetz Gottscheds Versuch charakterisiert und ihm, über Goethes und Schillers klassische Phase hinaus, subtile Nachwirkungen bis ins 19. Jahrhundert hinein attestiert. Als Kritik der deutschen Literatur und Schaubühne ihrer Zeit hat die Critische Dichtkunst gewiss ihre Meriten – was ihre Lektüre allerdings nicht attraktiver macht. Das gilt auch für die Deutsche Schaubühne aus den Vierzigerjahren, eine zusammen mit Louise Adelgunde erstellte Sammlung sogenannter Musterdramen, unter ihnen fünf eigene. Was aber ist mit seiner Ausführlichen Redekunst von 1736, sieben Jahre vor Gottscheds Tod in einer fünften Auflage verbreitet? Und was mit den zahlreichen anderen Schriften, mit den Übersetzungen, Baylens Wörterbuch immerhin, Lucians Schriften oder die Théodicée von Leibniz – vergessen, auch noch zu Recht vergessen dies alles? Schließlich die Person: der Universitätsgelehrte, noch dazu einer der bedeutendsten und wirkungsmächtigsten seiner Zeit, der explizit bürgerliche Professor in einer vom Adel dominierten Umwelt, nicht zuletzt der unermüdliche Pädagoge, der unbeirrte Trommler für die Bildung des Volkes und, damals fast avantgardistisch, gerade auch der Frauen? Schon recht, diese Nachfragen – aber es hilft alles nichts: Gottsched hat, sei je und quasi überall, schlechte Karten. Gewiss lobt man das historische Verdienst seiner Poetik, aber zugleich stellt man die auch in nationalem Konkurrenzdenken begründeten Aversionen gebührend heraus, gegen Ariost, Tasso, Milton, Shakespeare und viele andere Dichter, die man später höchlich schätzte. Was an Gottsched weist überhaupt in ein »Später«? Die unbedingte Unterordnung der praktischen Bühnenarbeit unter die erzieherischen Prämissen der Bühnendichtung, das war damals gut gemeint und gegen die in der Tat wenig niveauvollen Zustände um 1725 gerichtet – doch was könnte zweihundertvierunddreißig Jahre nach Gottscheds Tod unzeitgemäßer, unbeliebter, lächerlicher sein? Das Verdikt gegen die Oper, die das »ungereimteste Werk« sei, »das der menschliche Verstand jemals erfunden« habe? Sein Kampf gegen den »Schwulst« der sogenannten zweiten schlesischen Schule, namentlich des von Hubert Fichte in den 1970er-Jahren mit enthusiastischem Gestus wieder entdeckten Casper von Lohenstein? Gottscheds Bemühung um eine fundamentale Sprachreform mit dem Ziel einer einheitlichen neuhochdeutschen Schriftsprache, orientiert am »Meissnischen Deutsch« seiner Wahlheimat, mag zu Zeiten lebhafter Auseinandersetzungen um die deutsche Rechtschreibung noch am ehesten auf Interesse hoffen können – immerhin hatte ihn Kaiserin Maria Theresia 1749 einen »Meister der deutschen Sprache« genannt und war, hingerissen vom Gespräch mit ihm und seiner Gattin, zu spät zur Messe gekommen. In der Grundlegung einer Deutschen Sprachkunst (1748; 6. Aufl. 1762) findet sich allerlei Bedenkenswertes über Syntax, Etymologie, Prosodie und eben auch über die Rechtschreibung des Deutschen. Liegt es auch am heute so unattraktiv Paukerhaften dieses Mannes, dass Gottsched in der Reformdebatte der letzten Jahre keine Rolle spielte? An seiner patriarchalen Pädagogik, mit der er seine großen Ideen zu hausbackenen Lerngegenständen herabwürdigte? Man weiß es nicht sicher, sieht aber deutlich, dass hier nicht viel zu machen ist – auf irgendeine Art »sexy« ist dieser Mann einfach nicht, für Sensationen eignet er sich auch nicht, und zur »Ikone« gar wird er es niemals bringen.
Resümieren wir also ganz nüchtern: Johann Christoph Gottsched führt heute nur noch in germanistischen Seminaren ein eher kümmerliches Leben, und eigentlich tut er das schon, seit es solche Seminare gibt. Man liest ihn nicht freiwillig oder gar gerne, und das wird wohl so bleiben. Dieses Schicksal teilt er zwar mit den meisten Schriftstellern und Gelehrten seiner Zeit – die deutsche Dichtung nach Grimmelshausen und vor Lessing scheint uns Heutigen weitgehend unattraktiv. Gottsched aber trifft es noch härter als andere. Eine derart immense Gelehrsamkeit wie die seine nötigt noch immer einigen Respekt ab, seine Schaffenskraft sicherlich auch. Das war dann aber auch schon alles. Johann Christoph Gottscheds Ruf bleibt ruiniert, und sein dreihundertster Geburtstag wird daran kaum etwas ändern.
Die bisher umfangreichste Gottsched-Edition ist die zwölfbändige, von Joachim Birke, Brigitte Birke und Phillip Marshall Mitchell besorgte Auswahlausgabe (Berlin 1968–1987); ihr letzter Band enthält auch eine umfangreiche Bibliografie zu Gottscheds Leben und Werk. Die von Horst Steinmetz herausgegebenen Einzelausgaben der Critischen Dichtkunst und des Sterbenden Cato sind in Reclams Universal-Bibliothek erhältlich; Steinmetz hat auch einen Neudruck der Deutschen Schaubühne kommentiert und herausgegeben (Stuttgart 1972). Louise Gottscheds Briefe aus den Jahren 1730 bis 1762 sind, herausgegeben von Inka Kording, unter dem Titel Mit der Feder in der Hand erschienen (Darmstadt 1999).
Im Netzwerk
Neues über Bodmer und Breitinger
»Was ist dichten anders, als sich in der Fantasie neue Begriffe und Vorstellungen formieren, deren Originale nicht in der gegenwärtigen Welt der würklichen Dinge, sondern in irgend einem andern möglichen Welt-Gebäude zu suchen sind. Ein jedes wohlerfundene Gedicht ist darum nicht anderst anzusehen als eine Historie aus einer anderen möglichen Welt.« Das stammt von Johann Jakob Bodmer (1698–1783) und steht in seiner 1740 veröffentlichten Critischen Abhandlung von dem Wunderbaren in der Poesie und dessen Verbindung mit dem Wahrscheinlichen. Dieses Werk wird zitiert, sobald es um den für das 18. Jahrhundert zentralen, bisweilen sehr hitzig ausgefochtenen »Literaturstreit« zwischen den »Leipzigern« und den »Zürchern« geht. Der Zwist mag heute nur noch Germanisten interessieren, Bodmer aber bleibt eine hochinteressante Persönlichkeit, ebenso wie sein Freund und Mitstreiter Johann Jakob Breitinger (1701–1776). Dass man sie, weit über ihre Schriften gegen Gottsched und Konsorten hinaus, als Überväter des geistigen Zürich im 18. Jahrhundert und damit als Begründer einer neuen intellektuellen Metropole Europas bezeichnen darf, legt ein ziegelsteingroßer, brandaktueller und streckenweise sehr spannender Sammelband nahe, den ironischerweise zwei an der Universität Bern lehrende Expertinnen herausgegeben haben. Eine von ihnen, Barbara Mahlmann-Bauer, hat Bodmer und Breitinger übrigens einen lesenswerten Beitrag in der Zeitschrift Der Deutschunterricht (4/2009) gewidmet – deren Schwerpunktthema heißt, für eine deutsche Fachzeitschrift beinahe sensationell: »Zürich«.
Die beiden Johann Jakobs, die von der Geschichtsschreibung und der geisteswissenschaftlichen Forschung bis vor Kurzem arg vernachlässigt worden sind, haben es in sich. Das neue, aus einer Zürcher Tagung hervorgegangene Grundlagenwerk versucht, ihrem reichhaltigen Lebenswerk mit zweiunddreißig auf sieben Abteilungen verteilten Aufsätzen und einem nützlichen Anhang gerecht zu werden und mit alten Vorurteilen aufzuräumen. Die ersten fünf Studien, darunter ein grandioser Essay von Carsten Zelle, widmen sich der »Ästhetik und Poetik« der beiden Zürcher. Dann geht es um »Theologische Positionen«, wobei das Collegium Carolinum eine wichtige Rolle spielt – wie denn überhaupt herauszustellen ist, dass die Verwurzelung Bodmers und Breitingers in ihrer Vaterstadt in diesem Buch sehr zu Recht gebührend berücksichtigt wird. Das gilt besonders für die dritte Abteilung, die die Überschrift »Bodmers Schauspiele und vaterländische Geschichte« trägt, aber auch für die vierte, die »Zürcher Schüler und Zeitgenossen« vorstellt, unter ihnen Lavater, Hirzel, Klopstock und Wieland. Zwei äußerst aufschlussreiche Abhandlungen machen Teil V aus: Christoph Eggenberger beschäftigt sich mit Bodmers »Entdeckung« der Manessischen Liederhandschrift, und Gesine Lenore Schiewer nimmt seine Sprachtheorie unter die Lupe – zu beiden Themen hätte man, kritisch sei’s angemerkt, gerne noch mehr gelesen. Weitere fünf Studien drehen sich um die »Beziehungen zu den Künsten und zur Musik«, und die Abteilung VII bildet Urs B. Leus hilfreiche Arbeit über Bodmers Privatbibliothek. Natürlich ist das Ganze, wie schon die luzide Einleitung deutlich macht, auf dem neuesten Stand der Forschung. Um Lesbarkeit hat man sich ebenfalls bemüht – sprachliche Verstiegenheiten sind selten. Fazit: ein dicker kulturwissenschaftlicher Wälzer, das schon. Aber quicklebendig und hochinteressant für alle, die sich für die Vergangenheit des intellektuellen Zürich und die Geistesgeschichte der Schweiz begeistern lassen.
Anett Lütteken / Barbara Mahlmann-Bauer (Hrsg.): Johann Jakob Bodmer und Johann Jakob Breitinger im Netzwerk der europäischen Aufklärung. Göttingen 2009: Wallstein Verlag. 880 S.