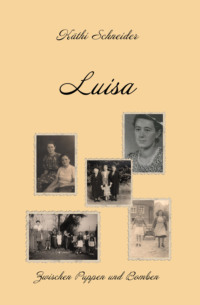Czytaj książkę: «Luisa - Zwischen Puppen und Bomben»

o
Luisa
Zwischen Puppen und Bomben
Käthi Schneider

o
Impressum:
Personen und Handlungen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet - herzsprung-verlag.de
© 2021 – Herszprung-Verlag
Mühlstraße 10, 88085 Langenargen
Alle Rechte vorbehalten.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Hardcoverauflage erschienen 2020
Lektorat: CAT creativ - www.cat-creativ.at
Cover: gestaltet mit Bildern von Käthi Schneider privat;
Hintergrundbild: © lynea; Bilderrahmen: Pixi – Adobe Stock lizenziert
ISBN: 978-3-96074-412-2 - Taschenbuch
ISBN: 978-3-96074-359-0 - E-Book
*
Inhalt
Impressum
Prolog
Wünsche
Kinderzeit
Kindergarten
Fliegeralarm
Scheinwerfer und Sirenen
Erste Schritte
Meine Mutter
Geborgen
Bei Tante Fischer
An Großvaters Hand
Meine Großeltern
Neues Zuhause
Sternenflug
Meine neuen Eltern
Langer Schulweg
Maikäfer flieg
Dämmerstunde
Ausgenutzt
Unsere eigene Schule
Tante Lottchen
Badespaß im Herthasee
Frau Bonnet
Ein Sommerferientag
Gewitternacht
Hochzeit
Backhausfreuden
Suchaktion
Enttäuscht
Den Regen aufgefangen
Suche im Wald
Erntezeit
Drachen steigen
Im Dorf
Schlachtfest
Winter im Dorf
Freundschaft
Sonntagsausflug
Merenberg
Sommerferien in Niederneisen
Meine Konformation
Unsere Kirmes
Mit Vater unter Tage
Die Autorin
Danksagung
Buchtipp
*
Prolog
Was ich hier zu Beginn meiner Kindheitsgeschichte erzähle, erfuhr ich mit zwölf Jahren. Ich war eingeladen in dem Dorf meiner jüngsten Kindertage. Tante Fischer, eine Nachbarin meiner Großeltern, erzählte mir von meiner Mutter, meinen Geschwistern, wie wir damals in den Kriegsjahren lebten. Ich schrieb mir vieles auf von unserer Familie. Besonders die Gespräche, die Tante Fischer mit mir führte, rührten mich sehr. Sie ließ mich schreiben: „Für später!“, sagte sie und lächelte.
Wie recht sie hatte! Denn nun will ich beginnen, für meine Familie und vielleicht auch für meine Freunde zu erzählen. Die Notizen, die ich damals machte, lagen gut behütet in meinem Poesiealbum. Was mir beim Schreiben half, war, dass Tante Fischer damals mit großer Vorsicht meine Fragen beantwortet hat. Ich hatte meine Feder gespitzt – die Worte purzelten fast von allein aufs Papier.
Mein grosses Glück, meine Freude und Dankbarkeit ist es, das ich vor vierundzwanzig Jahren zu schreiben beginnen konnte. Es sind unzählige Geschichten und Gedichte entstanden. Sie erzählen auch von meiner Kindheit wie ich aufwuchs, in meiner neuen Heimat ...
Beginnen will ich mit einem Gedicht.
*
Wünsche
Ich möchte zu den Sternen fliegen
mich auf der silbernen Mondsichel wiegen
durch fremde Galaxien reisen
die Unendlichkeit des Weltalls preisen
Möchte auf die höchsten Berge steigen
mit einem Drachen über ihre Gipfel gleiten
möchte dem Gesang der Vögel lauschen
mit nackten Füßen durch Wiesen laufen
Mit Freude dem Klappern der Störche zuhören
lass mich vom Ruf des Kuckucks betören
will mich spielend hinter Bäumen verstecken
versuche mein wahres Ich zu entdecken
Mein Name ist Luisa, sieben Jahre
*
Kinderzeit
Wir lebten in einem Dorf an der Aar. Meine Eltern mit uns drei Geschwistern. Mein Vater war nicht mein leiblicher Vater, trotz allem trug ich seinen Namen. Ich war die Älteste, neben meiner Schwester Sieglinde und meinem Bruder Hans-Robert.
Von meinem leiblichen Vater bekam Mutter den Bescheid von der Wehrmacht, dass er gefallen sei. Genaueres wurde der Verlobten nicht mitgeteilt. Als er eingezogen wurde, hatten sie sich verlobt, wollten bei seinem ersten Urlaub heiraten. Meine Mutter war mit mir schwanger. Die Nachricht traf sie wie ein Blitz. Ihre kleine glückliche Welt brach zusammen. Was sollte nun werden, fragte sie sich verzweifelt.
Ein junger Mann aus dem Dorf, der sie, wenn sie sich begegneten, nicht aus den Augen ließ, hatte ihr Unglück wohl schnell erfahren. Er hielt bei Opa um ihre Hand an. Opa kannte ihn als Kunden in seinem Friseursalon. Er stimmte zu und bat Mama, ihn zu heiraten, bevor ich geboren wurde. Er war Beamter bei der Bahn, verdiente gut, würde mich adoptieren, versprach er Mutter. Als sie ihn näher kennenlernte, war sie einverstanden. Die beiden heirateten.
Das Leben für Mutter sei nun gesichert, dachte mein Großvater. Leider war das Glück nur von kurzer Dauer.
War der Kindergarten nachmittags zu Ende, wurde ich zu meinen Großeltern gebracht. Da Opa noch Kundschaft in einem Friseurladen hatte, Oma oft krank war, nahm ihre jüngere Nachbarin Johanna Fischer ihr dieses temperamentvolle Mädchen ab. Mit mir kam Mathilde, wir beide waren unzertrennlich.
Tante Fischer war gut vorbereitet, hatte den Spielekasten, weißes Papier und Buntstifte bereit. Mathilde konnte damals schon gut malen. Ich sah ihr zu und war mir sicher, dass wir, wenn das Bild fertig war, die Blumen pflücken könnten. Tante Fischer las uns Geschichten vor, sie konnte wunderbar Märchen erzählen. Von ihr lernten wir so viel. Opa brachte uns dann gegen Abend zu unseren Eltern.
Tante Hanna Fischer war nicht mit uns verwandt, nicht unsere wirkliche Tante. In der damaligen Zeit durften wir Kinder zu allen erwachsenen Frauen Tante sagen, das war eben so. Wir wussten, jede von ihnen würde uns beschützen. Denn was wir erlebten, traumatisierte uns alle, auch die Erwachsenen. Ständig und ohne Vorwarnung mussten wir in den Luftschutzkeller laufen, ob bei Tag oder Nacht. Manchmal waren Keller alle überfüllt. Das war die größte Angst meiner Mutter, mit drei kleinen Kindern, meist in der Dunkelheit, einen sicheren Platz zu finden. Die Bomben fallen zu sehen und zu hören. Das kann ich nicht schildern, das muss man erleben, um von diesem Elend zu erfahren. Von den Feuerpilzen, dem pfeifenden Geräusch der herabfallenden Bomben, die die Häuser einstürzen ließen, den Schreien der Sterbenden, den Verletzten oder den Verschütteten.
War der Angriff vorbei, sammelten sich die wenigen Männer, die nicht zum Wehrdienst eingezogen worden waren – Männer mit einer vererbten Erkrankung oder Verunglückte, sie wurden ausgemustert. Das hörte ich Vater zu meinem Onkel sagen. Sie beide gehörten nicht dazu. Sie waren Beamte bei der Reichsbahn. Züge fuhren, wenn auch wenige private, Herr H., dessen Namen ich nicht ausspreche, brauchte für die Transporte der vielen Menschen auch sehr viel viele Züge. Das erfuhr ich aber erst als Sechzehnjährige. Damals gruben und gruben sie, diese Handvoll Männer, wenn nach einem Angriff alles in Scherben, nein in Trümmern lag, suchten und fanden die Toten und Verletzten, andere mit Brandwunden. Wir hörten ihre Schreie, so etwas vergisst man nie.
Was mir die allergrößte Angst machte, war das Geräusch der Flak, wenn unsere Soldaten versuchten, die angreifenden Flugzeuge abzuschießen. Erst viel später wusste ich, wie selbstverständlich die Frauen und Mütter ein dichtes Netz an Hilfe und Fürsorge für uns Kinder ins Leben gerufen hatten, damit wir nicht alleine waren, einen Angriff alleine erlebten, allzu große Ängste abfingen. Zurück zu der Aar. Die Aar ist ein kleiner Fluss, der bei Taunusstein entspringt und bei Diez in die Lahn mündet, heute im Bundesland Rheinland-Pfalz.
Die stattlichen Häuser und Bauernhöfe in meinem Heimatdorf wurden um einen Bergkegel herum erbaut. Die gepflasterte Hauptstraße führte im Halbrund um diesen Berg und teilte – und teilt natürlich auch heute – das Dorf in Ober- und Unterdorf. Hinter den Gärten fließt die Aar vorbei. Städte und Dörfer, die an einer Bahnlinie lagen, waren ein beliebtes und schnell gefundenes Ziel der feindlichen Geschwader, ihre tödliche Fracht freizugeben, unser Land zu zerstören.
Wir lebten im Unterdorf, in einem kleinen Fachwerkhaus. Im Parterre gab es ein großes Zimmer, das Mutter in eine Küche und ein winziges Wohnzimmer verwandelt hatte. Und eine kleine Kammer, in der die Magd unseres Vermieters schlief. Wie Mutter uns oben in ihrem Schlafzimmer und der kleinen Kammer schlafen ließ, darin erinnere ich mich nicht genau.
Eines Nachts wachte ich auf, als etwas Helles mir in die Augen schien. Ich war sofort hellwach. „Mama!“, rief ich. Sie war nicht da. Doch ich lag in ihrem Bett, sah mich erschreckt um. Ja, das war Mamas Bett. Das Holz war braun, mit dicken Holzkugeln oben auf beiden Seiten, wo mein Kissen lag. Der helle Schein tat mir weh. Ich legte schnell meine Hände über die Augen, sah durch die Finger hindurch. Nun war es besser. Verschlafen saß ich neben unserem Schlafzimmerfenster. Es war verdunkelt. Mama hatte eine Wolldecke davor gehängt, die Decke war verrutscht.
„Hell erleuchte Fenster verraten uns“, sagte Mama. So könnten wir das Ziel der vielen Bomben werden, die nachts über unserem Land abgeworfen wurden. Deshalb musste ganz Deutschland alle Fenster sorgfältig verdunkeln. Ich war so verschlafen, begriff nun aber, was mich aufgeweckt hatte: Die Suchscheinwerfer hatten mich getroffen, durch die Lücke und an der Wolldecke vorbei. Müde legte ich mich wieder hin und hoffte, dass Mama bald käme. Ich muss noch klein gewesen sein, vielleicht vier Jahre alt.
Ich erinnere mich auch an meinen Puppenwagen, er war beige, wie ein Korb geflochten, mit großen Rädern, die laut ratterten, wenn ich mit ihm durch den Hof sauste. Meine Schwester, zwölf Monate alt, rutschte die Treppe von der Haustür herab. Ich bekam sie irgendwie in den Wagen gesetzt und rannte mit ihr los. Von unserem Gejauchze angelockt, kam Mutter aus dem Haus, lief auf mich zu und rettete mein Schwesterchen vor einem sicheren Sturz.
*
Kindergarten
Meine erste Freundin hatte ich schon, bevor ich sprechen konnte, ja, das war Mathilde. Sie hatte lange schwarze Lockenhaare und die lustigsten braunen Augen. Die Familie wohnte in der Nachbarschaft. Wir wurden sehr früh in den Kindergarten aufgenommen, vielleicht bedingt durch die Kriegszeit. Unsere Mütter gingen zu den Bauern arbeiten, damit wir etwas zu essen hatten.
Mit drei Jahren brachte meine Mutter mich in den Kindergarten. Das war der Ort, an dem ich mich wohlfühlte, wenn meine Mutter nicht bei mir war. Nur gute Gefühle erinnern mich an diese Zeit. Das Haus hatte ein flaches Dach, stand mit der Giebelseite zur Straße. Ich sehe alles klar vor mir, sogar an die Spielsachen kann ich mich erinnern.
Hinter der großen Fensterreihe lag unser Spielraum, der auch das Ess- und Schlafzimmer war. Wir konnten über den Hof sehen. Die Kindergärtnerinnen hatten uns immer im Blick, wenn wir Nachlaufen spielten oder im Sandkasten Burgen bauten. Der Sandkasten war rings um den dicken Nussbaum angelegt. Ein kleiner Regenschauer konnte uns nichts anhaben, wenn wir dort spielen.
Vom Hof führte eine Treppe ins Haus. Zuerst kamen wir in den Vorraum. Gegenüber der Eingangstür waren zehn kleine, weiße Waschbecken an der Wand, aus weißem Metall, einige hatten Roststellen. Sie hingen ganz niedrig, eben für Kindergartenkinder, damit wir uns die Hände waschen konnten. Das taten wir besonders gern.
Mittags bekamen wir warmes Essen, wir gingen gerne an den Tisch, denn Hunger hatten wir immer. Nach dem Essen durften wir noch einmal an den kleinen Waschbecken unsere Hände waschen. Die Seife roch nach Honig, wir bekamen nicht genug davon.
Neben den Waschbecken – an einer langen Holzleiste – waren kleine bunte Holzschildchen mit Tieren oder Blumen bemalt. Jedes Kind hatte seine eigenen zwei Schilder. An die Haken hängten wir unsere Jacken oder Mäntel und die Kindergartentäschchen. An einem dritten Schildchen bei den Waschbecken hing ein Handtuch.
Ein großer Raum, sonnendurchflutet, war mehr als ein Zuhause. Es war der Lieblingsort von mir und von Mathilde, meiner besten Freundin. Während wir Kinder nach dem Mittagessen noch einmal im Vorraum unsere Hände waschen durften, wurden im großen Zimmer Tische und Stühle an die Wände gestellt, Liegestühle aufgeklappt, die grünen Fensterläden geschlossen. Wolldecken und kleine weiße Kissen verteilt. Mein Liegestuhl stand an der Wand.
Tante Inge legte uns alle nacheinander schlafen. Manche Kinder wollten nach Hause zu ihrer Mutter, sie weinten, doch sie schaffte es an jedem Tag, sie zu beruhigen. „Kind, lejsch disch do hin un kuschel disch in dat Kissje“, sagte sie. Ich spüre noch heute die Hand, die mich fest in die weiche Wolldecke einpackte und mir über den Kopf strich. Das Kisschen roch nach Rosen, ich roch und roch und schlief darüber ein.
In unserer Spielezeit lagen auf den Tischen viele bunte Dinge, Malstifte, buntes glänzendes Papier und Krepppapier zum Basteln. Am liebsten spielte ich mit kleinen glänzenden, leuchtend bunten Steinchen aus Porzellan, Muckelsteine wurden sie genannt. Es waren Halbkugeln, mit denen ich Muster auf die Tischplatte oder den vorbereiteten Karton legen konnte, bunte Blumen, Tiere und viele Figuren. Und dann gab es ein Fernglas, ein Kaleidoskop, das war mir besonders wertvoll. Wenn ich mit einem Auge hineinsah, erwachte eine bunte Welt. Kleine Steinchen fielen, wenn ich es drehte, zu immer neuen Mustern. Ich wünschte mir so sehr, dass es mir gehörte. Doch ich begriff auch, es gehörte uns allen.
Im Sommer waren wir die meiste Zeit draußen in unserem Hof. Wir spielten Verstecken, Fangen, fuhren mit dem Roller, noch lieber mit den Dreirädchen. Unser Sandkasten war immer gut besucht. Mit Mathilde spielte ich gern. Wir hatten Förmchen, konnten Kuchen backen und verteilten ihn an alle, die Hunger hatten. Genauso gern spielten wir auch wieder in unserem Spielzimmer, wenn es regnete.
Im Winter freute ich mich, wenn es endlich schneite. Immer wieder versuchte ich, Schneeflocken zu fangen. Enttäuscht sah ich auf meine Hand, wenn sie verschwanden, ein Tropfen Wasser blieb zurück. Der Nussbaum im Garten des Kindergartens sah ganz toll aus. Die Blätter waren alle bunt geworden und heruntergefallen. Auf den Zweigen lag nun dick der Schnee.
Tante Inge brachte Nüsse mit. Einen Vormittag hat sie alle Nüsse geknackt, die Nüsse an die Kinder verteilt. Sie schmeckten sehr gut. In die halben Schalen bohrte sie Löcher, mit einem Bindfaden durften wir sie an die Zweige des Nussbaums hängen. Die Tante füllte Schmalz in die Nussschalen, wir wunderten uns. Schon am nächsten Tag wussten wir, warum. Die Vögel, die uns im Sommer besuchten, kamen wieder. Eifrig pickten sie das Schmalz heraus. Sie brauchten keinen Hunger zu leiden.
Es war Herbst, es regnete, wir hatten keine Lust, nach draußen zu gehen. Das Schönste und Größte überhaupt war dann die Spielecke. Zwei Kinder konnten darin spielen.
Mathilde sah mich an. Ich wusste, was sie dachte, als ich ihren Blick in die Spielecke folgte. Tante Inge hatte uns beobachtet, kam, legte ihre Arme um uns beide, nickte und brachte uns dorthin. Ich konnte nur: „Danke“, flüstern. Wir sahen uns nicht um. Die Tante zog die blaue Gardine zu, wir waren allein.
In der Puppenküche sah es aus, als wären wir in Omas Küche – mit Töpfen und Schüsseln im Schrank. An einer Wand hingen ein Sieb, eine Pfanne, ein Kochlöffel-Sortiment. In der Mitte eine Form, die aussah wie eine sonnengelbe Blume, in die der Pudding gefüllt wurde. Wenn er kalt war, stürzte Mathilde ihn auf eine Glasplatte.
Tante Inge brachte eines Tages Vanillepudding mit. Er war noch warm. Wir drängten uns alle um die Schüssel. Das ganze Zimmer duftete. So wie Mathilde unseren Fantasiepudding auf eine Glasplatte stürzte, tat es am anderen Morgen Tante Inge mit ihrem Pudding. Jedes Kind bekam einen dicken Klecks in sein Schüsselchen. Nun wussten wir, wie richtiger Pudding schmeckte.
Mathilde kochte ihn immer wieder gern. Sie musste sich dabei beeilen, wir waren mit den Puppen fünf Personen. Wäre ich fünfzehn Jahre älter gewesen, hätte ich mich sicher in Christel und Hans, Schildkröte-Puppen aus den Fünfzigerjahren, oder in einige andere Puppen aus gleichem Haus verliebt. Besonders in Musella, ein Schildkröt-Mädchen von der Mosel. Sie trug ein Sommerkleid, rot gemustert, mit Puffärmeln.
Ich hatte meine Bertha. Sie leckte sich schon das Mündchen, sie konnte nie genug von Mathildes Vanillepudding bekommen. Das sah man ihr auch an. Nahm ich sie auf den Arm, hatte ich schwer zu tragen. Bertha war ein Geschenk meiner Mutter. Ihr Körper war ein Holzscheit. Den Kopf hatte mein Opa geschnitzt. Mit einem lachenden Gesicht, mit roten Wangen und roten Lippen. Wie er den Kopf befestigt hatte, war nicht zu sehen. Einmal habe ich ihr ein buntes Sommerkleid angezogen, mit Schmetterlingen in allen Farben. Es war eigentlich ein großes, weiches Staubtuch, das ich um ihren harten Körper gebunden hatte.
Mathilde hatte eine ähnliche Puppe. Sie hieß Susanne. Wo Mathilde den blauen Overall und die rote Bluse herhatte, erfuhr ich nie. Vielleicht von einer Puppe ihrer Mutter. Jedenfalls war Susanne sehr hübsch. Ihre blonden Haare hatte ich zu einem Pferdeschwanz gebunden. Wir nahmen beide unsere Puppen jeden Tag mit nach Hause. Ich liebte Bertha so sehr, wollte keine Minute ohne sie sein. Auch in den Luftschutzkeller nahm ich sie mit.
In unserem Kindergartenhof gab es eine steile Felswand. Links, wo der Hof zu Ende war, war eine Treppe in den Felsen gehauen bis hoch hinauf. Oben war ein flacher freier Platz.
Ich weiß, dass unsere Kindergärtnerinnen mit den Kindern, die unseren Kindergarten verließen, um zur Schule zu gehen, jedes Jahr dort oben ein Märchenspiel aufführten. An das Märchen vom Rumpelstilzchen kann ich mich erinnern.
Dann war ich selbst sechs Jahre alt und verließ den Kindergarten. Ob auch ich dort oben auf dem Felsen mitgespielt habe, weiß ich allerdings nicht mehr.
*
Fliegeralarm
An einem Sonntagmorgen, ich war vielleicht viereinhalb Jahre alt, schickte mich Mutter zu ihrer besten Freundin Tante Erna. Ich brachte ihr einen Brief.
Tante Erna freute sich, mich zu sehen. „Willst du einen Kakao trinken, Luisa?“, fragte sie, nahm meine Hand und ging mit mir die Treppe hinauf zu ihrer Wohnung. Sie öffnete die Tür zur Küche, als plötzlich eine Sirene heulte. „Kind, wir müssen in den Luftschutzkeller, hier, trink schnell!“ Sie reichte mir einen kleinen Becher. Der Kakao war kalt, schmeckte sehr gut. Ich hatte großen Durst, trank den Becher in einem Zug aus.
„Danke, Tante Erna.“ Die Sirene war so laut, ich hielt mir die Ohren zu und folgte ihr.
Ein fürchterlicher Krach, ein Rums. Eine heftige Druckwelle riss uns von den Füßen. Wir stürzten vom zweiten Stock durch das ganze Treppenhaus.
„Halt dich fest!“, schrie Tante Erna. Sie versuchte, mich aufzufangen, packte meinen rechten Arm. Wir fielen gemeinsam, landeten im Hausflur auf Steinfliesen. Es dröhnte, das große Haus wackelte bis in die Grundmauern. In der Gaststube hörte ich Stühle von den Tischen fallen. Mein Arm, den meine Tante fest umklammert hielt, tat mir weh. Ich lag halb auf ihr, sah, dass sie die Augen geschlossen hatte, als würde sie schlafen.
„Tante Erna“, flüsterte ich. „Wach auf, bitte wach auf!“ Ich bekam große Angst, zitterte, weinend rief ich wieder und wieder ihren Namen – sie reagierte nicht. Vorsichtig rutschte ich von ihr herunter, stand auf, lief zur Haustür.
Gerade als ich sie öffnete, kam Onkel Louis, der Dorfpolizist, die Treppe herauf. „Kleines“, sagte er zu mir.
Ich hatte große Angst vor ihm. Er war klein und dick, hatte rote Haare. An diesem Tag hatte er wieder die große grüne Kappe mit einem Schirm auf dem Kopf. Wenn er sie trug, war meine Angst noch größer. Ich wich zurück.
„Was machst du denn hier?“, fragte er mich. Ich konnte nichts sagen, lief zurück zur Tante, klammerte mich an sie. Endlich öffnete sie die Augen, richtete sich auf, sah Onkel Louis in der Tür stehen. Der Polizist kam herein, berührte ihre Hand.
„Erna, kannst du aufstehen?“ Er beugte sich zu ihr. Seine starken Arme hoben meine Tante hoch, stellten sie auf die Füße. Sie zeigte auf mich. „Luisa!“, rief sie und weinte.
Ich umarmte sie. So standen wir eine Weile, bis der Polizist uns vor das Haus bat. Auf der Straße wimmelte es von erschreckten Menschen, sie waren zusammengelaufen. Aus dem Unterdorf stieg eine Rauchwolke auf, Flammen loderten hoch in den Himmel, die Luft flimmerte vor Hitze.
„Du musst nach Hause, deine Mama wird sich Sorgen machen“, sagte meine Tante aufgeregt.
Onkel Louis hieß in Wirklichkeit Ludwig. Alle Kinder fürchteten sich vor ihm, besonders vor seinem roten Schnurrbart, der beim Sprechen immer auf und ab hüpfte. Er bot sich an, mich zu meiner Mutter zu bringen. „Schlimm, nicht wahr Erna“, sagte er, und zeigte auf das fassungslose Chaos vor uns. „Bei Bauer Kessler soll die Bombe eingeschlagen sein. Ich weiß noch nichts Genaueres. Das Kind wohnt doch ganz in der Nähe.“
„Oh mein Gott!“, stieß die Tante hervor. „Ich komme mit!“, sagte sie, nahm mich bei der Hand und wir rannten los.
Doch es gab kein Durchkommen. Überall liefen die Menschen in großer Aufregung durch die Straßen. Sie standen dicht gedrängt an den Straßenecken und behinderten so auch die Leute, die Hilfe leisteten. Oder, wie in unserem Falle, Menschen, die dort wohnten, nicht an ihr Haus zu kommen. Mit einem großen Umweg gelangten wir schließlich in unsere Straße.
Eine Menschenmenge wogte auf und ab. Es wurde geschoben, gedrückt, alles rief und schrie durcheinander, die Luft war heiß, roch nach Schwefel. Wir waren ratlos, wie wir meine Mutter finden sollten.
Dort, aus einem Fenster – oder besser gesagt – aus einem Fensterrahmen rief ein Mann, ungefähr sieben Häuser von dem unseren entfernt. Onkel Ludwig als Respektsperson machte den Weg durch das Gewühl frei. Meine Mutter saß bei den Nachbarn in der Küche, umringt von der ganzen Familie. Sie war nicht mehr wiederzuerkennen. Ihre Kleider waren zerrissen, die Haare hingen aufgelöst herunter. Über und über mit Staub bedeckt, saß sie zitternd auf einem Stuhl und hielt meine kleine Schwester fest umklammert auf ihrem Schoß. Ihr Blick war ausdruckslos und die Tränen, die über ihr Gesicht liefen, hinterließen braune Spuren, vermischten sich mit dem Staub. Auf dem Küchentisch lag mein Brüderchen, er war noch ein Baby, schreiend auf einer Wolldecke. Ein Sanitäter beugte sich über ihn. Das Gesicht meines Bruders war mit Blut verschmiert. Glassplitter von unseren Küchenfenstern waren auf ihn gefallen, er hatte im ganzen Gesicht Schnittwunden.
Die alte Bäuerin zog meine Tante zu sich heran. „Erna“, sagte sie leise. Dem Sanitäter konnte Hans-Robert nicht genug danken, seine Augen ließ Mama nach dem Krieg untersuchen. Der Augenarzt fand nur geringe Narben auf der Netzhaut, im Gesicht blieben keine hässlichen Narben zurück. Sanitäter hatten meine Mutter mit meinen Geschwistern aus den Trümmern unseres Hauses gerettet. Sie saß in einer Ecke in der Küche auf dem Fußboden, ihre Kinder fest im Arm, wimmerte, brachte kein lautes Wort heraus. Mein kleiner Bruder hatte so jämmerlich geschrien, dass die Rettungskräfte in unser Haus stürzten. Der Kleine hat ihnen das Leben gerettet – der Dachstuhl stand schon in Flammen. Das Haus wurde bei diesem Angriff stark beschädigt. Doch irgendwie kam Hilfe, denn wir wohnten weiterhin darin, denke ich. Jede Erinnerung daran fehlt mir. Wer es wiederaufgebaut hat und wann, auch wo wir in dieser Zeit lebten, daran kann ich mich nicht erinnern.
Dagegen kann ich mich noch gut an die vielen Fliegerangriffe erinnern, wenn die Sirene heulte. Wenn sie endlich verstummte, lag ein unheimliches Summen in der Luft.
Wir konnten nie wissen, wann die feindlichen Flugzeuge angriffen, sie konnten jede Minute kommen, am Tag oder in der Nacht. Dann mussten wir raus, denn unser kleines Haus bot uns keine Sicherheit. Wurde ich in der Nacht durch die Sirene aufgeweckt, sah ich durch die geschlossenen Gardinen die Suchscheinwerfer über den Himmel geistern. Dies war für mich das normale Leben, ich kannte es nicht anders. Wir zogen uns dann, so schnell wir konnten, an. Meine Mutter trug meinen kleinen Bruder auf dem Arm, meine drei Jahre alte Schwester lief neben ihr, ihre Hand fest umklammert.
Darmowy fragment się skończył.