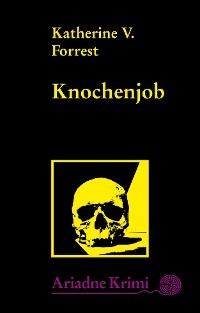Czytaj książkę: «Knochenjob»

Katherine V. Forrest
Knochenjob
Kate Delafields 7. Fall
Aus dem Amerikanischen von Britta Dutke
Ariadne Krimi 1125
Argument/Ariadne
Ariadne Krimis
Herausgegeben von Else Laudan
Romane mit Detective Kate Delafield:
1. Fall: Amateure (Ariadne Krimi 1015)
2. Fall: Die Tote hinter der Nightwood Bar (Ariadne Krimi 1007)
3. Fall: Beverly Malibu (Ariadne Krimi 1029)
4. Fall: Tradition (Ariadne Krimi 1037)
5. Fall: Treffpunkt Washington (Ariadne Krimi 1107)
6. Fall: Kreuzfeuer (Ariadne Krimi 1113)
7. Fall: Knochenjob (Ariadne Krimi 1125)
8. Fall: Vollrausch (Ariadne Krimi 1155)
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
Sleeping Bones
© 1999 by Katherine V. Forrest
Alle Rechte vorbehalten
© Argument Verlag 2000
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2016
ISBN 978-3-86754-894-6
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
Danksagungen
Für Jo –
und in Erinnerung
an Cassie
Einige Schauplätze sowie die historischen Ereignisse um die Pekingmensch-Fossilien und die historischen Figuren, die mit ihnen zu tun hatten, sind authentisch. Die hier erzählte Geschichte und alle Figuren, die darin vorkommen, wurden von der Autorin frei erfunden.
Der Tümpel, nicht tiefer als ein Felsbrocken und schwarz wie ein Grab, spiegelt den verblassenden Mond und die Sterne, nicht jedoch das umstehende Schilf. Über seine Oberfläche – bedeckt mit Blättern, kleinen Zweigen und Rindenstückchen, Federn und winzigen Knochen – ziehen Kreise.
Eine große schwarze Blase steigt allmählich aus den Tiefen des Tümpels empor, dehnt sich langsam und gleichmäßig bis an ihre Grenze, verschwindet dann mit einem Plock des Verendens; nur ein weiterer sich ausbreitender Kreis auf der Wasseroberfläche erinnert noch an sie.
Die heraufziehende Dämmerung enthüllt am Horizont die runden Konturen entfernter Hügel. Sie begrenzen ein weites Tal, hier und da mit Nebelschwaden bedeckt, eingenommen von einem unbeirrbaren Heer aus Bärentraube, Holunder, Beifuß, Ambrosien, Wacholder, Hartriegel, Giftsumach und Disteln, dazwischen aufragend Kiefern und Zwergeichen. Die nächtlich kühle Erde, fett von verwesten Pflanzen und Tieren, klamm vom Tau, verströmt den Gestank von Tod und Fäulnis.
Eine riesige schwarze Gestalt bahnt sich behutsam einen Weg durch den Schilfgürtel zum Wasser. Im schwachen Licht ist ihre Silhouette zu erkennen: Es ist eine Büffelkuh, ein Koloss, der höchste Punkt ihrer muskelbepackten Schultern gut zwei Meter hoch. Sie geht schützend vor ihrem Jungen her, einem vier Monate alten Kalb, das hinter ihr herspringt; unbeholfen und unschuldig, aber schon wachsam knabbert es an zarten Grashalmen im niedrigen Gebüsch.
Weiteres Leben erwacht. Der erste zaghafte Ruf eines Vogels hallt mit scharfer Klarheit quer durch das Tal. Ein ängstliches Rascheln von Ratten, Eichhörnchen und Hasen, die zaghaft ihre Umgebung erkunden. Im dichten Unterholz hält sich ein Säbelzahntiger versteckt und schläft.
Noch ein Geräusch: Das Kalb schlabbert und schlürft Wasser, trottet am Ufer des Tümpels entlang. Seine Mutter folgt ihm, schiebt ihren wuchtigen Körper weiter in das seichte Gewässer, wo sie ihre Hufe fester aufsetzt. Wachsam und bewegungslos steht sie im ebenholzfarbenen Wasser, beobachtet ihr Kalb, lauscht, den Kopf erhoben, die gekrümmten Hörner aufgerichtet. Hier lauern anscheinend keine Gefahren. Beruhigt stillt sie ihren Durst.
Schon bald klettert das Kalb, auf der Suche nach dem saftigen, taufeuchten Gras, die Uferböschung wieder hinauf. Da hört es angsterfülltes Platschen, bemerkt, dass seine Mutter ihm nicht folgt, und hält an, macht kehrt auf seinen dünnen Beinen.
Die Büffelkuh hat sich nicht vom Fleck gerührt – sie kann nicht. Ihre Hufe stecken fest. Sie versucht wieder und wieder, mit aller Gewalt aus dem scheinbar harmlosen, seichten Tümpel zu gelangen. Ihr Kalb tänzelt nervös umher. Sie nimmt all ihre Kraft zusammen, und es gelingt ihr, einen teerverschmierten Huf herauszuziehen. Zum Befreien der übrigen fehlt ihr jedoch ein Hebel. Sie ist in eine vom Wasser verborgene Masse eingesunken. Die ist zwar dünn, so dass sie sich allmählich Bewegungsfreiheit verschaffen kann, doch ohne Ergebnis. Die Büffelkuh muss machtlos mit ansehen, wie ihr Kalb panisch wird. Sein Blöken und seine unregelmäßigen Hufschläge sind deutliche Signale für die Raubtiere.
Im Unterholz erwacht mit einem Ruck der Säbelzahntiger und kriecht, die Ohren für die Laute der Verzweiflung gespitzt, aus seinem Versteck. Geschmeidig und lautlos springt er in großen Sätzen durch das Gras, zielstrebig auf den Ort des Aufruhrs zu.
Die Anstrengungen der Büffelkuh werden zur Raserei, als das gelbbraune, gefleckte Raubtier durch die taufeuchten Binsen in ihr Blickfeld kriecht, seine gelben Augen auf ihr Kalb fixiert, seine gewaltigen gebogenen Reißzähne schimmernd im zunehmenden Licht der Dämmerung.
Die Raubkatze, auf Beute aus, beurteilt das Kalb mit kalter, flinker Berechnung als verirrtes Tier; die erste Mahlzeit des Tages wird schnell und leicht zu töten sein. Sie kauert auf den Hinterläufen, lauert. Die Büffelkuh brüllt, rasend in ihrer Qual.
Der Säbelzahntiger bricht den Angriff ab, springt zurück, knurrt, wappnet sich gegen die sicherlich ungestüme Verteidigung seines geplanten Opfers durch das Muttertier.
Das wütende Brüllen hält an, aber der Büffel bricht nicht aus dem Tümpel hervor. Die Raubkatze, tief auf ihren Hinterläufen, mit schlagendem Schwanz, schleicht vorsichtig vorwärts, die Augen auf den Büffel geheftet. Warum verteidigt er sein Junges nicht – warum nicht sich selbst? Der erwachsene Büffel ist eine viel verlockendere Beute, bei weitem nicht zu groß für das Jagdvermögen der Raubkatze, ein üppiges Festessen für diese und viele weitere Mahlzeiten.
Die Raubkatze knurrt herausfordernd. Der Büffel, der mit aller Macht darum ringt, sich zu befreien, kann nur aufsässig und wütend brüllen.
Weitere Raubtiere tauchen auf. Fünf durch das Knurren und Wüten von Jäger und Gejagten angelockte Schreckenshunde kreisen im Gras hinter dem Säbelzahntiger das verängstigte Kalb schnell ein, blecken riesige, spitze Zähne in ihren mächtigen Mäulern.
Wieder brüllt die Büffelkuh in Todesangst. Am Rand des Tümpels reckt sich der Säbelzahntiger zu voller Größe auf, spielt mit seiner bewegungsunfähigen Beute. Mit triumphierendem Gebrüll schlägt er eine Schleife am Ufer des Tümpels, von der Büffelkuh weg, als wolle er sie verschonen, macht dann plötzlich kehrt, duckt sich und springt. Er schlägt seine Klauen in ihren Rücken, rammt die beiden säbelgleichen Zähne in ihren Nacken, zieht sie heraus, sticht wieder zu und wieder. Das Raubtier springt leichtfüßig in den Tümpel, vollendet seinen Sieg, indem es den massigen Körper am Kopf herunterzieht.
Das Leben der Büffelkuh verebbt in einem purpurroten Strom im schwarzen Wasser, sie sieht nicht das leuchtend rote Blut, das aus der knurrenden, sich keilenden Meute der Schreckenshunde spritzt, die ihr Kalb in den sich schnell rötenden Tümpel reißen, wo sie es gierig verschlingen.
Nach einigen Minuten ebben die Fressgeräusche ab. Die Raubkatze, gesättigt, eine Pfote auf ihrer grausam zerrissenen, übel zugerichteten Beute, hebt ihren blutverschmierten Kopf und brüllt ihre Überlegenheit heraus. Im Begriff, großspurig aus dem Tümpel zu schreiten und die Reste ihrer Beute zu ihrem Bau zu schleifen, muss sie feststellen, dass ihre übrigen drei Beine feststecken. Sie zerrt vergeblich, knurrt wütend, stemmt sich mit allen vier Pfoten in den Tümpel, um einen Hebel anzusetzen, doch dadurch sinkt sie gänzlich ein, noch weniger bewegungsfähig als ihre Beute zuvor. Vier der fünf Schreckenshunde sind ebenfalls in Not, sitzen fest wie die Raubkatze, nur einer von ihnen kann sich in die Sicherheit des Schilfs retten.
Während das Kämpfen, Heulen und Brüllen im Tümpel unvermindert anhält, tauchen Koyoten und Wiesel auf, von dem Aufruhr und dem metallischen Blutgeruch angezogen, daneben weitere Schreckenshunde, ein Luchs und ein Puma. Sie sichten furchterregende Feinde, die zur hilflosen Beute geworden sind, und greifen an, zerrend, reißend. Ein paar Geier ziehen immer niedrigere Kreise über dem Gemetzel; doch abgeschreckt vom Beißen und Knurren der gefangenen Tiere und der gierigen, opportunistischen Brutalität der Neuankömmlinge, flattern sie wieder empor, warten geduldig, bemerken nicht die teerige, erstarrende Masse, die ihnen bei der Keilerei der Opfer und Angreifer auf die Federn geschleudert wird.
Als sie schließlich an der Reihe sind und sich daranmachen, Tote wie Lebende zu fressen, hüpfen sie in den Tümpel, um beim Reißen und Ziehen am Fleisch eine gute Position zu haben: Damit sind auch sie gefangen, außerstande zu entkommen.
Und so kommen alle um, die das Schlachtfeld betreten haben, um die Hilflosen zu morden. Eine siebeneinhalb bis zehn Zentimeter dicke, tödliche, zähe Asphaltschicht, hervorgequollen aus den Tiefen der Erde, hat Opfer und Räuber gleichermaßen in ihrer Gewalt.
Der schwarze Tümpel schließt sich allmählich, unaufhaltsam über ihnen allen, begräbt sie in seinem teerigen Konservierungsmittel, bewahrt ihre Knochen und die Geschichte dieses Gemetzels – für die kommenden fast vierzigtausend Jahre.
1. Kapitel
Ungefähr vierzigtausend Jahre später
Auf zu den Gruben.« Detective Joe Cameron ließ den Hörer auf die Gabel fallen und grinste Detective Kate Delafield über den Schreibtisch der Mordkommission hinweg an. »Den weltberühmten La Brea-Teergruben.«
Er schob den Untersuchungsbericht, an dem er gerade arbeitete, in eine seiner vier Ablagen, rappelte sich auf und streckte seine schlaksige Gestalt, um sein Jackett von einem Bügel am Garderobenständer zu angeln. »Leiche hinter einer Parkbank. Da sie weniger als zehntausend Jahre alt ist, meint Sergeant Hansen, wir sollten sie uns mal ansehen.«
»Typisch«, sagte Kate, schlug die Akte des Mordfalls Gonzales zu und legte die blaue Mappe in eine Schreibtischschublade. Sie griff nach ihrer Umhängetasche, dankbar, dass sie und Cameron an der Reihe waren, auch wenn die Leiche höchstwahrscheinlich eines natürlichen Todes gestorben war. Alles war besser als ihre Selbstzerfleischung wegen des Fiaskos um Aloysius Gonzales.
Außer ihnen saß niemand am Tisch der Mordkommission. Bis auf ein gedämpftes Gespräch am Tisch der Einbruchkommission war die ganze Ermittlungsabteilung relativ ruhig, die Männer und Frauen an den Schreibtischen in Papierkram vertieft. Im Los Angeles Police Department herrschte die Devise: Schreibe pünktlich deine Berichte, oder du bist weg vom Fenster.
Auf dem Parkplatz hinter dem Wilshire-Revier stieg Cameron zu Kate in den Dienstwagen. »Hier drin kannst du dir die Eier braten«, murmelte er und zerrte am Knoten seiner Krawatte.
Es war vollkommen harmlos gemeint. Nach drei Wochen mit ihrem jüngeren Partner wusste Kate, dass Cameron weder zu Sexismus noch zu Homophobie neigte. Er ließ seine Tür weit offen, während er darauf wartete, dass sie Motor und Klimaanlage in Gang setzte; er zog den Staub der Hitze vor. Der allgegenwärtige Staub, ein feiner pulvriger Sand, wehte in Böen von der angrenzenden Baustelle herüber, wo ein neues Gebäude weitere Beschäftigte des Polizeihauptquartiers West beherbergen und zusätzliche Parkprobleme schaffen würde.
Vorsichtig tastete Kate das Lenkrad nach einer Stelle ab, wo sie es anfassen konnte, und lehnte sich in den glutheißen Sitz zurück, als wolle sie die geballte Hitze ihre Arme hinaufleiten. Die Wärme löste ihre Steifheit, eine wohl bleibende Erinnerung an die Kugel, die bei einer verpfuschten Festnahme vor anderthalb Jahren ihre linke Schulter getroffen hatte.
Als sie vom Parkplatz auf den Venice Boulevard fuhr, zog Cameron eine Pilotensonnenbrille aus der Brusttasche seines Jacketts und studierte die Karte des Bezirks Wilshire. Er nannte den Abschnitt, in dem die La Brea-Teergruben lagen: »Sieben-zwei-zwei.«
»Gut«, sagte sie kurz. Cameron, erst kürzlich aus Devonshire hierher versetzt und in die Mordkommission befördert, musste sich mit Wilshire noch vertraut machen, ein Gefühl für das Territorium entwickeln, das bei weitem heterogener war als sein vorheriger Arbeitsbereich im entlegensten LAPD-Revier im San Fernando Valley. Sollte sich dieser Fall als Mord entpuppen, würde er als Teil seiner Einarbeitung erstmals die Ermittlungen leiten; er würde nominell die Verantwortung tragen, unter ihrer Anleitung und Aufsicht. Aber heute war sie nicht in Stimmung für die sonst üblichen Hinweise und laufenden Rückmeldungen.
Als es im Auto kühler wurde, zog der sonst so gesprächige Cameron seine Krawatte wieder enger und starrte durchs Seitenfenster. Sich selbst überlassen blickte Kate finster auf den Verkehr, während sie immer noch über das Gonzales-Debakel grübelte.
Beim Einbiegen in den Wilshire Boulevard begriff sie, dass Camerons Zurückhaltung an ihrer schlechten Laune lag. Es war unfair, ihren Ärger an ihm auszulassen. Er hatte mit dem Fall Gonzales nichts zu tun.
»Hätte nie gedacht, dass ich die Teergruben auf diese Weise zu sehen bekomme«, begann sie.
Er schob sich die Sonnenbrille zurück auf die Nase und drehte sich ungläubig zu ihr um. »Du warst noch nie an dem berühmtesten Ort im gesamten Bezirk?«
Gereizt durch diese Reaktion auf ihr Entgegenkommen erwiderte sie: »Das Berühmteste in meinem Bezirk sind für mich die Columbia Studios. Und vielleicht der Farmer’s Market.«
»Nur in Amerika berühmt«, gab er zurück. »Wie lange wohnst du schon in L.A.?«
»Schon ewig.« Ein grünes Schild mit weißen Lettern über dem Mittelstreifen des Wilshire Boulevard kündigte den Museumsweg an der Miracle Mile, der Wundermeile, an. Das Wunder ließ in diesem unspektakulären Streifen von Wilshire noch auf sich warten, aber das Kunstmuseum des Regierungsbezirks L.A. war wirklich ein Juwel und ein echtes Museum. Sie erinnerte sich, wie Mitte der Siebzigerjahre das neue Museum der La Brea-Teergruben eröffnet wurde. Nicht besonders aufsehenerregend. Es gab keinen Grund, jetzt anders darüber zu denken, auch wenn in irgendeinem blöden Film kürzlich ein Vulkan aus den Tiefen der Gruben hervorbrach und halb Los Angeles vernichtete.
»Die Teergruben sind interessanter, als du denkst. Sie sind was Besonderes.« Cameron schüttelte den Kopf. »Ich wette, du bist schon tausendmal daran vorbeigefahren.«
»Zehntausendmal«, sagte sie ohne Bedauern. »Und jedes Mal wieder habe ich die Nachbildungen dieser prähistorischen Tiere von der Straße aus gesehen. Teergruben und Fossilien machen mich nun mal nicht an.«
»Mein Dad hat sie mir gezeigt, noch bevor das Museum überhaupt gebaut wurde. Er fand sie toll. Genau wie ich.«
Noch ein Grund, nicht hinzugehen, dachte sie. Eltern und kreischende Kinder.
»Die Leiche ist hinter der großen Grube«, sagte er. »Du nimmst also am besten die Curson Avenue.«
»Roger«, sagte sie, amüsiert, dass er sie jetzt in ihrem eigenen Bezirk herumdirigierte.
Sie parkte in der Curson Avenue hinter vier Streifenwagen. Ihre kreisenden Blaulichter ließen den strahlenden Sonnenschein noch greller erscheinen, und die Funkgeräte übertrugen das permanente Stakkato heiserer Stimmen.
Camerons Bemerkungen hatten ihre Neugier geweckt, und als sie aus dem Auto stieg, hielt sie kurz inne, um das Museum in Augenschein zu nehmen. Ein in die Konturen eines kurz gemähten grünen Hügels eingefügtes Gebäude, ein gutes Stück von der Straße zurückgesetzt. Es war gedrungen und eckig, schlicht, aber nicht unbeeindruckend. Das Dach, von der übrigen Konstruktion durch ein massives Steinfries mit prähistorischen Tierszenen in Brauntönen abgesetzt, schwebte auf einer komplexen Konstruktion aus Säulen und gekreuzten Trägern. Sie folgte Cameron unter einen Baldachin aus schattenspendenden Bäumen und auf den kurvigen Gehweg, der am Museumsgebäude entlangführte. In der heißen, schweren Luft lag der stechend-süßliche Geruch von Petroleum. Eine Horde Touristen strömte auf einem breiten gepflasterten Weg im Zickzack auf die Glastüren des Museums zu, auf denen eine fett gedruckte Schrift verkündete:
GEORGE C. PAGE MUSEUM
LA BREA AUSGRABUNGEN
Auf der anderen Seite des Wegs bevölkerten Kinder eine erhöhte Aussichtsplattform aus massivem Granit. Von ein paar überforderten Erwachsenen wirkungslos beaufsichtigt, schubsten und drängelten sie sich um die besten Plätze, kreischend vor Aufregung über das, was sie von dem Polizeieinsatz erspähen konnten.
»Was denken sich diese Erwachsenen bloß heutzutage?«, schimpfte sie. »Das Fernsehen ist eine Sache. Aber an einem echten Mordschauplatz haben Kinder nichts zu suchen.«
»Ach, ich weiß nicht«, sagte Cameron. »Vielleicht können Kinder durch einen fremden Toten schmerzlos erfahren, was der Tod bedeutet.«
Sie antwortete nicht. Es war wohl kaum der richtige Zeitpunkt für einen Streit. Hinter den Parkbänken, die den Weg säumten, hatte sie die erste Absperrung aus gelbem Polizeiband ausgemacht, davor drängten sich ein paar Dutzend Schaulustige. Cameron war ein Narr, wenn er glaubte, man könne sich in irgendeiner Weise auf die harte Realität eines endgültigen Verlustes vorbereiten – niemand wusste das besser als sie.
Sergeant Fred Hansen wartete an dem abgeriegelten Rasenstück. Officer Pete Johnson, der neben ihm stand, hielt den Zeitpunkt ihrer Ankunft in seinem offiziellen Logbuch fest. Sie nickte ihnen zu und zog Notizbuch und Stift aus ihrer Tasche. Hinter Hansen sah sie vier weitere Polizisten, die den Tatort bewachten, und – für einen kurzen Augenblick – die Gestalt, die mit dem Gesicht nach unten ausgestreckt im Gras lag.
»Was Besonderes, Fred?« Die heiße, von Petroleumdämpfen erfüllte Luft lag erdrückend auf ihr.
Hansen zuckte mit den Schultern. »Tja, Kate, ich denke, vielleicht schon.«
Sie notierte Uhrzeit und Datum, 10:35 Uhr, 21. August, und die ungefähre Temperatur, gut dreißig Grad. Dann fragte sie: »Was haben Sie bis jetzt?«
»Vier Neuseeländer haben ihn gefunden, direkt nachdem das Museum geöffnet wurde, kurz nach zehn. Sind in den Souvenirladen gerannt. Die Frau vom Informationsschalter hat uns angerufen. Eine Minute nach uns kamen die Sanitäter, erklärten ihn für tot. Weiß, männlich, dem Aussehen nach in den Siebzigern.«
»Und?«
»Sonst nichts, bis auf sein Aussehen.«
Kate ignorierte die Geste, mit der er auf die Leiche zeigte. Sie wollte sich nicht von ihrer Methode abbringen lassen. »Personalien?«
»Bisher nichts bekannt.«
»Wer hat ihn berührt?«, fragte Cameron, der in sein Notizbuch schrieb. Er war Linkshänder, sein breiter Ehering glänzte in der Sonne.
»Die Sanitäter. Die Kiwis haben nur einen Blick auf ihn geworfen – mehr muss man auch nicht.«
»Stimmt, man kann es von hier aus sehen«, sagte Cameron.
Hansen sagte: »Sie sind weggegangen, ziemlich verstört. Bis Freitag wohnen sie im Mondrian. Ich hab ihre Namen und Zimmernummern, falls wir eine Aussage brauchen. Keine Zeugen bisher. Wir laufen herum, versuchen jemanden zu finden, der etwas gesehen hat, aber das hier ist das reinste Tollhaus – lauter Touristen und Kinder. Tja, Leute, das ist alles, was ich habe.«
Kate nickte. Nach vielen Jahren der Zusammenarbeit wusste Hansen, wie sie vorging. Er würde nun mit weiteren Anweisungen warten, bis sie den ganzen Tatort unter die Lupe genommen hatte.
Viel gab es nicht zu untersuchen. Auf einer neuen Seite in ihrem Notizbuch zeichnete sie, ausgehend von ihrem Blick nach Westen, die Himmelsrichtungen ein, dann machte sie sich eine schnelle, grobe Skizze von dem länglichen Rasenstück, vielleicht fünfzehn mal neun Meter, begrenzt von kreuzenden Fußwegen, von denen zwei auf eine Art Park zuliefen. Für die vier grauen Holzbänke entlang der Wege zeichnete sie Rechtecke ein, Gabeln standen für die drei Bäume mit der dünnen, bleichen, von Initialen verunzierten Rinde. Vom westlichen Rand des Gebietes zeichnete sie die Geländestruktur ein, ließ den Blick dann nach oben schweifen, zu den buschigen Palmkronen über ein paar entfernten Bäumen und der hellgrünen Fassade des Kunstmuseums. Ihr kam der ketzerische Gedanke, dass die Skulpturen auf dem Museumsdach aussahen wie ein Haufen Surfbretter. In Richtung Norden stand jenseits des Fußwegs auf einem weißen Sockel die Büste eines Mannes in Jackett und Krawatte. Hinter ihm, zu ihrer Rechten, bildeten die orangefarbenen Wohnblöcke des La Brea-Parks die entfernte Kulisse des Page Museum. Südlich des Tatorts, links von dem Weg, auf dem sie stand, lief ein Maschendrahtzaun vor einem Tümpel entlang, dessen dunkle, geriffelte Oberfläche sie durch Schilf und Gebüsch sehen konnte. Die Rasenfläche vor der hintersten Bank schraffierte sie leicht und fügte schließlich an der Stelle, wo die Leiche im Gras lag, ein Kreuz in ihre Skizze ein. Das Rasenstück war weder abgeschlossen noch weit abgelegen vom gewöhnlichen Touristenpfad um den großen See; alle, die sich in irgendeiner Richtung über das Gelände bewegten, hätten die Leiche finden, möglicherweise ihren Tod herbeiführen können.
»Seine Hände«, sagte Cameron neben ihr.
»Einen Moment noch«, sagte sie ruhig, aber sie war verärgert über die Störung ihrer Konzentration. Es war äußerst anstrengend, mit einem neuen Partner zusammenzuarbeiten. Der stinkfaule Ed Taylor hatte die längste Zeit ihrer gemeinsamen fünf Jahre gebraucht, um ihre Methoden zu respektieren, und Torrie, zu deren Fehlern nicht Taylors Schlampigkeit gehörte, hatte ein Jahr gebraucht, um sich Kates Stil anzupassen. Jetzt musste wieder jemand anderes kommen. Nicht dass sie sich Ed Taylor oder Torrie Holden zurückwünschte …
Sie richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf die Umgebung und nahm den Toten in Augenschein. In einer dunklen, ausgebeulten Hose und einem rostbraunen Polohemd lag er bäuchlings im sommerlich vergilbten Gras. Die Leiche wirkte in dieser harmonischen Umgebung außergewöhnlich grotesk, ein Arm war auf Taillenhöhe stark zurückgebogen, der andere ragte von der Schulter quer über den Rücken, die zu Klauen gekrümmten Finger wiesen ohne erkennbaren Grund zur Mitte des Rückens.
»Es war klug, uns sofort herzurufen, Fred«, sagte sie, und ein dünnes Lächeln erhellte Hansens verdrossenen Blick. Er hob das Band an, als Kate Anstalten machte, den Tatort zu betreten.
Sie ging, aufmerksam einen Fuß vor den anderen setzend, zur Leiche hinüber, Cameron in ihrem Kielwasser. Viel war nicht durcheinanderzubringen; anscheinend lag bis auf ein paar hergewehte Blätter nichts im Gras. In vorsichtiger Entfernung von der Leiche ging sie in die Hocke. Die Endgültigkeit dieses Todes stand im bedrückenden Gegensatz zum Duft der sonnengewärmten Wiese und Erde, gemischt mit den Petroleumschwaden der Teergruben.
Der Mann hatte graue Kopf- und Barthaare, dünnes Haar, streng zurückgekämmt und nur leicht zerzaust, sein Bart etwa zweieinhalb Zentimeter lang und gepflegt. Sein Gesicht hatte sich im Todeskampf in den Boden gebohrt, aber ein glasiges, starres Auge war teilweise sichtbar. Sie berührte die Wange des Toten mit ihrem Handrücken. Die Wärme seiner Haut konnte zwar von der Sonne stammen, aber wahrscheinlich entsprach sie seiner Körpertemperatur. In einigen Teilen von Los Angeles konnte eine Leiche stundenlang auf der Straße liegen, während die Leute an ihr vorübergingen, aber diese Gegend, voller Touristen, die mit den unliebsamen kulturellen Marotten der Stadt nicht vertraut waren, war weniger verkommen. Dieser Mann war innerhalb der letzten Stunde gestorben.
Im Bewusstsein, dass sie Camerons Anleiterin war, fragte sie: »Was meinst du, Joe?«
Neben ihr hockend schrieb er in sein Notizbuch. »Er versucht nach dem zu greifen, was ihn umgebracht hat. Es war also kein Herzanfall, es sein denn, sein Herz ist an einem sehr merkwürdigen Platz.«
Sie linste auf das dicht gewobene rostbraune Hemd. »Wenn er Blut verloren hat, kann ich es jedenfalls nicht sehen.«
»Es könnte aber welches da sein – das Hemd hat die gleiche Farbe wie Blut.«
»Frisches Blut könnte man sehen«, widersprach sie.
»Vielleicht ist seine Niere geplatzt.«
Sie bedachte Camerons Bemühen um Leichtigkeit mit einem Lächeln. »Eine interessante Hypothese.« Cameron war relativ jung und – welche Polizeilaufbahn er auch hinter sich haben mochte – unerfahren in der Pflicht, Leichen zu untersuchen, Angehörige und Kinder zu benachrichtigen, deren Leben sich durch die Katastrophe eines Todesfalls für immer ändern würde. Nach dem Alter dieses Toten zu urteilen, könnte es eine beachtliche Familie geben, sogar Enkelkinder …
Cameron sagte: »Es könnte irgendwas Ausgefallenes sein, wie ein Bienenstich – vielleicht hatte er einen anaphylaktischen Schock.«
»Also das ist wirklich eine interessante Hypothese«, sagte Kate, »da könntest du sogar recht haben.«
Sie streckte die Hand nach dem Toten aus, nahm ein Stück seines Hemdes zwischen Daumen und Zeigefinger und benutzte es, um eine der zu Klauen gekrümmten Hände anzuheben. Der Tote trug einen Ehering, mit den Jahren dünn geworden und zerkratzt, und eine Seiko-Uhr mit abgenutztem Lederarmband. Sie sah, dass die Handfläche kreuz und quer von dünnen schwarzen Streifen verschmiert war und untersuchte die Finger, einen nach dem anderen, wobei sie schwarze Ränder unter einigen Nägeln bemerkte. Sie legte die Hand wieder ab, stand auf und ging zur Bank hinüber.
Eigentlich war es eine ganz gewöhnliche Parkbank mit abgestoßener grauer Farbe, nur war sie mit verwitterten Teerstreifen überzogen, genauso wie der gepflasterte Boden um sie herum. Der Teer sah alt und trocken aus, es schien recht ungefährlich, sich darauf zu setzen, vor allem in Freizeitkleidung, wie sie der Tote trug.
»Die Bank sieht aus wie eine Leinwand, mit der Jackson Pollock gerade angefangen hat«, bemerkte Cameron.
In ihre eigenen Beobachtungen versunken, überquerte sie den Weg zum Maschendrahtzaun und blickte durch ihn hindurch auf den See. Über die dunkle Oberfläche zogen zahlreiche Ringe – von aufsteigenden Teerblasen, nahm sie an. Sie erinnerte sich, irgendwo gelesen zu haben, dass speziell diese Grube regelmäßig mit Wasser gefüllt wurde, um ihre Feuergefährlichkeit zu mindern. Die Oberfläche zeigte gebrochene Reflexionen der Gewächse ringsherum, die Kronen einiger Kaiserpalmen am Wilshire Boulevard und die geometrische Form eines Gebäudes. Sie konnte auf dem Wasser die langen, gebogenen Stoßzähne eines gigantischen prähistorischen Mammuts ausmachen, eine der Nachbildungen, für die die Teergruben berühmt waren und die im und um den See herum standen.
»Absurd«, sagte Cameron neben ihr. »Dieser Ort ist so …«, er suchte nach einem Wort, »ursprünglich. Dieses ganze prähistorische Zeug mitten in dieser Stadt, so modern und auf dem allerneuesten Stand …«
»Du hast recht«, murmelte sie und starrte auf das Gebäude, das sich in der Teergrube neben den Stoßzähnen des Mammuts spiegelte. »Es ist eine unglaubliche Konstellation.«
»Ich stelle mir immer vor, dass Jimmy Hoffa vielleicht hier liegt.«
»Warum nicht? Zusammen mit Richter Crater.«
»Und vielleicht Amelia Earhart.«
»Das ist ein bisschen weit hergeholt.« Kate ging zurück zur Parkbank. Sie untersuchte die schwarzen Streifen und meinte: »Vor langer Zeit hat ein heftiger Wind den Teer vom Tümpel auf die Bank geweht.«
»Klingt logisch.« Cameron zeigte auf einige verwischte Kratzer in den Teerflecken. »Vielleicht saß das Opfer hier, als ihm zustieß, was immer ihm zustieß. Zuerst hat er sich an die Bank geklammert, dann ist er auf die Füße gestolpert. Das würde auch das Zeug auf seinen Händen und unter seinen Nägeln erklären.«
»Vielleicht«, sagte Kate, erfreut, dass Cameron die Ränder unter den Nägeln des Opfers auch bemerkt hatte. Als sie wieder Kinderstimmen von der Aussichtsplattform hinter ihnen hörte, dachte sie daran, dass man einen Ort wie diesen, im Gegensatz zum Kunstmuseum, nicht alleine besuchte. Hatte jemand diesen alten Mann begleitet? Könnte ein Enkelkind verloren über das Gelände irren?
Der Tote könnte durch natürliche Ursachen umgekommen sein. Aber wie Hansen roch sie hier etwas Merkwürdiges, und es war nicht nur der Teer. Sie sagte zu Cameron: »Tun wir, was wir tun können, solange wir auf den Gerichtsmediziner warten.«