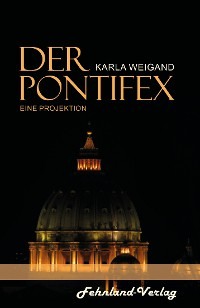Czytaj książkę: «Der Pontifex»
Karla Weigand
Der Pontifex
Eine Projektion

Weigand, Karla: Der Pontifex. Hamburg, Fehnland Verlag 2021
Originalausgabe
EPUB-ISBN: 978-3-96971-165-1
Der Titel ist auch als Print zu beziehen:
Print-ISBN: 978-3-96971-164-4
Korrektorat: Emilia Endler, Sophia Krämer, Denise Nadler
Umschlaggestaltung: © Annelie Lamers, Fehnland Verlag
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der Fehnland Verlag ist ein Imprint der Bedey & Thoms Media GmbH,
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg und Mitglied der Verlags-WG:
https://www.verlags-wg.de
© Fehnland Verlag, Hamburg 2021
Alle Rechte vorbehalten.
https://fehnland-verlag.de/
Für meinen lieben Mann Jörg, dem ich so vieles verdanke!
„Gott ist kein Christ.“
(Desmond Tutu; anglikanischer Theologe, 1986–96 Erzbischof
von Kapstadt und erstes schwarzafrikanisches Oberhaupt der
anglikanischen Kirche in Südafrika; Friedensnobelpreis 1984)
„Plus ça change, plus c’est la même chose.“
„Je mehr sich ändert, desto mehr bleibt es das Gleiche.“
(Französisches Sprichwort)
ZEITUNGSBERICHT
Am 25. September 2042 ist als Aufmacher auf der ersten Seite der
New York Times unter der reißerischen Schlagzeile: „Frau im Central Park grausam ermordet“, zu lesen:
„Dunkelhäutige, etwa 35 bis 40 Jahre alte, zirka 1,75 m große, schlanke Frau in den frühen Morgenstunden, in einem abgelegenen Teil des Central Parks ermordet aufgefunden. Der blauweißen Sportkleidung und den weißen Laufschuhen nach zu urteilen, handelt es sich um eine Joggerin, die laut Polizeiarzt bereits am vorhergehenden Abend zwischen 18 und 19 Uhr zwei Schussverletzungen in Brust und Kopf erlegen ist.
Bisher ist nicht bekannt, ob sich die Frau, bei der weder Schmuck, Smartphone, Armbanduhr, Geldbörse, Schlüssel noch Ausweispapiere gefunden wurden und deren Identifizierung durch eine bewusste Zerstörung ihres Gesichts zusätzlich erschwert wird, allein oder in Begleitung in dem normalerweise kaum frequentierten Teil des Parks aufhielt.
Sachdienliche Hinweise in Bezug auf die getötete Person, ihren Wohnsitz, ihren Umgang et cetera, beziehungsweise über ungewöhnliche Vorkommnisse am gestrigen Abend, die mit der Mordtat im Central Park in Verbindung stehen könnten, bittet die Kriminalpolizei an die zuständige Dienststelle des NYPD zu richten; auf Wunsch auch vertraulich.“
Darunter sind die Kontaktdaten der betreffenden Dienststelle und verschiedener Polizeireviere vermerkt.
PROLOG
„Selig die Friedfertigen, denn sie werden Gott schauen!“
(Matthäus, 5–7: aus den sogenannten „Seligpreisungen“ der
„Bergpredigt“, einer – nach einer älteren Quelle – aus Sprüchen Jesu zusammengestellten Rede auf einem Hügel im Heiligen Land.)
„Gerade ist meine Maschine in Rom gelandet, Chérie! Drück’ mir die Daumen, dass alles so läuft, wie ich es mir wünsche. Eigentlich bin ich ja sehr zuversichtlich, dir schon bald das Startzeichen zum Umzug nach Rom geben zu können, mein Schatz!“
Nichts in seinem Äußeren deutet darauf hin, dass es sich bei dem zweiundfünfzigjährigen, hochgewachsenen und körperlich durchtrainierten Herrn in grauem Maßanzug mit hellblauem Seidenhemd nicht um einen angesehenen Geschäftsmann oder hohen Politiker vom Schwarzen Kontinent handelt, der an diesem 30. März 2039 italienischen Boden betreten hat.
Wie ein Kirchenmann sieht er jedenfalls nicht unbedingt aus – was ihm ganz recht ist. Weder ein Kreuz, noch ein weißer Priesterkragen verraten den Stand eines Klerikers.
Kardinal Maurice Obembe plaudert an diesem wunderschönen Frühlingstag wohlgelaunt per Smartphone mit Schwester Monique, einer rund zehn Jahre jüngeren schwarzen Nonne vom Orden der Kleinen Schwestern Jesu, die ihm seit etwa fünfundzwanzig Jahren nicht nur den Haushalt führt, sondern in erster Linie sein Bett wärmt. Genaugenommen, seit er einst in einer Gemeinde im ostafrikanischen Staat Ghanumbia seine kirchliche Laufbahn als selbständiger Pfarrer einer katholischen Gemeinde gestartet hat.
Auf einmal fühlt der hohe Kirchenmann sich beobachtet. Er muss sich gar nicht erst umdrehen, so etwas hat er im Gefühl …
Um etwaige unerwünschte Lauscher in die Irre zu führen, fügt er schnell ein herzliches „Danke für deine guten Wünsche, Papa!“ und „Gelobt sei der Herr!“ hinzu und beendet umgehend das Gespräch, um sich seinem Diener und „Mädchen für alles“, Patrick „Paddy“ Lumboa, zuzuwenden. Ihn hat er als Begleiter und Helfer im Konklave mitgenommen: gilt es doch, einen neuen Papst zu wählen.
„Ich werde mich jetzt um das Gepäck kümmern, Eure Eminenz!“
Der schwarze Bedienstete des Kardinals grinst bis über beide Ohren, ahnt er doch, mit wem sein Herr gerade so vertrauliche Worte gewechselt hat. Er weiß schließlich alles über Maurice Obembe und Schwester Monique: Er ist bei ihm immerhin ebenso lange als Adlatus beschäftigt, wie die schöne schwarze Nonne als Haushälterin. Aber um Privates, gar Intimes über seinen Herrn auszuplaudern, müsste Paddy Lumboa schon gehäutet und gevierteilt werden.
Als ihn jetzt der eiskalte Blick des Kardinals trifft, friert sein frivoles Grinsen augenblicklich ein; devot senkt Lumboa seinen Krauskopf, um eilig seinen Pflichten nachzukommen, während der Geistliche, einer von über einhundertfünfzig wahlberechtigten Kardinälen, sich gemächlich zubewegt auf den Infoschalter des internationalen Flughafens Leonardo da Vinci in der Seebad- und Hafenstadt Fiumicino in Latium, Provinz Rom.
Er möchte sich nach der bestsortierten Buchhandlung im Flughafengebäude erkundigen, um den neuesten Vatikanführer und ein ganz spezielles Buch über die Malereien in der Sixtinischen Kapelle zu erwerben, während sein Diener sich um den vorbestellten Wagen samt Chauffeur sowie um das umfangreiche Gepäck seines Herrn kümmern wird.
Maurice Obembe ist sich jetzt, nach mehrmaligem Umschauen, sicher, dass ihm – zumindest im Augenblick – niemand folgt. Sein Vater hat ihm schon oft im Scherz vorgeworfen, er litte an Verfolgungswahn.
Die Dame, mit der der Kardinal soeben kurz gesprochen hat, ist in der Tat Schwester Monique gewesen, seine langjährige Geliebte, die eigentlich Monica Mbeke heißt und nur sehr entfernt mit ihm verwandt ist. Ihren Familiennamen hat sie längst in Obembe umgewandelt hat, um das Märchen ihres Bruder-Schwester-Verhältnisses glaubhaft zu machen.
Sie freut sich für Maurice, der vermutlich kurz vor dem Ziel seiner Träume steht. Zumindest ist er davon überzeugt. Im Augenblick hält sich die schöne Nonne noch im Kardinalspalais in Daressalam auf und sitzt sozusagen auf gepackten Koffern. Sie wartet nur noch auf das endgültige Startzeichen ihres geistlichen Liebhabers.
Wenn nur nicht diese grässliche Unrast in ihr wäre, mit der sie am heutigen Morgen aufgewacht ist! Sie weiß, dass diese Unruhe mit einem verrückten und beängstigenden Traum zu tun hat, an den sie sich leider nicht mehr im Einzelnen entsinnen kann; immerhin hat sie verstanden, dass er sie vor Gefahren, vor Unheil und einer großen Katastrophe warnen wollte.
Und zwar vor einem Desaster, das nicht sie selbst direkt betreffen, aber doch indirekt mit ihr verbunden sein wird; denn das Unglück würde eng mit dem Mann verknüpft sein, den sie über alles liebt und nach dessen Wünschen sie ihr ganzes bisheriges Leben ausgerichtet hat.
„Reiß dich zusammen!“, befiehlt sie sich streng. „Es handelt sich nur um einen ganz dummen Traum. Ich tue besser daran, noch einmal mein Gepäck und die Reisedokumente zu überprüfen. Ich sollte dankbar sein, dass Mère Sophie, meine Oberin, mir die Erlaubnis erteilt hat, praktisch mein restliches Leben im Vatikan zu verbringen, sollte Kardinal Obembe zum Papst gewählt werden.“
Allzu viel wird sie zwar nicht mitnehmen – in Rom gibt es bekanntlich alles Nötige zu kaufen. Aber es gibt Dinge, die eng mit ihrer afrikanischen Lebensart verbunden sind und die sie in der Fremde schmerzlich vermissen würde. Außerdem sind auch Sachen dabei, die ihr helfen sollen, das nagende Heimweh, vor dem ihr regelrecht graut, etwas leichter zu ertragen.
„Denn wir haben hier keine bleibende Statt, sondern die zukünftige suchen wir.“
(Hebräer, 13, 14)
Keine Aktion im Vatikan ist aufregender als die Wahl eines neuen Pontifex. Trotz aller Verweltlichung und des um sich greifenden Unglaubens vermag sie die Menschen immer noch zu faszinieren und großes Interesse zu wecken – und beileibe nicht nur bei Katholiken.
Offenbaren sich hier doch nicht allein die frommen Wünsche und Hoffnungen für das Wohl der Kirche, sondern auch die ganz profanen Bestrebungen der Kurialen sowie ganz nebenbei die oft nicht minder bedenklichen Charakterzüge von so manch angeblich geeignetem Aspiranten.
Wie immer anlässlich eines solchen Ereignisses zeigt sich der Vatikan als Hort der Intrigen und des Ämterschachers, da die einzelnen Gruppierungen bereits kurz nach dem letzten Atemzug eines verblichenen Heiligen Vaters damit beginnen, allerlei Ränke zu schmieden, um ihren eigenen Kandidaten in Stellung zu bringen, damit dieser den Stuhl Petri besetzen kann.
In diesem Falle hat das unwürdige Gemauschel schon vor längerer Zeit begonnen, weil der Tod des letzten Papstes infolge seiner schweren Krankheit absehbar schien. Mit wahrem Feuereifer haben sich die Prälaten ins Getümmel gestürzt.
Insider wissen, dass man dabei durchaus nicht zimperlich verfährt, sondern, wie keineswegs unüblich, zu Überredung, Verleumdung und Bestechung greift; oder, wenn dies nicht fruchtet, dazu übergeht, kaltschnäuzig und erpresserisch einen Gefallen einzufordern, auf den man glaubt, aufgrund einstiger erwiesener Wohltaten ein Anrecht zu besitzen.
„Do ut des“ ist eine Masche, die sich allgemein, nicht erst seit Anbeginn der Kirche, großer Beliebtheit erfreut.
„Das Schachern und Feilschen wie auf einem arabischen Basar ist im Konklave seit jeher üblich“, geben die Beteiligten untereinander auch ungeniert zu. „Die Anhänger der einzelnen Kandidaten sondieren, debattieren, agitieren und intrigieren, was das Zeug hält, um den Gewünschten auf den Papstthron zu hieven; was, nebenbei bemerkt, immer ein Spiel mit offenem Ausgang ist. Jede Neuwahl eines Pontifex ist für eine Überraschung gut“, behauptet mit bemerkenswerter Ehrlichkeit ein sogenannter Insider, der seit dreißig Jahren im Vatikan residiert.
Und das Verhandeln zieht sich hin. Aber damit rechnet sowieso ein jeder, der sich ins Konklave in die Sixtina begibt, die Privatkapelle des jeweiligen Heiligen Vaters.
Kardinal Obembe ist nicht bange, als sich herausstellt, dass im Konklave augenblicklich eine Art Wettrennen anhebt zwischen den Anwärtern von Manila und Myanmar, letzteres ein überwiegend buddhistisches Land mit etwa fünf Prozent Christen, wobei der Anteil an Katholiken geringer ist als der an Protestanten.
Vor jedem Wahlgang bemühen sich die jeweiligen Anhänger der ostasiatischen Kardinäle, bei möglichst vielen Konzilsvätern auf Stimmenfang zu gehen. Aber das haben Obembe und seine wenigen Getreuen von vornherein einkalkuliert.
Den beiden Geistlichen hat man weltweit im Vorfeld die größten Chancen eingeräumt, neuer Papst zu werden.
Grund dafür ist der Zustand der Kirche, vor allem in Europa, der sich besorgniserregend bis katastrophal zeigt. Massenweise Kirchenaustritte, vor allem nachdem zahlreiche sexuelle Missbrauchsvorfälle an Kindern und Jugendlichen für Aufsehen sorgten, kaum Priesternachwuchs, so gut wie keine Täuflinge, Gleichgültigkeit gegenüber kirchlichen Geboten. Kurz gesagt: die Kirche spielt selbst im alltäglichen Leben von Katholiken kaum noch eine Rolle. Religiöses Brauchtum gilt bestenfalls noch als „folkloristische Zutat“.
„Der moderne Mensch hat offenbar keine Bindung mehr an Mutter Kirche; vor allem in der westlichen Welt ist dies ein trauriger Fakt“, hat auch der verstorbene Heilige Vater bei jeder Gelegenheit bedauert. Dass die Kirche selbst den größten Anteil an dieser Misere hat, hat er dabei wie viele andere Kirchenobere verschämt verschwiegen, als da waren: Kungeln mit den Mächtigen auf Kosten der Unterprivilegierten, schamlose Anhäufung geradezu wahnwitziger Vermögenswerte, Sex- und Missbrauchsskandale (kaum waren die „alten“ in den Zwanzigerjahren dieses Jahrhunderts einigermaßen aufgearbeitet, kamen in den Dreißigern schon wieder neue hinzu) – und das bei einer nach wie vor rigiden, inhumanen, von den Gläubigen als indiskutabel abgelehnten „Sexualmoral“.
So scheint im Konklave von Anfang an eine stillschweigende Übereinkunft zu herrschen, dass es dieses Mal ein Papst von einem „farbigen“ Kontinent sein müsse, um das leckgeschlagene Boot Sancta Ecclesia wieder einigermaßen flott zu bekommen und in ruhigeres Fahrwasser zu steuern.
Da ist zum einen der Anwärter aus Manila – Hauptstadt der Philippinen mit achtzig Prozent Katholiken und fünf Prozent Moslems – ein kleiner rundlicher Filipino, Typ „Teddybär“, mit einem Dauerlächeln im breitflächigen Gesicht, das über seine nur Eingeweihten bekannte Gefühlskälte bestens hinwegtäuscht. Ihn hat man insgeheim schon als künftigen Papst gesehen. Zumindest solange, bis sich die Fraktion des Kardinals aus Myanmar ganz stark in Stellung brachte …
Als einer der Anhänger Obembes, ein Kardinal aus Südafrika, der sich selbst keine Chancen ausrechnet, glaubt, ihm Mut zusprechen zu müssen, winkt dieser lächelnd ab: „Gewiss, Bruder, an Kandidaten, die man als papabile einschätzt, mangelt es nicht. Aber keine Sorge, mein Freund! Auch ich kenne das römische Sprichwort: ‚Wer als Papst ins Konklave geht, kommt als Kardinal wieder heraus.’ Meine Stunde kommt noch.“
Der hochgewachsene attraktive Mann vom Schwarzen Kontinent, aus Ghanumbia, beweist damit beinahe römische Gelassenheit und Pragmatismus. Eine Haltung, die ihm schon als junger Priester, der eine Zeitlang in Italien, auch in Rom, seinen kirchlichen Dienst versehen hat, mächtig imponiert hat und die er sich sofort zu eigen gemacht hatte, etwa: „Morto un Papa, se ne fa un altro!“, übersetzt: „Wenn ein Papst stirbt, macht man eben einen anderen!“
Auch Obembes Unterstützer sind keineswegs untätig.
Je verbissener der Kampf zwischen den beiden „Gelben“ aufflammt, desto eifriger bemühen sich die „Schwarzen“ um Stimmen für ihren Kandidaten, der bis jetzt für die meisten asiatischen und europäischen Anwesenden noch ein ziemlich unbeschriebenes Blatt ist.
Eine Tatsache, die ihn nebenbei bemerkt deutlich von Patrice Obembe unterscheidet, seinem dreiundsiebzig Jahre alten Vater, seit etwa vier Jahrzehnten unangefochtener Präsident von Ghanumbia, einem nicht ganz unwichtigen Staat in Ostafrika, in dem über neunzig Prozent der Bevölkerung dem katholischen Glauben angehören. Dazu kommen etwa vier Prozent Protestanten und der Rest sind Animisten.
Den schlauen alten Fuchs kennt längst alle Welt. Hat er es doch in den letzten fünfundzwanzig Jahren verstanden, sein Land geradezu in einen afrikanischen Musterstaat zu verwandeln.
Was in den New York Times erst kürzlich auf der ersten Seite zu lesen war, hat den Kardinal mit großem Stolz auf seinen Erzeuger erfüllt: „Die Bewohner Ghanumbias sind mit ihrer Regierung sehr zufrieden; niemand strebt offenbar einen Wechsel an der Staatsspitze an, denn ‚Papa Patrice’ sorgt nicht nur für Frieden mit den Nachbarstaaten, sondern auch für Arbeitsplätze und einigermaßen Wohlstand für die Bevölkerung.
Die Löhne, die den Arbeitern gezahlt werden, erlauben ihnen zwar keine Anhäufung von Reichtümern, aber garantieren ihnen und ihren Familien ein menschenwürdiges Auskommen. Selbst die Meinungsäußerungen in den Medien können sich relativ frei entfalten.
Es gibt sogar freie Wahlen, die alle fünf Jahre stattfinden. Wozu der Präsident stets Beobachter von außerhalb nach Ghanumbia einlädt, die sich ungestört davon überzeugen sollen, dass in seinem Land alles mit rechten Dingen zugeht.“
Wie üblich hatten sich unisono andere wichtige westliche und sogar arabische Presseorgane dieser Meinung angeschlossen und Maurice Obembe glaubt mit einem gewissen Recht, sich im Glanz seines Vaters sonnen zu können und dass ihm das auch bei seiner Wahl zum Papst zugutekommen wird: „Zumindest wird mir Papas Ansehen nicht schaden!“
„Se non è vero, è ben trovato!“
(Italienisches Sprichwort, dem Sinne nach: „Wenn’s auch nicht der Wahrheit entspricht, ist’s immerhin gut erfunden!“)
Was der Kardinal mit Sicherheit weiß, ist, dass ihm auch sein Vater wünscht, dass er sein von Jugend an selbstgestecktes Ziel, den höchsten Posten im Vatikan, erreichen kann.
Als Kardinal Obembe noch ein ganz junger Priester gewesen war, hatte sein Vater ihm erklärt: „Weißt du, mein Sohn, gut zu regieren ist gar nicht so furchtbar schwer! Die meisten Regierungschefs afrikanischer Staaten scheitern an ihrer rücksichtslosen und maßlosen Gier. Wobei sie sich kein bisschen von unseren ehemaligen weißen Kolonialherren unterscheiden, die auch nur zu uns gekommen sind, um sich an uns zu bereichern und um uns auszuplündern.
Das schwarze Pack der herrschenden Oberschichten sollte sich schämen!“, hatte Patrice Obembe sich ereifert. „Es kriegt den Hals nicht voll, plündert die Ressourcen ihrer eigenen Territorien, lässt die eigene Bevölkerung ausbluten, bereichert sich selbst in geradezu obszönem Ausmaß – und wundert sich dann, wenn andauernd Unruhen ausbrechen und jahrelange Bürgerkriege ihr Land verheeren.
Und die Welt schaut zu und lässt diese Schweine gewähren! Anstatt die unfähigen Regierungschefs zum Teufel zu jagen, wenn es sein muss, auch mit Gewalt, nehmen die Europäer die in Scharen ihre Heimatländer verlassenden Afrikaner bei sich auf, anstatt ihnen ernstlich nahezulegen, sich endlich aufzuraffen und Revolutionen anzuzetteln.
Verstehe einer diese Weißen! Sie müssten es doch eigentlich besser wissen! Mussten sie sich doch ihre bürgerlichen Freiheiten ebenfalls gegen ihre Adelscliquen blutig erkämpfen. So wird sich nie etwas ändern. Ich vermute, viele Europäer möchten damit irgendwie ihr schlechtes Gewissen, das sie insgeheim gegenüber Afrikanern empfinden, übertünchen!“
Nach einer Weile hatte er vertraulich hinzugefügt: „Hör zu, Maurice! Ich bin wahrlich kein Heiliger! Deswegen aber auch kein Idiot und vor allem kein Verbrecher, der sein Volk ausplündert! Ich weiß einfach, wann es genug ist. Das Vermögen, das ich für unsere Sippe beiseiteschaffen werde, wird sich sehen lassen können. Es wird für jeden Einzelnen reichen und auch noch für etliche Generationen.“
„Weshalb dich sehr viele bewundern, Papa, ist die Tatsache, dass in unserem Land Frieden herrscht und es relativen Wohlstand für alle gibt, seitdem du vor etlichen Jahren das Ruder in Ghanumbia übernommen hast“, hatte ihm damals der junge Kaplan Maurice Obembe geantwortet. „Es werden mittlerweile sogar Stimmen laut, die dir den nächsten Friedensnobelpreis zuerkennen möchten!“
Darauf hatte Präsident Obembe herzlich gelacht und dabei sein bewundernswert makelloses Gebiss präsentiert, über das er auch heute noch, als alter Mann, verfügt: „Ich würde den Preis glatt annehmen! Aber“, fügte er verschmitzt hinzu, „man möge mit der Ehrung bitte noch ein wenig warten. Ich bin nämlich mit meinen Plänen noch lange nicht am Ende!“
Worum es sich dabei handeln würde, wollte „Landesvater Patrice“ damals noch nicht verraten – nicht einmal seinem geweihten Priestersohn. Der hatte auch nicht weiter insistiert und im Laufe der Zeit schien diese „Überraschung“ in Vergessenheit geraten.
„Gott wohnt auch im Tiger; aber das ist kein Grund, den Tiger zu umarmen.“
(Ramakrishna Paramahamsa, bedeutender hinduistischer Mystiker, 1836 – 1886)
Seit Jahren schon treibt Maurice Obembe selbst so Einiges um, das für gewaltigen Wirbel sorgen könnte. Jetzt steht er kurz davor! Ist er endlich Papst, kann er die Dinge angehen.
‚Ach, was heißt Wirbel?’, denkt er, vor Vorfreude ganz außer sich, denn er zweifelt keinen Augenblick an einem, für ihn, positiven Wahlausgang. ‚Ein Erdbeben plus Tsunami wird es sein; und zwar von einem Ausmaß, wie man es noch bei keiner Religionsgemeinschaft jemals erlebt hat!’
Vorher wird er allerdings auf keinen Fall darüber sprechen. Und sobald er es tun wird, dann auch nur mit ganz wenigen Auserwählten, die er unbedingt zur Verwirklichung braucht und deren Loyalität er sich absolut sicher sein kann; denn seine Absichten kann man beim besten Willen nicht als „lauter“ bezeichnen …
Oh, nein! Seit langem schon brennt in seinem Herzen die heiße Flamme der Rachsucht und die schmerzliche Sehnsucht nach gnadenloser Vergeltung. Immer wieder hat er im Laufe seines Erwachsenenlebens die akribischen Aufzeichnungen eines Urahnen über das schreckliche Schicksal seiner Familie und seines Volkes und die nie gebüßte Schuld der Verursacher nachgelesen. Er kennt sie mittlerweile beinah auswendig. Und hin und wieder träumt er sogar davon; so auch in der vergangenen Nacht.
Der sechsjährige Junge, genannt Maurice, zitterte vor Angst und Schwäche. Im Juni des Jahres 1894 befand sich eine kleine Gruppe, bestehend aus einigen älteren Frauen und jungen Müttern mit ihren Kindern, etliche davon noch Säuglinge, sowie aus ein paar heranwachsenden Mädchen, schon seit zwei Tagen auf der Flucht durch das unwegsame, verbuschte Gelände, das sich unmittelbar an die Pflanzung des gefürchteten weißen Bwanas, nahe der Stadt Bagamojo am Fluss Ruwu Kirigani, im Osten Afrikas, anschloss.
Die Frauen waren übersät mit Abschürfungen und frischen blauen Flecken, die dem verwilderten Gelände, das sie durchquerten, geschuldet waren; dazu waren sie gezeichnet von Hinweisen auf länger zurückliegende Faust- und Peitschenhiebe, verabreicht als Strafe für angebliche „Faulheit“ oder weil sie versucht hatten, sich gegen die ausufernde sexuelle Gewalt der schwarzen Aufseher ihres weißen „Herrn“ zur Wehr zu setzen.
Der Bwana ließ den Kerlen das meiste ihrer Übergriffe ohne Sanktionen durchgehen, weil er sie brauchte und auf ihre Loyalität angewiesen war. Eine Situation, die die Aufseher weidlich ausnutzten. Auf diese Weise konnten sie sich den weiblichen Feld- und Haussklaven überlegen fühlen und vergessen, dass sie selbst auch bloß Dreck in den Augen des deutschen Plantagenbesitzers waren.
Ein ganz junges Mädchen, fast noch ein Kind, vermochte vor Schmerzen kaum mehr zu laufen; immer wieder lief ihm ein dünner Blutfaden zwischen den mageren Oberschenkeln herab. Ein betrunkener Besucher ihres „Besitzers“ aus Potsdam war in der Nacht vor der Flucht mit äußerster Brutalität gegen das noch unberührte Mädchen vorgegangen.
Der hässliche Vorfall reihte sich ein in eine ganze Serie dieser, inzwischen alltäglichen, Missbrauchsvergehen gegen schwarze Frauen. Kinder und jedes weibliche Wesen bis zu einem gewissen Alter hatten ständig damit zu rechnen, dass ein weißer „Herr“ sein „Recht“ einforderte, die „Sklavinnen“ und deren Nachwuchs, selbst kleine Jungen, missbrauchen zu dürfen.
Auf vielen Pflanzungen besaß dieses „Recht“ auch für die schwarzen Wächter stillschweigende Geltung, um sich ihrer Ergebenheit zu versichern.
Widersetzlichkeit der Rechtlosen wurde im Allgemeinen mit Prügeln geahndet. Wobei diese Art der Bestrafung nicht nur dem Herrn zustand, sondern auch seinen Söhnen oder Freunden, die zu Besuch weilten sowie den bereits erwähnten weißen und schwarzen Aufsehern.
Ältere Eingeborene und kleinere Kinder waren nicht selten von Unterernährung betroffen. Wer nicht mehr oder noch nicht die volle Arbeitsleistung auf einer Plantage erbrachte, hatte mitunter mit drastischer Reduzierung der zugeteilten Essensrationen zu rechnen; ganz nach dem Motto: „Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen!“
* * *
Es war bereits später Nachmittag. Die letzte Mahlzeit, ihm und seinen kleineren Geschwistern von ihrer Mutter Elisa zugeteilt, hatte Maurice am vergangenen Abend zu sich genommen. Es hatte sich um fette schwarze Raupen einer großen blauschillernden Käferart gehandelt, die sie und die anderen Frauen im nahezu undurchdringlichen Gebüsch am Rande des größtenteils überwucherten Dschungelpfads gesammelt hatten.
Sein Hunger war größer gewesen als der Ekel und er hatte das auf einer Lichtung über einem kleinen Feuerchen geröstete Viehzeug mit Todesverachtung in den Mund gesteckt und ohne viel zu kauen, heruntergeschluckt. Im Augenblick konnte sich der kleine Junge vor Hunger nur noch mühsam aufrecht halten; die von Insekten zerstochenen dünnen Beine, die in kurzen Hosen steckten, drohten dem Sechsjährigen den Dienst zu versagen.
Seit Stunden marschierten sie auch am zweiten Tag, jeweils zu zweien und hintereinander, schweigend im Gänsemarsch einen gewundenen schmalen Pfad entlang, der kein Ende zu nehmen schien. Die Vorausgehenden bedienten sich ihrer Macheten, um das Dickicht zu lichten und lösten einander dabei regelmäßig ab. Das Tempo war auch am Ende dieses Tages noch zügig und duldete keinerlei unnötige Verzögerung.
Maurice, beinahe im Halbschlaf, erinnerte sich an frühere Buschwanderungen, um ihre Nachbardörfer zu besuchen. Das war vor zwei Jahren gewesen, zu einer Zeit, als alles noch gut zu sein schien und er und seine Familie freie Menschen in ihrem eigenen Dorf gewesen waren. Da hatte man unterwegs gescherzt und gelacht und, um sich die Zeit zu vertreiben, während des Marschierens fröhliche Lieder gesungen.
Eines hatte er ganz besonders geliebt. Es handelte von einer Riesenschlange und ihrem Feind, dem Leoparden, der sie fressen wollte. Aber die listige Schlange wartete ab, bis die Raubkatze eingeschlafen war und erwürgte sie dann im Schlaf. Zur Strafe wurde das Kriechtier dann von einem tembo, einer hier lebenden Waldelefantenart, zertrampelt …
An diesem Tag jedoch sang niemand; man war auf der Flucht und es galt, unbedingte Ruhe walten zu lassen. „Keinen Laut, Freunde!“, hatte seine Mutter Elisa alle, aber besonders die kleineren Kinder ermahnt.
„Sonst findet uns der böse weiße Mann und bestraft uns hart, weil wir ihn unerlaubt verlassen haben! Unsere einstige Freiheit haben wir längst verloren, meine Lieben“, wiederholte sie für die Erwachsenen. „Für uns gilt:
‚Deus dedit, Deus obstulit!’ – ‚Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen!’“, zitierte Elisa einen Spruch des Hiob aus dem Alten Testament, den sie von einem weißen Missionsbenediktiner gelernt hatte, der sie und ihre Kinder neulich getauft hatte.
Diese Taufe war zwar nicht ausdrücklich gegen ihren Willen erfolgt – zu ernsthaftem Widerstand hatte ihr in ihrer Lage der Mut gefehlt. Aber als Christin empfand sich die schöne stolze Frau vom Stamm der Wahehe ihr ganzes Leben lang nicht.
„Wer, wie wir, auf der Flucht ist, muss sich sputen und darf dem Feind keine Gelegenheit zum Einholen bieten“, hatte die Mutter all jenen eingeschärft, die entschlossen waren, mit ihr zu gehen und heimlich die Plantage des weißen Mannes, dessen „Schützlinge“ sie allesamt waren, zu verlassen.
Einer der vornehmsten Häuptlingsfamilien des Landes entstammend und vor kurzem noch die Ehefrau, jetzt aber die Witwe Mkwas, des tapferen Wahehe-Oberhäuptlings, genoss Elisa den Respekt und das Vertrauen der anderen Schwarzen.
Mtaga, so ihr ursprünglicher Name, später nach der heiligen Elisabeth „Elisa“ getauft, war es auch gewesen, die eine Gelegenheit gesucht und gefunden hatte, die schwarzen Wachtposten auf der Farm auszutricksen und der Knechtschaft zu entkommen – bis jetzt jedenfalls.
Maurice registrierte trotz seines Alters sehr genau, dass die Gruppe es sorgsam vermied, auch nur in die Reichweite von weißen Kolonisatoren oder katholischen Missionsstationen zu gelangen, weil nach Elisas Erfahrung die Mönche und Nonnen meistens mit den deutschen Kolonialherren kollaborierten.
Die Deutschen selbst, Offiziere und Siedler, nannten ihr Vorgehen dreist „Inobhutnahme“ oder „Schutzhaft“, welche sie der „heidnischen“ und „geistig und kulturell zurückgebliebenen Ureinwohnerschaft“ angedeihen ließen, während die frommen Missionare es vorzogen, beschönigend von „barmherziger Fürsorge im Geiste Jesu Christi“ zu sprechen …
Als Maurice hilfesuchend nach der Hand seiner neben ihm ausschreitenden Mutter Elisa greifen wollte, wurde ihm bewusst, dass er ausnahmsweise von ihr keine Unterstützung erhoffen durfte. Die stolze junge Frau, wie selbstverständlich die Anführerin der Flüchtigen, trug nicht nur ihr vor sieben Monaten geborenes Baby, das noch gestillt werden musste, in einem Tragetuch auf dem Rücken; sie schleppte außerdem neben einem schäbigen Bündel mit dem spärlichen Gepäck der Familie noch seine zwei Jahre alte Schwester auf der Hüfte.
Sein jüngstes Kind hatte Maurices Vater Mkwa Obembe gezeugt, nachdem es ihm gelungen war, nachts heimlich seine bereits in Obhut genommene, sprich versklavte Frau Mtaga in einer Arbeiterhütte auf der Plantage aufzusuchen, ehe er sich erneut mit seinen Kriegern in den Kampf gegen die deutschen Okkupanten gestürzt hatte. Es sollte sein letzter Waffengang werden.
Gestorben war der Vater des Jungen als Heide, da er sich noch unter dem Galgen standhaft gegen die von einem Priester penetrant „empfohlene“ Taufe zur Wehr gesetzt hatte. Es war ihm sogar gelungen, zu fliehen, während die übrigen gefangenen Kämpfer sich widerspruchslos in ihr Schicksal gefügt hatten, als Christen hingerichtet zu werden.
Genützt hatte ihm die Flucht allerdings nichts, da man ihn bald wieder aufgespürt und kurzen Prozess mit ihm gemacht hatte.
Trotz seiner Erschöpfung bekam Maurice mit, dass Elisa sehr aufmerksam auf ihre Umgebung achtete, soweit das undurchdringliche Laubwerk des den Pfad säumenden Gesträuchs dies zuließ. Vor allem hatte sie ein scharfes Auge auf ihren zweiten Sohn Heinrich, genannt Henri, der am vergangenen Tag seinen vierten Geburtstag begangen hatte. Ihn ließ Elisa ein paar Schritte vor sich herlaufen, um jederzeit beobachten zu können, wie es dem Kleinen erging.