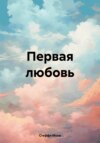Czytaj książkę: «Die Polysportanlage Lachen in Thun»
Jürg Hünerwadel
Die Polysportanlage Lachen in Thun
Kanton Bern
Vom Schwemmland zum Freizeit-Eldorado
Schweizer Sportstättenbau in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
«Höher, weiter, schneller»
Sportstättenbau als neue öffentliche Bauaufgabe
Leistungs- und Breitensport im Dienste der Gesellschaft
«Der Zwang, irgendwie gute Figur zu machen» – Das Thuner Strandbad
Badefreuden in Aare und Thunersee
Die Seebadanstalt von 1922
Das Strandbad von 1932/33
Nachkriegszeit: (K)ein nationales Wassersportzentrum
Sanierung und Umbau 2017–2020
Ausbau zur Polysportanlage 1950–1954
Die Wiederaufnahme der Idee
einer Grosssportanlage im Lachen
Leichte Muse bei sanfter Brise – Breitenkultur am See
Abschluss des Bauprogrammes und offene Zukunft
Die Lachenhalle
Das gescheiterte Projekt
Freizeit- und Hafenanlage Seeallmend (FUHAS)
Die zu klärende künftige Nutzung des Lachenareals
Würdigung
Anhang
Pläne
Impressum
Vom Schwemmland zum Freizeit-Eldorado
Nomen est omen. Einerlei, ob man die Gegend als «in der Lachen» oder «an der Lachen» bezeichnet, ihre etymologische Herkunft hat sie im Begriff Lache (Pfütze, Sumpf). Wenig erstaunlich also, dass das Gebiet am Dürrenast in Thun wegen häufigen Hochwassern während langer Zeit kaum bebaut wurde. Bis 1920 gehörte es zur ehemals eigenständigen Landgemeinde Strättligen. Es war ruhig am See. Zu hören waren höchstens das Hämmern aus der Schiffswerft und das Tuckern der Lediböcke (Lastkähne), die gelegentlich im Lachenbecken anlandeten. Letzteres verdankt seine Entstehung einer Kiesgrube zum Abbau von Auffüllmaterial für den Damm der 1893 eröffneten Thunerseebahn. Im südöstlichen Bereich des Lachen waren ferner 1871 vier künstliche Weiher ausgehoben worden, die zunächst von der Thuner Brauerei Feller und später von der Aktienbrauerei zum Gurten (Köniz) für die Eisgewinnung genutzt wurden. Heute erinnert nur noch der Weiherweg an diese Vergangenheit.
Die Entwicklung des Areals in der Lachen vom Schwemmland zum «Schwimmland» und zum Naherholungsgebiet mit Polysportanlage erfolgte erst mit der Eingemeindung in die Stadt Thun. Jetzt gewann der Uferstreifen nicht nur als neues, zentrumsnahes Wohnquartier an Bedeutung. Der Zugang zum unteren Thunerseebecken ermöglichte den städtischen Behörden vielmehr auch die Erstellung einer schon lange ersehnten Badeanlage. Die bereits im Juli 1922 eröffnete «Seebadanstalt am Dürrenast» erfreute sich rasch grösster Beliebtheit bei der Bevölkerung. Im selben Ausmass, wie die Begeisterung für aktive und passive sportliche Betätigung zunahm, wurde in der Folge auch das Angebot an entsprechenden Anlagen auf dem Lachenareal stetig erweitert. Was 1932/33 mit dem grosszügigen Ausbau zum modernen Strandbad in der kühnen Architektursprache des Neuen Bauens begann, fand nach dem Zweiten Weltkrieg seine Fortsetzung mit der Errichtung des Lachenstadions und weiterer Sportstätten. Heute bietet die in eine naturnahe Umgebung eingebettete Polysportanlage zahlreichen Vereinen aus den unterschiedlichsten Bereichen eine Heimat. Aber auch die breite Öffentlichkeit nutzt das reiche Angebot. So hat wohl eine jede Thunerin und ein jeder Thuner persönliche Erinnerungen an glückliche Momente in einem Schwimmbecken, auf einem Rasenspielfeld oder in einer Sporthalle – und wenn nicht solche, dann vielleicht diejenigen an sonntägliche Spaziergänge auf den von Bäumen gesäumten Wegen, an einen Musical-Genuss auf furchterregender Stahlrohrkonstruktion am Seeufer oder zumindest an die Höllenqualen eines leidenden Fans auf der Stadiontribüne.

Die Bootsanlegestelle am Lachenbecken im Dürrenast mit den Pensionen «Frieden» und «Sommerheim» in der Bildmitte. Undatierte Postkarte.
In der Reihe der Schweizerischen Kunstführer sind bislang nur wenige Bände zu Sportanlagen erschienen. Hervorzuheben sind diejenigen zu den Schwimmbädern in Heiden (1931/32) und Adelboden (1931) sowie zur 1944 gegründeten eidgenössischen Ausbildungsstätte in Magglingen. Mit dem vorliegenden Kunstführer wird das Spektrum erweitert um die Darstellung einer beispielhaften städtischen Polysport- und Parkanlage für den Vereins- und Breitensport sowie die Erholung der allgemeinen Bevölkerung.
Schweizer Sportstättenbau in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
Die Schweiz kann bezüglich der Errichtung von Anlagen für die Ausübung sportlicher Aktivitäten auf eine über 100-jährige Geschichte zurückblicken. Ausgehend von internationalen Vorbildern entwickelte sich hier eine auf die heimischen Verhältnisse zugeschnittene Bautradition. In diesem Kapitel sollen in einem knappen Überblick die hauptsächlichen Etappen aufgezeigt werden. Sie hatten – alle auf ihre Weise – bedeutenden Einfluss auf die Polysportanlage auf dem Lachenareal in Thun.

Nach dem Ausbau des Seebades von 1922 (a) zum Strandbad von 1932/33 (b), kamen 1950–1954 das Lachenstadion (c) und 1966/67 die künstlichen Schwimmbecken auf einer Seeaufschüttung (d) hinzu. LK 1:25 000 Blatt Thun von 1939 (links) und 1969 (rechts).
«Höher, weiter, schneller»
Der moderne Sport (von engl. to disport = sich vergnügen) verbreitete sich im ausgehenden 19. Jahrhundert von England und den USA aus über den ganzen Globus. Namentlich in den Grossstädten, wo ein rasantes Bevölkerungswachstum und oft prekäre hygienische Verhältnisse zusammenkamen, konnten die spielerischen Betätigungen an der frischen Luft schnell Fuss fassen. Die kommunalen Behörden – zunächst in Amerika – förderten diese Entwicklung im Namen der Volksgesundheit nach Kräften. 1906 wurde dort die Playground and Recreation Association of America gegründet. Führend waren Boston und Chicago, die der breiten Öffentlichkeit in sogenannten «neighbourhood parks» Spielfelder, Aschenlaufbahnen, Tennis-Courts, Schwimmbecken, Turnhallen, Garderobenbauten sowie Multifunktionsgebäude mit Vereins- und Gesellschaftsräumen zur Verfügung stellten. 1913 wies Chicago 63 solcher Grossanlagen auf, die zusammen über 14 Prozent der Stadtfläche ausmachten.
In Europa legten insbesondere deutsche Städte ab den 1910er Jahren nach amerikanischen Mustern sogenannte Volksparks an. Gegenüber früheren städtischen Grünanlagen, die vornehmlich der Musse gewidmet waren und wo das Betreten von Rasenflächen streng verboten war, war in den neuen Anlagen die spielerische und sportliche Betätigung ausdrücklich erwünscht. Gleichzeitig sollten die Parks aber auch der geistigen und seelischen Erbauung dienen, weshalb Musikpavillons, Theaterbühnen, Cafés und andere gesellschaftliche Treffpunkte zum Bestand gehörten. Für Ludwig Lesser (1869–1957),erster freischaffender Gartenarchitekt in Deutschland und Dozent für Gartenkunst, war klar: «Wer Volksparke schafft, vermeidet den Bau von Krankenhäusern, Irrenhäusern und Gefängnissen»! In Berlin zeugt der 1920–1924 realisierte Volkspark Jungfernheide bis heute von diesem Gedankengut, in Hamburg sind es der Volkspark Altona (1913–1930) und der Stadtpark (1910–1930). In Letzterem reihten sich ursprünglich entlang einer zentralen Achse eine Stadthalle mit sozialen Einrichtungen und einem Restaurant, ein Rudersee mit Freibad, Spielflächen und – hinter einem hohen Wasserturm – die Jahnkampfbahn (Stadion) mit einem Fassungsvermögen von einst rund 50 000 Zuschauern auf; ein Sprunggarten für den Pferdesport, Tennisplätze sowie weitere Sport- und Gartenanlagen ergänzten das Angebot auf dem 148 Hektaren grossen Areal. Trotz der teilweisen Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg ist der Stadtpark auch heute noch eine grüne Lunge und beliebte öffentliche Polysportanlage in der Grossstadt Hamburg.

Plan des 1911 eröffneten Fuller Parks in Chicago mit seinen um eine zentrale Konzertpromenade gruppierten Sportanlagen. Sportliche und kulturelle Angebote gehörten bei den amerikanischen «neighbourhood parks» untrennbar zusammen.

Der Stadtpark von Hamburg, hier von Südosten, ist einer der grössten deutschen Volksparks. Foto um 1930.
Ging es in diesen Anlagen um breitensportliche Aktivitäten, so trugen die vom französischen Baron Pierre de Coubertin (1863–1937) am Ende des 19. Jahrhunderts initiierten neuzeitlichen Olympischen Spiele zur Etablierung des Leistungssports bei, bei dem das kompetitive Element des Wettkampfes im Zentrum stand. Für die ab 1896 im Vierjahresrhythmus stattfindenden internationalen Anlässe wurden in den Austragungsorten Sportstätten errichtet, die als Laboratorien und Vorbilder des modernen Stadionbaus wirkten. So wurden etwa im 1908 realisierten White City Stadium in London erstmals Wettkampfstätten sämtlicher olympischer Disziplinen in einer Gesamtanlage kombiniert; die Haupt- und Gegentribünen auf den Längsseiten sprachen mit ihren unverkleideten Stahlkonstruktionen eine nüchterne, technisch anmutende Architektursprache, die für den Sportstättenbau typisch werden sollte.
Zum Aufschwung des Sportstättenbaus trugen schliesslich auch die Wettkämpfe der neu gegründeten Sportvereine bei, die sich um 1900 in nationalen Sportverbänden organisierten. Selbst wenn die Vereine teilweise bereits Monosportstätten errichteten – etwa in Grossbritannien, wo reine Fussballstadien vorherrschten –, so waren zumindest auf dem europäischen Festland kombinierte Anlagen mit Fussballfeldern, umlaufenden Laufbahnen, Wurf- und Sprunganlagen die Regel. Dies erklärt sich zum einen durch die beschränkten finanziellen Möglichkeiten der privaten Clubs und zum anderen durch den Umstand, dass es sich oft um polysportive Vereine handelte, die unterschiedliche Sektionen aufwiesen (Fussball, Landhockey, Leichtathletik etc.).

Das White City Stadium in London. In der Bildmitte das 100m-Schwimmbecken mit Sprungturm, umgeben von Aschenlauf- und Radrennbahn. Foto von 1908.
Sportstättenbau als neue öffentliche Bauaufgabe
In der Schweiz wurde der Sport ebenfalls bald populär. Die stark britisch geprägten Ausgangspunkte waren hier vorab der aufblühende Tourismus und das Internatswesen. Mit dem Fremdenverkehr breiteten sich der Alpinismus, die Wintersportarten und das Tennisspiel aus, während sich in den Westschweizer Internaten das Fussballspiel zunehmender Beliebtheit erfreute. Zwischen 1890 und 1920 erfasste die Sportbewegung breite Gesellschaftsschichten. Auch auf Verbandsebene erfolgten nun Gründungen und Zusammenschlüsse. So fusionierte unter anderem die 1895 von elf Fussballvereinen gegründete Schweizerische Football-Association 1919 mit dem Schweizerischen Athletik-Sport-Verband zum Schweizerischen Fussball- und Athletik-Verband (SFAV), der bis 1955 bestand. Ein starker Impuls ging schliesslich vom 1920 revidierten Fabrikgesetz aus. Mit der Einführung des Achtstunden-Arbeitstages und dem weitgehend arbeitsfreien Wochenende verfügte nun auch die Arbeiterschicht über mehr Freizeit für sportliche Aktivitäten.
Damit stieg zugleich das Bedürfnis nach entsprechender Infrastruktur. Mit dieser raschen gesellschaftlichen Entwicklung vermochte der Sportstättenbau indessen nicht mitzuhalten. Trotz der virulenten Gesundheits- und Hygienedebatte, die im Ersten Weltkrieg angesichts der grassierenden Spanischen Grippe zusätzlich an Bedeutung gewann, war eine kommunale Sportplatzpolitik noch in den 1920er Jahren kaum auszumachen. Die Schweiz präsentierte sich diesbezüglich vielmehr als Entwicklungsland. Es waren vorab die Fussballclubs mit ihren Leichtathletiksektionen oder im Verbund mit eigenständigen Leichtathletikvereinen, die auf privater Basis erste Sportplätze und Stadien schufen. Ein schönes Beispiel dafür ist das 1924 vom FC Bern zunächst ausschliesslich für das Fussballspiel erbaute Stadion Neufeld, das 1927 mit Leichtathletikanlagen für die Gymnastische Gesellschaft Bern (GGB) und 1928/29 mit Tennisfeldern des TC Neufeld zu einer polysportiven Gesamtanlage erweitert wurde. Der am Bau mitbeteiligte Architekt Hanns Beyeler (s. Kasten S. 52) sollte auch bei der Entwicklung des Lachenareals eine zentrale Rolle spielen.
Die erste öffentliche Grosssportanlage der Schweiz wurde von der Stadt Lausanne ab 1921 am Ufer des Genfersees verwirklicht. Treiber war dabei unter anderem die Tatsache, dass Baron de Coubertin 1915 den Sitz des Internationalen Olympischen Komitees nach Lausanne verlegt hatte. Das nach ausländischen Vorbildern weitläufig angelegte Stade de Vidy bestand unter anderem aus einem Wettkampfstadion für Rasenspiele und Leichtathletik, Übungsplätzen, einer Tennisanlage sowie Garderobengebäuden für Badefreudige am Sandstrand. Später wurde der bis heute sehr beliebte Volkspark mit einem Strandbad, einem Bootshafen und einem Theaterbau erweitert.

Bern, Stadion Neufeld, gemeinsame Heimstätte des einstigen Lokalmatadors FC Bern und der Gymnastischen Gesellschaft Bern (GGB). Foto um 1927, kurz nach dem Ausbau mit leichtathletischen Anlagen.
Erst um 1930 rückten öffentliche Anlagen für Spiel- und Sport definitiv in den Fokus der Stadtplaner. Inzwischen hatte sich – angetrieben durch die Ärzteschaft – die Erkenntnis durchgesetzt, dass eine moderne Körperkultur eine unabdingbare Voraussetzung für die Volksgesundheit und die allgemeine Wohlfahrt bedeute, weshalb ihr auch das staatliche Augenmerk gelten müsse. Der Sportstättenbau wurde nun auch Thema von weitherum beachteten Ausstellungen. Unter dem Motto «mens sana in corpore sano» diente die I. Schweizerische Ausstellung für Gesundheitspflege und Sport (HYSPA) in Bern im Sommer 1931 zum einen dazu, die Bevölkerung über die Wichtigkeit und Notwendigkeit von Hygiene und körperlicher Ertüchtigung aufzuklären. Zum anderen richtete sie sich an die Behörden auf allen Stufen des Landes. Diverse Städte – darunter auch Thun – stellten dabei ihre realisierten und geplanten Sportstätten vor. Die Frage der Gestaltung von zeitgemässer Sportinfrastruktur stand im Mai 1931 auch bei der Basler Ausstellung «Neue Sportbauten» im Zentrum. Die dortige Avantgarde des Neuen Bauens um den Ausstellungskurator und Kunsthistoriker Georg Schmidt (1896–1965) betonte im Ausstellungskatalog eine direkte Parallele zwischen dem Neuen Bauen und dem Ziel sportlicher Betätigung, welche sich beide gegen die der Natur aufgezwungene geometrisch-symmetrische Form wenden würden. Der von alten Zwängen befreite «Neue Mensch» sollte sich in ebensolcher Umgebung an Licht, Luft und Sonne bewegen können. Eine neoklassizistische Architektursprache der Hochbauten, wie sie im Lausanner Stade de Vidy vor dem Hintergrund des engen Bezugs zur olympischen Bewegung noch vorherrschte, kam damit nicht mehr in Frage. Den Abschluss machte die 1935 im Zürcher Kunstgewerbemuseum gezeigte Ausstellung «Das Bad von heute und gestern». Sie stand ganz im Zeichen des neuen Körperbewusstseins, das neben der Hygiene auch die Erholung vom hektischen Alltag durch Freiluftaktivitäten beinhaltete. Auch hier wurde die Forderung hin zur «lockeren, gelösten Anlage unter stärkster Einbeziehung landschaftlicher Werte» erhoben.

Lausanne, Stade de Vidy. Projektplan von Architekt Jacques Favarger (1889–1967) von 1921.
In diesem Umfeld erlebte der Sportstättenbau einen gewaltigen Aufschwung, an dem sich die Architekten der Moderne mit Elan beteiligten. So wurden in den frühen 1930er Jahren – teils auf private, teils auf öffentliche Initiative hin – in den Schweizer Städten und den Kurorten des Alpenbogens zahlreiche Schwimmbäder realisiert. Daneben entstanden öffentliche Anlagen für weitere Sportarten, von denen diejenige auf dem St. Jakob-Areal in Basel mit über 200 000 m2 Grundfläche bis heute die Grösste ist. Für die Nutzung durch die Schulen, Turn- und Sportvereine und die breite Öffentlichkeit vorgesehen, fasst sie eine Vielzahl von Übungs- und Wettkampfstätten in einer naturnahen Umgebung zusammen.
Die prekäre Situation in der Wirtschaftskrise der Dreissigerjahre liess allerdings nicht immer alle Wünsche befriedigen. Manch eine Anlage wurde nur in reduziertem Ausmass oder in Etappen verwirklicht, die zudem wegen des Zweiten Weltkrieges oft erst um die Mitte des 20. Jahrhunderts abgeschlossen werden konnten. In Basel etwa konnte Hanns Beyeler um 1935 in zwei Schritten lediglich die Grundinfrastruktur erstellen. Das Fussballstadion und das Gartenbad wurden erst in den 1950er Jahren gebaut, die Sporthalle gar erst 1970–1974. Die Grossbaustellen boten den Kommunen aber immerhin die willkommene Gelegenheit, im Rahmen von Notstandsarbeiten zumindest einem Teil der von der Krise in die Arbeitslosigkeit getriebenen Menschen eine Beschäftigung zu ermöglichen.
Darmowy fragment się skończył.