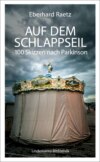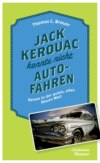Czytaj książkę: «Die kleinen Hunde»

Johannes Hucke
Die kleinen Hunde
Ein Elsass-Krimi
von der Fleckenstein

Gewidmet ist das Buch Andreas Förderer,
dem unermüdlichen Conferencier
im deutsch-französischen Kulturaustausch.
Johannes Hucke, geb. 1966, ist Autor und Projektentwickler. Seine zahlreichen Buchveröffentlichungen umfassen Romane, Lyrik, Weinliteratur und Theaterstücke. Zudem schreibt er für verschiedene Zeitungen und Magazine im Bereich Feuilleton, Weinbau und Gastronomie. Der mehrfach ausgezeichnete Autor war Mitarbeiter der Yehudi-Menuhin-Stiftung Deutschland. Er unterstützt als Diplom-Sozialpädagoge zahlreiche soziale Projekte. Zudem ist er Gastdozent an der Fachhochschule Ludwigshafen und Mitglied der Mannheimer Filmautoren. Als Theaterautor ist er erfolgreich u. a. mit dem Wein-Theaterstück „Kellersequenz“ und „Dessert“. In Lindemanns Bibliothek erschienen: „Kraichgauer Weinlesebuch“ (2. Aufl. 2009), „Rotstich“ (2. Aufl. 2010), „Die Brettener Methode“ (2011), „Frühlingsfahrt“ (2011), „Südpfalz Weinlesebuch“ ( 2. Aufl. 2010), mit Holger Nicklas die Fußball-Krimis „Strafraum“ (2. Aufl. 2010) und „Totland“ (2010), die Unternehmensgeschichte „Das Beste aber ist das Wasser“ (2010), „Frankfurter Stückchen. Ein Märchen aus der neuen Altstadt“ (2010), „Neckarstadt Western. Der durchgeknallte Mannheim-Roman“ (2010), „Libellen greifen selten zu Labello“ Gedichte (2010), „Bergstraße Weinlesebuch“ (2. Aufl. 2012), „Aqua Asini“ (2012), „Himmelberg“ (2012), „Jagdstern“ (2013), „Das Mesa-Projekt“ (2013), „Cuisine Étoilée“ (2014), „Churfranken Weinlesebuch“ (2014). Außerdem ist er Mitherausgeber der Karlsruher Kindergedichte „Wo ich hingeh, geh ich hin“ (2011).
Gimbelhof
„Darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie ein Idiot sind?“ Das Gespräch am Tisch unter der Linde nimmt eine unerfreuliche Wendung. Nicht lange hat es gedauert, bis sich „der Neue“, erst am Vormittag zu den Kulturbeauftragten des Club Vosgien aus Sélestat hinzugestoßen, mit dem Vorsitzenden in die Haare gerät. Kein Wunder – beide sind Männer, alle anderen Frauen, acht an der Zahl, also, was soll man machen?
„Oh, meinen Sie?“, entgegnet der Attackierte. Sein Spitzbart vibriert. „Das wäre mir allerdings neu.“
Der Aggressor lässt sich nicht beirren. Die Falten auf seiner hohen Stirn bilden ein gefährliches Dreieck. „Wenn Sie schon das Zeilenabstandsvolumen mit 3,5 beziffern, dann müssen Sie doch wohl auch berücksichtigen, dass ...“
Keiner der anwesenden Damen ist klar, worüber sich die beiden augenblicklich streiten. Es scheint nicht einmal eindeutig, ob es die Kombattanten selber so genau wissen. Das Thema hat mehrfach gewechselt, von Ultraschalluntersuchungen bei Föten über Verfahrenstechniken im Blitzröhrenbau bis zu neuesten Entwicklungen beim Benzinsparen – Hauptsache, man ist unterschiedlicher Auffassung. Entschlossen greift die Schriftführerin des Clubs zur gebräuchlichen Methode. Sie wechselt das Thema.
„Also das ist doch ... Jetzt schauen Sie doch mal!“ Ihrem Fingerzeig folgen neun Augenpaare – über die Wiese, über die goldglänzenden, leise wehenden Bäumchen hinweg bis hinüber zum Wald, dessen Gipfel vom Krappenfelsen überragt werden, einem der zahlreichen sandsteinernen Felsen in der Gegend.
„Oh.“
„Der ist aber mutig.“
„Mutig? Ich würde sagen: verrückt. Lebensmüde. Untauglich für die Gesellschaft.“
„Ach was. Der ist doch angeseilt. Der kommt schon wieder runter.“
„Sicher. Nur wie?“
Auch diese Gelegenheit lassen die beiden Streithähne nicht ungenutzt, mit entgegengesetzten Ansichten die Frauen zur Entscheidung zu nötigen, wer denn künftig das Sagen in der Kulturabteilung der Untersektion Sélestat des Club Vosgien haben soll. An einigen anderen Tischen ist man ebenfalls aufmerksam geworden; mehrere Gäste halten Ferngläser vor die Augen oder blinzeln angestrengt. Einer nutzt das Teleobjektiv seiner Kamera.
„Nein. Kein Seil“, wendet sich der Fotograf, der ein großes Glas Bockbier und ein Viertelstück Münster mit frischem Weißbrot vor sich stehen hat, an die Schlettstadter Gruppe. „Ich kann es ganz genau erkennen: ein Freeclimber.“
„Also das ist doch verrückt!“
„Sag ich ja.“
„Selber schuld, wenn er abstürzt. Mir tut er nicht leid.“
Auf dem schmalen Rasenplatz vor dem Gimbelhof unweit der Ruine Fleckenstein, der kühnsten Burg der nördlichen Vogesen, sind noch nicht alle Plätze besetzt. Nicht ohne Rührung gedenken die Connaisseurs dieser famosen Ferme Auberge, wenn sie wieder daheim sind, in der Ebene. Dieser Baeckeoffe, dieses Choucroute – unvergesslich! Schon die Weinkarte, bestückt von einfachem Edelzwicker bis zur exzeptionellen Grand Cru Schoenenbourg des Weinguts Dopff, ist einer weiten Anreise wert. Es ist Vormittag – der strahlendste seit Wochen! Endlich wird die Landschaft wieder von jenem milden Schimmer überglänzt, weswegen so viele Schönheitssucher seit Menschengedenken den Weg hier herauf finden.
Endlich hat sich dieses unzeitige Tief verabschiedet, das von Mitte August bis Anfang September eine unstatthafte Tristesse über die Wälder ausgoss und den Weinjahrgang aufs Schnödeste gefährdete. Umso emsiger scheint jetzt diese feuchtschmelzende Sonne über den Matten zu weben, aufatmend dehnen sich die Wanderer und drehen sich dem Licht zu wie sonderbare, ein wenig aus der Form geratene Urweltpflanzen. Keiner sucht jetzt mehr den Schatten wie noch wenige Wochen zuvor, als das Land am Oberrhein vom Hochsommer in seine Bestandteile zerkocht wurde. Selbst hier oben, wo man doch mit erlösenden Waldesbrisen rechnen sollte, war es kaum mehr auszuhalten, sodass vorübergehend sogar der Gimbelhof weniger frequentiert wurde als zu dieser Jahreszeit üblich.
„Diese Extreme – schrecklich!“, hieß es allenthalben. „Es gibt einfach keine Übergänge mehr ...“
Doch jetzt ist alles wieder gut. Aus vier Richtungen nähern sich die Ausflügler zu Fuß und in Cabrios, auf Mountainbikes und in Reisebussen, vollbesetzt mit nervösen Schulkindern. Diese freilich haben die Ruine Fleckenstein zum Ziel; ihre sensationshungrige Fantasie soll nicht enttäuscht werden. Sogar am Tisch der konkurrierenden Vogesen-Kenner wird mit der nächsten Flasche Auxerrois ein Separatfrieden geschlossen. Man hat jetzt schließlich etwas zu tun: offenen Munds diesen Waghalsigen bestaunen, der da drüben am Felsen seinem riskanten Hobby nachgeht. – Für Außenstehende ist es schier unbegreiflich, wie ein Menschlein, das doch – wie alle anderen auch – nur zwei Arme und Beine aufweist, so unerschrocken und griffsicher an einer Steilwand wie dem Krappenfelsen emporzuklimmen vermag. Nur selten, sehr selten ein Verweilen, dann geht es schon wieder weiter, hurtig hinauf, wie gezogen von einer aus der Höhe wirksamen Macht. Am genauesten sieht der Mann mit dem Teleobjektiv: Durchtrainiert ist dieser Bursche da drüben, oh ja! Die Rückenmuskulatur gibt ein Schauspiel wie ein von kräftigem Wind aufgewühltes Meer. Ach, so müsste man noch einmal beieinander sein, so kraftvoll, so viril ... Das halblange braune Haar ist schweißgetränkt. An der hellroten Bermudahose baumeln Karabinerhaken. Doch die kommen nicht zum Einsatz. Nur mit Fingern und Zehen arbeitet sich der jugendliche Held von Ritz zu Ritz, von Zacken zu Zacken. Mitunter blickt er nach droben – da hat er schon die nächste Gelegenheit zuzugreifen erspäht, und unbezwingbar langt der Arm höher, findet die Hand die einzige richtige Stelle.
Die doppelt zufriedenen Gäste auf der Terrasse des Gimbelhofs, denen sich zusätzlich zum köstlichen kulinarischen Angebot dieses Kletter-Spektakel darbietet, werden abgelenkt durch eine weitere unerwartete Szene, deren Liebreiz beträchtlich ist, allerdings ein wenig gestört wird durch skurrile Hektik, ängstliches Gebell und schrilles Schimpfen. Den Weg durch die Wiesen, am mit keltisch anmutenden Skulpturen verzierten Spielplatz entlang, kommt eine junge Frau gestapft, zwei winselnde Hunde an der Leine, zu denen sie sich in kurzen Abständen umwendet oder hinunterbeugt und auf sie einschreit. Sie trägt ein durchaus unpuritanisches Sommerkleidchen, auch ihre hohen Schuhe wollen nicht so recht in das modisch von Wanderkluft und Outdoor-Schick dominierte Waldgebiet passen. Wild flattern ihre langen Locken um die grazile Physiognomie.
Kontrollierend wandern die Blicke der Damen an den Tischen zu den Augen der Herren hinüber: Eindeutig, dieses Wesen ist eine Provokation. So fällt die Reaktion des Publikums denn auch polarisiert aus. Während bei den Herren etwas aufleuchtet, was man vorsichtig als erfreut, belustigt, fasziniert bezeichnen könnte, verrät die Mimik der Frauen tiefste Missbilligung, Aufgestörtsein, da und dort sogar spontane Kampfeslust. Es ist dieses uralte wirkungsvolle Duett sehr hellblauer Augen mit tiefdunkelbraunen Haaren, das die Genießer auf der Terrasse verstummen macht, als sich das Mädchen, die kleinen Mischlingshunde beständig mit Ermahnungen traktierend, an einem freien Tischchen, ein gutes Stück von den anderen entfernt, niederlässt. Zwischendurch nimmt sie mal den einen, mal den anderen Hund auf ihren Schoß, streichelt und küsst ihn, um ihn sogleich wieder abzusetzen und von Neuem als unfolgsam und überhaupt komplett ekelerregend zu diffamieren. Amüsiert nähert sich die Bedienung, nimmt die Bestellung auf – und bringt ein Achtel vom Pinot Noir. Die Erzürnte bezahlt sogleich. Sie stürzt das Glas hinunter, steht auf, reißt an der Leine und stampft den Wiesenweg, den sie vor wenigen Minuten herabgestiegen war, wieder hinauf.
Die Leute auf der Terrasse sehen einander an. Manche schütteln den Kopf; die meisten aber brechen in ein Gelächter aus, das durchaus nicht nur der Absurdität des Zwischenfalls geschuldet ist, sondern, zumal bei einigen Herren, vielleicht viel mehr der Verwirrung, einem solch qualvoll süßen Anblick überirdischer Schönheit ausgesetzt gewesen zu sein.
„Wo ist denn unser Kletterer hin?“
Wiederum ist es die Schriftführerin der Kulturabteilung aus Sélestat, die Aufmerksamkeit für ihre Beobachtungen erheischt. Noch einmal wenden sich sämtliche Blicke dem Krappenfelsen zu, der, nunmehr kahl, schroff, ohne rothosigen Kletterer, sein Gestein wider den Vormittagshimmel stemmt.
„Das gibt’s doch nicht! Ist er vielleicht ...“
„Abgestürzt, meinen Sie? Auszuschließen ist es nicht. Man hört ja immer wieder ...“
„Aber das wäre ja furchtbar!“
„Dass wir so etwas miterleben müssen!“
Nach und nach einigt man sich vorderhand, dass während der Zeit, als dieses aufgedrehte Ding mit seinem temperamentvollen, andere sagen panischen Verhalten die Beobachtung des Sportlers unterbrach, der junge Mann eben wieder herabgeklettert sein müsse – andernfalls würde man ja später aus der Zeitung oder aus dem Radio erfahren, dass etwas passiert wäre.
„Diese Jungs, die wissen schon, was sie tun“, besänftigt der Kulturreisende, dem es zuvor so eifrig darum zu tun war, seinen neuen Konkurrenten bloßzustellen, die Umsitzenden.
Sogar sein wehrhaftes Opfer pflichtet ihm bei, offensichtlich zufrieden, den Kampf für den Moment nicht fortführen zu müssen: „Ja, man glaubt es kaum. Da passiert viel seltener was als beim Autofahren, zum Beispiel.“
Die auf allen denkbaren Wissensgebieten hochkompetenten Herren sollen nicht recht behalten. Keine Stunde später geht ein Anruf bei der Polizeidienststelle in Lembach ein: Die aufgeregte Frau im Sommerkleidchen, Arlette Choquet, meldet ihren Freund als vermisst. Lennart von der Aue, Student der Philosophie, Theologie und Kunstgeschichte in Strasbourg, sei ihr während einer Klettertour abhandengekommen. Was der diensthabende Beamte zwischen Geschluchz und Gebell zu vernehmen vermag, ist der merkwürdige Tatbestand, dass der Felskletterer, wiewohl offenbar heruntergefallen, am Fuße des Felsens nirgendwo zu finden sei. Im sachlichen Ton eines Vernehmungsbeamten befragt er die Weinende, ob ihr Partner denn angeseilt gewesen sei. Da kommt er bei der Verzweifelten aber schlecht an.
„Ich bitte Sie! Was glauben Sie denn? Dass er ein Weichling ist, ein Versager, ein Angsthase? Lennart würde niemals an Seilen herumhangeln, Lennart ist ein Kletterer, verstehen Sie? Lennart ist ein Mann. Und Sie sind ein Spinner.“
Die Beleidigung bleibt ohne Folgen – so wie bedauerlicherweise auch der Einsatz von zweimal zwei Polizisten am Krappenfelsen. Im Verlauf des Nachmittags rückt ein komplettes Team von der Spurensuche an, inspiziert das Gelände unterhalb, turnt an der Steilwand entlang. Nichts. Kein Lennart. Keine Hinweise auf einen Absturz. Behutsam nähert sich Gilbert Kropf, der Einsatzleiter, der inzwischen verstummten Freundin des Vermissten, die auf einem Stein in der Nähe eines Waldbachs Platz genommen hat und zu Boden starrt, ohne Unterlass ihre dunklen Locken zwischen den Fingern zwirbelnd. Neben ihr liegen die beiden Hündchen, immer noch hechelnd, doch deutlich ruhiger, seit sie minutenlang kaltes Quellwasser in sich hineingeschlabbert haben.
„Was ist denn passiert?“. Kropf räuspert sich zweimal. Er bekommt keine Antwort.
„Kann es sein,“ legt er nach, „dass Sie sich gestritten haben? Sie und ihr Freund?“
„Wir streiten uns immer“, gibt Arlette zur Auskunft, ohne aufzublicken. Als sie schließlich doch ihre Augen öffnet und den Polizisten ansieht, reagiert dieser ausgesprochen unprofessionell. Gilbert Kropf hofft vergeblich, dass er nicht rot geworden ist; nein, so viel Charme auf einmal, das hat er hier, mitten im Wald, denn doch nicht erwartet.
Er zwingt sich, so gut es geht, nicht auf diese entsetzlich langen bloßen Beine zu starren, als er die nächste Frage stellt: „Aber kann es nicht sein, dass er einfach weggegangen ist, aus Ärger?“
„Nein, das kann nicht sein.“
„Und warum, wenn ich fragen darf?“
„Weil Lennart kein Feigling ist. Das hab ich dem anderen Schwachkopf schon gesagt. Weil er mich nie alleine lassen würde, verstehen Sie?“
„Ja aber, Mademoiselle – wo ist er denn hin?“
Arlette richtet sich auf. Dem Beamten läuft es heiß den Rücken hinunter. Notgedrungen heftet er seinen Blick auf einen dieser bekloppten Hunde, der sich immer wieder schmatzend in sein eigenes Fell beißt.
„Er ist noch da. In dem Felsen.“
„In dem Felsen. So. Und wie ist er da hineingekommen? Ich sehe keine Tür, Mademoiselle.“
„Sie müssen nicht so mit mir reden.“ Arlette bekommt wieder diesen giftigen Ausdruck in die Augen. „Sie haben doch keine Ahnung! Wenn Lennart in den Felsen will, dann schafft er das. Verstehen Sie?“
„Ehrlich gesagt“, kratzt sich Kropf unter der Dienstmütze, „noch nicht so ganz. Aber vielleicht geben Sie sich ja die Ehre und erklären es mir.“
Eine Wolke genügt. Schon ändert sich das Bild, die Stimmung. Das warme Rot verschwindet – übrig bleibt Felsgestein, nichts weiter. Es wirkt nur noch grau, nüchtern, abweisend. Hat überhaupt nichts mehr von diesem abendroten Glimmen wie noch eben aus der Ferne. Wie viele Wanderer haben das schon erleben müssen: ein Ausflug zu einem dieser spektakulären Sandsteinfelsen im Wasgau. Hurra, welche Freude! Bereits der Hinweg ist herrlich, durch duftige Wälder, immer in der Erwartung: Wann taucht er auf? Die Familie schwatzt, man freut sich, endlich einmal ohne Zeitdruck beieinander zu sein. Vor allem freut man sich aufs Picknick. Und dann ist man schließlich da, und diese blöde Wolke, die nicht weichen will, verdirbt alles.
„Papa, so schön ist der Felsen gar nicht, wie du gesagt hast!“
„Genau, und man kann gar nicht klettern! Man kommt gar nirgends rauf!“
Nach und nach macht sich eine gewisse Beklemmung breit; so nah an diesem steinernen Ungetüm, das einfach seine Farbe nicht wiederbekommen will, möchte niemand lange bleiben. Die Familie sitzt noch ein Weile stumm beisammen. Dann packt man zusammen und zieht weiter, an einen hoffentlich lieblicheren Ort. Die Kinder motzen noch bis zum Auto, indes sich der Himmel über dem Ausflugsziel hämisch wieder lichtet. – Viel schlimmer ist es bei Regen. Verliebte Paare, die sich hierher geflüchtet haben, in der Hoffnung, sich im Trockenen aneinander kuscheln zu können, werden ihrer Gesellschaft nicht froh. Bald lassen sie sich los. Sehen sich um. Bekommen misstrauische Mienen.
„Hier riecht es aber komisch.“
Schon fangen sie an zu zanken. Die steinerne Vorwölbung zwischen den Bäumen, die von Weitem so einladend und schützend ausgesehen hat, wirkt aus der Nähe nur unwirtlich.
„Du wirst dich doch wohl nicht nassregnen lassen wollen?“
„Jetzt bleib doch mal hier!“
„Ich will aber gehen, es ist unheimlich.“
„Angsthase! Komm zurück!“
Aber sie lässt sich nicht aufhalten. Lieber riskiert sie eine Erkältung oder Schlimmeres. Und dass ihr Liebster sie unbedingt zurückhalten wollte an diesem muffigen, feindseligen Ort, das wird sie ihm später noch heimzahlen. Durch böse Laune. Bis morgen früh. Mindestens.
Am übelsten freilich treffen es Verirrte, Verfolgte, Einsame, die in der Nacht zu einem dieser ungastlichen Felsgiganten kommen. Empfindsame aller Zeiten wussten sofort, dass hier nicht gut sein ist – sie hasteten lieber weiter, wohin auch immer. Andere, die entgegen ihrem ursprünglichen Gefühl das Gastrecht erzwingen wollten, brachten in den scharfkantigen Ausbuchtungen, unter den Felsnasen, in ausgeschwemmten Trichtern angstvolle Nächte zu. Zahllose Berichte sind erhalten über sonderbare Erscheinungen und schreckliche Vorkommnisse. Und alle diese Zeugenaussagen und Legenden und Erzählungen speisen sich aus diesem einen kaum zu verscheuchenden Gefühl, wenn es sich einmal eingenistet hat: Angst, unnennbare Angst.
Die Felsen ... Jahrhunderte, bevor talentlose Reiseschriftsteller Behelfsvokabeln wie „malerisch“ oder „pittoresk“ gebrauchten, lange bevor gewalttätige Rittergeschlechter ihre Burgen auf diese gezackten Abszesse der Erde türmten, waren sich die Bewohner dieser Gegend einig, dass es sich um Dämonen handelt, menschenfressende Vorzeitwesen, die einst auf ihrem Weg durch die Wildnis hier stehengeblieben waren ... und jeden Augenblick weiterschreiten können, um ihre ursprüngliche Tätigkeit wieder aufzunehmen: das Verschlingen von Mensch und Tier. Und tatsächlich, wenn man im Schatten oder bei Regen oder bei Nacht genau hinsieht, erkennt man die Schnäbel, die Mäuler und aufgerissenen Augen, sieht man mit Schrecken die erstarrte Geste: Ich krieg dich doch! Konnte man im Sonnenlicht wirklich so naiv sein und diese Zeichen übersehen? Wie überall üblich, wo bizarre Gesteinsformationen die Fantasie anheizen, frönten längst vergessene Völker auch hierorts mitleidlosen Kulten, opferten unberechenbaren Erdgottheiten. Da und dort – die Wissenschaft ist sich nicht immer einig – deuten Vertiefungen im Stein auf „rituelle Aktivitäten“ hin. Manch einer erkennt Hinrichtungsblöcke, Sammelbecken und Ablaufrinnen – für was wohl? Doch die Hypothesen der Historiker, wann, von wem und auf welche Weise Opfer dargebracht wurden, haben sich ebenfalls längst verselbstständigt und ihrerseits neue Geschichten hervorgebracht, die jede Generation anders begreift.
Die großartige Neutralität der Forschung verweist auf praktische Gründe, gar auf Imponiergehabe der niederen Adelsgeschlechter im Unterelsass. Was zu derart gewagten technischen Höchstleistungen, herausfordernden Unternehmungen wie dem Burgenbau auf an sich schon höchst gefahrvollen Felsvorsprüngen geführt habe, sei allemal militärtechnisch begründbar. Welch ein Unsinn! Wasigenstein, Schöneck, Fleckenstein, drüben im Pfälzischen der Berwartstein, die Dahner Schlösser, der Drachenstein ... allesamt Manifestationen der Angst, der Panik, die groteske Formen angenommen hat. Nirgendwo war man sicher vor seinesgleichen, schon gar nicht abgeschottet im Wald, preisgegeben den Elementen. Wie sehen sie denn aus, diese ach so stolzen Festungen? Es sind Ruinen! Selbst wenn einige das Mittelalter überdauert haben und erst im Zeitalter der Kanonen auseinanderbarsten, so haben diese Stätten doch vorher genug Entsetzliches gesehen. Folter und Verschmachten in lichtlosen Verliesen, Epidemien und Blutgerichte, Belagerungen, die Monate andauerten, während die verzweifelte Besatzung zum Kannibalismus überging.
Es ist auffällig, wie viele Sagen und Märchen aus dem Grenzland vom Äußersten, vom Letzten zeugen, wozu Menschen verkommen können ... Von wilden Männern, aus der Gesellschaft weggejagten Frauen, die in den Wäldern, unter Tieren lebend, nach und nach selber vertierten und Jagd machten auf die wenigen Reisenden, die sich in dieses Land der Gesetzlosigkeit vorwagten, um ihr Fleisch vom Skelett abzuschaben und roh zu genießen. Denn das Gesetz gab es nur innerhalb der Mauern, in den Marktflecken der Rheinebene, den weit verstreuten Siedeleien, die sich um einige der größeren Wehrkirchen scharten. Hier draußen war das Grauen, das Nichts der Kultur, der mit den finstersten Mitteln geführte Überlebenskampf. Selbst der sogenannte Schleichhandel, der bis in die jüngste Zeit virulente Schmuggel über die zugewucherte Grenze, in Liedern und Rührstücken romantisiert, bedeutete im Zweifelsfall beständige Furcht vorm Entdecktwerden, Herzenspein um den Sohn, den Geliebten, der das Wagnis auf sich nahm, nur dieses eine Mal noch, dann nie wieder ... und schließlich doch nicht mehr heimkehrte. Auch das Verbrechen, das Übertreten der Handelsgesetze gehörte allezeit zu den Versuchen, in denen sich das Bestreben ausdrückt, trotz aller Widrigkeiten nicht unterzugehen, nicht aufzugeben, im Zweifelsfall: nicht zu verhungern. Üble Allianzen, Treuebündnisse auf Gedeih und Verderb zwischen verfeindeten Sippen, gar zwischen Verfolgern und Verfolgten, zeitigten manch geheimen Ehrencodex, dessen Nichtachtung grausam geahndet wurde.
Treffpunkte, Orientierungsmarken der Banden waren diese Felsen im Wald, nicht die bedeutenden, die von Burgen gekrönten, sondern die versteckten, die nicht einmal allen Einheimischen bekannt waren. Auch hier geht die Mär von vergrabenen Beutestücken – das bleibt bei dieser Thematik niemals aus. Gefunden hat keiner was, zumindest nichts, was offiziell geworden wäre. Vom Krappenfelsen ist wenig überliefert; für die einen stand er wohl zu nahe am Fleckenstein, war allzu gut einsehbar und rasch erreichbar vom Tal aus; den anderen, unterwegs zur imposantesten aller Ruinen, mochte er doch recht unauffällig, geradezu vernachlässigbar erscheinen ... bis irgendwann die neue Zunft der Sportkletterer seine Vorzüge für sich entdeckte.
Wie alle Wasgau-Felsen wirkt auch der Krappenfelsen in der Dunkelheit Furcht einflößend und abweisend. Dessen ungeachtet, hält eine junge Frau heute Nacht dort Wache, begleitet von zwei Hündchen, deren Anwesenheit nicht unbedingt zu ihrer Sicherheit beiträgt. Arlette hat einfach keine Lösung, wo sie die beiden Kläffer sonst lassen sollte. Dabei sind es gar nicht die ihren; gut, anfangs, als Lennart die Welpen angeschleppt hatte, fand sie die Tierchen natürlich süß und küsste sie häufig auf den Kopf. Mittlerweile würde sie die Viecher am liebsten irgendwo einbuddeln. Den Typen von der Polizei gegenüber hat Arlette behauptet, ihre Mutter würde sie abholen. Sie wolle nach Hause fahren, ausschlafen und morgen vielleicht wiederkommen. Ihre Mutter – was für ein Witz! Wenn die wüsste, dass ihre durchgeknallte Tochter die Nacht im Wald verbringt, in dem Wahn, jeden Augenblick müsse ihr dieser nichtsnutzige Liebhaber, dieser deutsche Student mit dem Adelsnamen direktemang aus dem Felsen heraus in die Arme laufen, dann würde sie wieder einmal ihre dünn gemalten Augenbrauen hochziehen und losmeckern: „Ach, man muss sie lassen. Sie war schon immer so: bockig und unverständig. Ein verwöhntes Ding. Aber das ist ganz gewiss nicht meine Schuld.“
Caves de Cléebourg
„Begrabt mein Herz an der Biegung der Theke ... Leider gut. Fällt mir jedes Mal ein, wenn ich hier bin. Stammt aber nicht von mir. Dean Martin, glaub ich.“
„Der Spruch ist mir bekannt. Darf ich mich jetzt wieder auf den Pinot konzentrieren?“
Der Kontaktversuch des mittelblonden, noch recht jugendlich wirkenden Endvierzigers mit der um ein paar Jahre älteren Dame im strengen Kostüm in Waidmannsgrün scheint gescheitert. An der Probiertheke der Coopérative de Cléebourg stehen sie seit einer halben Stunde nebeneinander und süffeln sich durchs Angebot. Schweigend.
„Diese Nordelsässer“, beginnt der redselige Deutsche von Neuem, ungeachtet der enervierten Miene der anderen, „werden doch immer noch unterschätzt. Nicht zu glauben. Alle Welt schreit: Riquewihr! Kaysersberg! Und so weiter. Aber was die Coopérative hier oben leistet, das schafft in Deutschland kaum eine Genossenschaft.“
Als sich der Begeisterte langsam wieder der Preisliste zuwendet, offensichtlich resigniert, an dieser Stelle noch ein paar Fachsimpeleien austauschen zu können, lässt sich die dunkelhaarige Französin doch noch herab, ein paar freundliche Worte zu äußern: „Ihr Französisch ist ausgezeichnet. Die meisten geben sich nicht mal Mühe, Bonjour zu sagen, wenn sie ins Elsass kommen.“
„Oh, das ist nicht mein Verdienst“, wehrt der Deutsche ab. „Meine Mutter hat mich gequält, bis ich es einigermaßen konnte. Sprachreisen, Französisch-AGs, Sonderschichten, immer noch eins drauf. Schließlich zwei Semester in Montpellier. Wenn man’s dann nicht kann, sollte man wohl zu Hause bleiben.“
„Sehen Sie, es hat sich gelohnt.“
„Montpellier? Ja. Der Mädchen wegen! Ein Traum. Nein, meine Mutter fand, ohne Französisch – keine Kultur.“
„Womit sie zweifellos recht hat.“ Die Dunkelhaarige blickt auf, um die Ernsthaftigkeit des Kompliments zu überprüfen.
Doch ihr Gesprächspartner schaut indifferent. Den Ausgießer nutzt er nie; er leert die Probiergläser bis zur Neige. „Naja. Ich weiß nicht. Kultur? Glaube nicht, dass es so was noch gibt. Zumindest nicht in dem Sinn von früher. In Polynesien hat’s Dialekte, die sind allen europäischen Sprachen an Komplexität, Präzision und Flexibilität weit überlegen. Das wissen wir nur nicht und bilden uns was auf unser Gestotter ein. Einen Begriff für Hybris haben die wahrscheinlich gar nicht. Das ist halt Abendland.“
„Polynesien ...“ Pikiert leert die Französin das Glas in den Ausgießer. Es soll ihr letztes Wort zu dieser Angelegenheit sein. Doch in dem Augenblick streckt ihr der selbst erklärte Kenner fernöstlicher Dialekte die Hand hin: „Justus Lieberstein. Entschuldigen Sie, ich wollte Sie vorher nicht stören, Sie waren so vertieft. Ich hab Sie oben schon gesehen, auf dem Gimbelhof.“
„So? Martine Rouauld. Sie sind mir nicht aufgefallen, da oben.“
„Ach, kein Problem. Ich saß nur auf der Terrasse. Wirklich hübsch da, schöner geht’s nicht. Ich konnte Sie aus der Ferne sehen. Sie sind rübergegangen, zum Krappenfelsen.“
Martine sieht zweimal von der Preisliste auf. „Aha. Das haben Sie also bemerkt.“
„Ja, habe ich. Könnte es sein, Madame, dass wir beide mit dieser mysteriösen Örtlichkeit ... äh, dienstlich zu tun haben?“
„Mysteriös? Ich wüsste nicht, warum.“
„Nun. Nicht überall verschwinden junge Männer, einfach so.“
„Gut.“ Martine hat die Spielereien satt. Sie blickt ihrem Gegenüber direkt ins Gesicht. „Was ist los? Sie sind mir doch nicht nachgefahren, bis nach Cléebourg, nicht wahr?“
„Um Gottes Willen, nein!“ Lieberstein hebt die Hände. „Wie käme ich dazu? Ich bin hier Stammgast, seit über zwanzig Jahren. Als ich vorhin mein Fahrrad abgestellt hab, da sind Sie gerade reingegangen. Und da dacht ich mir, na ja, irgendwann lernen wir uns ja sowieso kennen, da nutz ich doch gleich mal die Gelegenheit.“
Rouauld schweigt. Diese Rollenverteilung ist ihr unangenehm. Normalerweise legt sie größten Wert darauf, selbst einen Wissensvorsprung zu behaupten.
„Madame von der Aue hat Sie beauftragt, stimmt’s? Wir sind also Kollegen, ja? Ich arbeite im Auftrag des Vaters.“
„Kollegen? Ich bewundere Ihre Offenheit.“ Die Überraschte blickt an Lieberstein herunter. Ein sportlicher Typ, gut erhalten, das muss man ihm lassen. Unwillkürlich stellt sich Martine gerade. „Es spricht durchaus für Sie, dass Sie das so schnell erkannt haben.“
Justus Lieberstein zuckt mit den Schultern. „Ach was, Sie hätten genauso schnell geschaltet, denk ich mir. Hat Ihnen Frau von der Aue nicht gesagt, dass ihr Ex-Mann ebenfalls einen Privatermittler engagiert?“
„Nein.“
„Sehen Sie! Männer sind doch die offeneren Menschen. Nicht so berechnend, nicht so vom Kalkül geprägt, stimmt’s? Verzeihen Sie, meine Mutter sagt das immer: Bei Frauen existieren nicht diese spießigen Kategorien Lüge und Wahrheit; es geht schließlich um den Nutzen. Sehen Sie, Hagen von der Aue hat mich sofort ins Vertrauen gezogen: Passen Sie auf, hat er zu mir gesagt, meine Ehemalige, die verdammte Hure, die wird auf der Stelle eine Ihrer entsetzlich akkuraten Kolleginnen aus Frankreich verpflichten.
„Entsetzlich akkurat –.“
„Allein schon, um noch mehr von meinem Geld ausgeben zu können.“
„Madame von der Aue geht einer selbstständigen Beschäftigung nach. Auf das Geld ihres ehemaligen Ehemanns ist sie meines Wissens ...“
„Sie glauben doch nicht, dass diese winzige Boutique genug für einen derartigen Lebensstil abwirft? Aber ich greife vor.“
Verärgert stemmt Martine die Hände gegen den Tresen. Doch bevor sie einen Disput vom Zaun brechen kann, schaltet sich ein Dritter ins Gespräch ein. Frédéric Orth, Chef der Caves de Cléebourg, kommt seinen Pflichten als Gastgeber schwungvoll nach:
„Darf es noch etwas sein, die Dame, der Herr? Haben Sie schon den Pinot Gris von der Confrérie probiert?“
„Oh ja! Ich meine: Oh nein!“ In der Sekunde richtet Lieberstein seine volle Aufmerksamkeit auf die verheißungsvolle Flûte in der Hand des obersten Winzers – und vergisst dabei vollständig, der Dame den Vortritt zu lassen. „Aber das passt ganz gut, denke ich. Eben hatte ich die Cuvée Prestige, von derselben Sorte.“
„Ah, dann ziehen wir vielleicht noch zwei andere vor, warten Sie ...“ Einem virtuosen Glasharfenspieler gleich streicht Orth mit der Rechten über die vielen, vielen Flaschenhälse in der Kühlung hin, bis er zwei Bouteillen herausgreift, eine „Huettgass“ und einen „Brandhof“. Liebersteins Glas erglüht abendgolden, als der konzentrierte Pinot Gris hineinfließt.