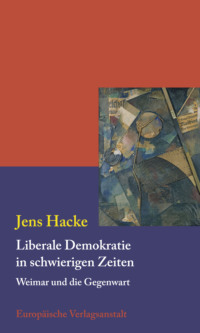Czytaj książkę: «Liberale Demokratie in schwierigen Zeiten»
Jens Hacke
Liberale Demokratie
in schwierigen Zeiten
Weimar und die Gegenwart

In Erinnerung an
Hans-Christoph Schröder (1933–2019)
E-Book (ePub)
© CEP Europäische Verlagsanstalt GmbH, Hamburg 2021
Alle Rechte vorbehalten.
Coverabbildung: Kurt Schwitters, »Merzbild 25 A. Das Sternenbild«,
bpk / Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf / Walter Klein
Covergestaltung: Christian Wöhrl, Hoisdorf
Signet: Dorothee Wallner nach Caspar Neher »Europa« (1945)
ePub:
ISBN 978-3-86393-574-0
Auch als gedrucktes Buch erhältlich:
© CEP Europäische Verlagsanstalt GmbH, Hamburg 2021
Print: ISBN 978-3-86393-111-7
Informationen zu unserem Verlagsprogramm finden Sie im Internet unter www.europaeischeverlagsanstalt.de
Inhalt
Einleitung: Weimar und die Gegenwart
Orientierungen
Das Wagnis der Demokratie
Der Liberalismus zwischen Erneuerung und Existenzkrise
Max Weber – Interpret der Moderne an der Schwelle zur Demokratie
Die Herausforderung des Autoritarismus
Selbsttäuschung aus Enttäuschung
Robert Michels’ Parteiensoziologie auf dem Weg von der Demokratie in den Faschismus
„Volksgemeinschaft der Gleichgesinnten“
Liberale Faschismusanalysen in den 1920er Jahren und die Ursprünge der Totalitarismustheorie
Carl Schmitt – Antiliberalismus, identitäre Demokratie und Weimarer Schwäche
Liberale Vernunft
Demokratischer Kapitalismus
Moritz Julius Bonns Defizitanalyse der wirtschaftlichen Ordnung in der Weimarer Republik
Ein Liberalismus der Ambivalenz
Überlegungen zu Thomas Manns politischem Denken
Probleme in Vergangenheit und Gegenwart
Stabilität durch „Wehrhaftigkeit“?
Karl Loewenstein und die Debatte um die gefährdete Demokratie
Die Fragilität der Demokratie
Zum Verhältnis von Recht und Politik in der Weimarer Republik
Krise der repräsentativen Demokratie – gestern und heute
Nationalismus und Liberalismus – eine komplizierte Beziehungsgeschichte
Anmerkungen
Literatur
Drucknachweise
Einleitung: Weimar und die Gegenwart
„Bonn ist nicht Weimar“ – diese sprichwörtlich gewordene Diagnose des Schweizer Publizisten Fritz Réné Allemann aus dem Jahr 1956 beinhaltete die Staatsräson der Bundesrepublik. Warum Weimar scheiterte und was den Nationalsozialismus an die Macht brachte, diese Fragen gehörten zum Selbstverständnis einer Nachkriegsdemokratie, die aus der Geschichte gelernt hatte. Mit jedem Jahrzehnt rückte die Zwischenkriegsepoche mit ihren politischen Extremen ferner: Radikalnationalismus, Rassismus, Antisemitismus, Antiliberalismus, Irrationalismus und Gemeinschaftssehnsucht – diese Verirrungen konnten mit Verweis auf bewegte Zeiten, die psychosozialen Folgen des Krieges und die Verzweiflung angesichts des ökonomischen Zusammenbruchs erklärt werden. Alles sehr weit weg. Lange schienen die Lektionen aus der Geschichte verinnerlicht, und die Welt der (Ur)Großeltern lieferte den Rahmen für schaurige Historienfilme, ähnlich fremd wie das Mittelalter.
In der letzten Zeit hat sich die gefühlte Überlegenheit der Nachgeborenen verflüchtigt. Wenn vom Aufschwung des Rechtspopulismus und von der Krise der Demokratie die Rede ist, sind die 1920/30er Jahre wieder bedrohlich nahe an die Gegenwart herangerückt. „Nächste Ausfahrt Weimar?“, fragte nach den Ereignissen von Chemnitz im Spätsommer 2018 Albrecht von Lucke, einer der führenden Publizisten der Republik. Die Kooperation bürgerlicher Parteien mit der AfD im Thüringer Landtag, um Anfang Februar 2020 die Wahl des FDP-Fraktionsvorsitzenden Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu bewerkstelligen, weckte vielfach Weimar-Assoziationen. Der renommierte Historiker Timothy Snyder diagnostiziert ein Revival faschistischer Ideologie, in Russland, aber auch in den USA, und sieht die westliche Welt auf dem Weg in die Unfreiheit. Politikwissenschaftler sinnieren darüber, wie Demokratien scheitern und zerfallen. So sehr sich die historischen Umstände nach neun Jahrzehnten unterscheiden, so sensibel registrieren die Ideenhistoriker ihre Déja-vu-Erlebnisse. In der Tat reaktivieren die nationalistischen Homogenitätsfantasien europäischer Populisten das Vokabular von Rechtsintellektuellen wie Carl Schmitt. Ressentiment und Aggression richten sich gegen das Fremde und gegen diejenigen, die für Pluralität, Toleranz und kulturelle Vielfalt eintreten. Schuld an allem sind die Liberalen, damals wie heute.
Beschleunigter Fortschritt, sozialer Wandel, internationale Krisen und ökonomische Ungewissheit machen Demokratien erneut anfällig für den Irrationalismus. Statt komplizierter Problembewältigung will man einfache Lösungen, statt mühsamer Kompromisssuche herrscht die Sehnsucht nach Führung von oben, statt Möglichkeiten für das politische Engagement wahrzunehmen, erklärt man die politische Elite zum Sündenbock.
Zutiefst irritierend ist allerdings, dass uns kein adäquater Krisenbegriff zur Verfügung steht, der uns hilft, die gegenwärtige Situation zu verstehen. Sozioökonomisch war in Deutschland vor Corona keine größere Not erkennbar als in früheren Jahren. Im Gegenteil: Die Wirtschaft boomte, die Arbeitslosigkeit bewegte sich auf einem historischen Tiefstand, und Haushaltsüberschüsse boten politische Handlungs- und Verteilungsspielräume wie niemals zuvor. Trotzdem erreichte die Unzufriedenheit mit der liberalen Demokratie in der Bundesrepublik ein bislang ungekanntes Ausmaß.
Das Misstrauen in das politische System zeigt sich am Erfolg der Rechtspopulisten überdeutlich. Ihnen gelingt es, als reine Protestparteien, Ablehnung und Unzufriedenheit zu bündeln, ohne auch nur den Ansatz einer tragfähigen politischen Programmatik erkennen zu lassen. Als die AfD Mitte 2015 vor dem Sturz in die politische Bedeutungslosigkeit stand, sicherte sie sich durch die monothematische Instrumentalisierung der Flüchtlingsfrage ihr vorläufiges Überleben. Allerdings wäre es zu kurz gegriffen, lediglich die Rechtspopulisten zu dämonisieren und nicht nach den Schwächen der etablierten Parteien zu fragen.
Die Krise wurzelt mithin in tieferen Ursachen und kollektiven Projektionen, in Statusverlustängsten und im Gefühl bestimmter Bevölkerungsgruppen, benachteiligt zu sein. Dabei verweist die Abkehr von der liberalen Demokratie auf drei Defizite, die oberflächliche Strukturähnlichkeiten zur Weimarer Lage aufweisen. Erstens werden die Leistungsfähigkeit und die demokratische Legitimation der parlamentarisch-repräsentativen Regierungsweise generell in Frage gestellt. Zweitens traut man der liberalen Demokratie nicht mehr zu, hinreichend für gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sorgen und Antworten auf Sinnfragen zu finden. Drittens gibt es einen Vorbehalt gegenüber den Verteilungsungerechtigkeiten einer kapitalistischen Ordnung; auch die Wendung gegen Asylsuchende und Flüchtlinge ist dafür ein Zeichen, denn sie vollzieht sich in der Regel mit dem Hinweis darauf, dass sich ein Anrecht auf Unterstützung auf Staatsbürger*innen beschränken sollte. Dieser Umstand kennzeichnet eine Leerstelle: Soziale Gerechtigkeit und prekäre Lebensumstände werden weder zureichend problematisiert noch Gegenstand politischer Auseinandersetzung.
Sicher, Geschichte wiederholt sich nicht. Kriegsfolgen, Inflation und Weltwirtschaftskrise sorgten in Weimar für ein schwer vergleichbares, überhitztes politisches Klima. Die soziale Not war real, die ideologischen Kämpfe waren existenziell. Dennoch klingen die damaligen Krisendebatten auf unheimliche Weise vertraut. Das Aufkommen einer radikalen Rechten, welche die Massen mobilisierte, hielt man nach dem Untergang der Monarchie für ebenso unwahrscheinlich wie heute Trumps Präsidentschaft oder eine AfD auf dem Rang der drittstärksten, in vielen Bundesländern auf dem der zweitstärksten Partei. Und dem globalen Finanzkapitalismus kann man gegenwärtig kaum mehr vertrauen als in der Ära der verheerendsten Weltwirtschaftskrise.
Der große Nationalökonom und liberale Intellektuelle Moritz Julius Bonn (1873–1965) diagnostizierte bereits im Jahr 1925 eine „Krisis der europäischen Demokratie“. Sein gleichnamiges Buch liest sich in weiten Teilen wie eine Bestandsaufnahme zur Gegenwart. Als Reaktion auf Modernisierungsprozesse beobachtete er einen ressentimentgeladenen Nationalismus, der sich gegen Minderheiten wandte und eine Politik der Ausgrenzung praktizierte. Nationalisten und Faschisten attackierten die zarten Anfänge internationaler Kooperation im Völkerbund und die ersten europäischen Versöhnungsinitiativen vehement. In Benito Mussolini sah Bonn den Vorboten einer pseudodemokratischen Regierungsweise, bei der sich die Mitwirkung des Volkes auf die plebiszitäre Legitimation von bereits vollzogenen Maßnahmen beschränkte. Die faschistische und später nationalsozialistische Propaganda zielte darauf ab, das Volk als homogene Masse im Führerwillen aufgehen zu lassen. Eine klare Absage an Gewaltenteilung, Pluralismus und Rechtsstaat.
Wie andere Weimarer Demokraten sorgte sich Bonn um die junge Republik, die sich noch nicht auf einen eingeübten Verfassungspatriotismus und eine bewährte demokratische Kultur stützen konnte. Bonn wusste, dass die Stabilität der liberalen Demokratie von ihrer Leistungsfähigkeit abhing. Gute demokratische Regierung musste allen Bürgerinnen und Bürgern Anteil am Gemeinwohl bieten – das hieß vor allem soziale Sicherheit und klassenübergreifende Prosperität. Dabei sollte der Bürger aber nicht auf die Rolle des Konsumenten reduziert werden. Das Ideal einer bürgerlichen Selbstregierung verlangte nach Partizipation und Einsatz für das Gemeinwesen.
Kluge Staatsrechtler wie Hans Kelsen, Hermann Heller oder Richard Thoma realisierten, dass politischer Irrationalismus und Faschismus kein Schicksal waren, sondern strukturelle Ursachen hatten. Sie erkannten, dass sich die liberale Demokratie schwer damit tat, die Herzen der Bürgerinnen und Bürger zu gewinnen. Demokratisches Bewusstsein benötigt Überzeugung, den Glauben an gemeinsame Ziele und kann nur durch eine republikanische Erziehung gewährleistet werden. Trotz aller Schwierigkeiten sahen sie in der demokratischen Regierungsweise die aussichtsreichste Form, hinreichend für soziale Integration zu sorgen. Funktionierende demokratische Gemeinwesen setzen eine zufriedene gesellschaftliche Mitte voraus – und es ist Aufgabe der Politik, durch aktive Wirtschafts- und Sozialpolitik für Lebenschancen aller Schichten zu sorgen.
Diese Herausforderungen waren damals neu, denn der Wohlfahrtsstaat steckte in den Kinderschuhen. Unter dem Leitbegriff der sozialen Demokratie suchten moderne Liberale und Sozialdemokraten nach Formen und Methoden, um den krisenanfälligen Kapitalismus einzuhegen. Die Marktwirtschaft musste demokratisch werden, das heißt: der Allgemeinheit Vorteile bringen, mehr Arbeitnehmerrechte und betriebliche Mitbestimmung zulassen. Das Wirtschaftsleben war ohne politische Regulierung undenkbar geworden. Moritz Julius Bonn, Verfechter eines demokratischen Kapitalismus, richtete seine Kritik nicht gegen die Forderungen der Arbeiterbewegung, sondern gegen Unternehmereliten, die ihrer gesellschaftlichen und politischen Verantwortung in der Demokratie nicht gerecht wurden. Ihnen warf Bonn vor, die Gewinne zu privatisieren und die Verluste zu sozialisieren, ohne sich um die gesellschaftliche Balance zu scheren. Auch diese Kritik bleibt aktuell. Wie damals geht es heute darum, die Dynamik der Wirtschaft politisch auszubalancieren und sozial abzufedern. Neben der notwendigen Gewährung von Aufstiegschancen für alle Bevölkerungsteile sind allerdings heute ökologische Verantwortung und globale Gerechtigkeitserwägungen als neue Faktoren hinzugetreten.
Als Zeitzeugen von Bolschewismus und Faschismus entwickelten Liberale bereits Mitte der Zwanzigerjahre eine Vorform der Totalitarismustheorie, mit der sich die politischen Extreme in Ideologie und Praxis verstehen ließen. Die Gegner einer rechtsstaatlich-demokratischen Ordnung formierten sich damals ähnlich schnell und unvorhergesehen wie in der Gegenwart. Ihre Militanz war unübersehbar. Überzeugte Republikaner diskutierten deshalb frühzeitig über die Gestaltung einer wehrhaften Demokratie. Dass sie politisch keinen Widerhall fanden, ist ihnen nicht anzulasten. Aber nach 1945 kehrten ihre Ideen zurück ins Nachkriegsdeutschland und formten den Konsensliberalismus im Kalten Krieg.
Es bleibt daran zu erinnern, dass politische Denker Neuland betraten, als sie damals egalitäre Massendemokratie und liberale Freiheitswerte zusammen dachten. 1918 war die Geburtsstunde der liberalen Demokratie, nicht nur in Deutschland, sondern in weiten Teilen der atlantischen Welt, denn das freie und gleiche Wahlrecht, auch für Frauen, setzte sich erst jetzt, nach und nach durch – in Großbritannien 1928 und in Frankreich noch später, nämlich 1944. Heute wird uns klar, dass die liberale Demokratie keinem determinierten Entwicklungsgang entsprungen ist. Sie beruht auf hart erkämpften Kompromissen zwischen bürgerlichem Liberalismus und Sozialdemokratie. Die einen mussten soziale und politische Gerechtigkeitsforderungen anerkennen, die anderen die Unhintergehbarkeit des Rechtsstaates und der individuellen Freiheit.
Im Rückblick auf das 20. Jahrhundert lässt sich konstatieren, dass die Demokratie nie Ausgangspunkt war, sondern fast immer zuletzt kam, also auf der vorherigen Verankerung liberaler Ideen aufbaute. Anders ausgedrückt: Nur als liberale Demokratie hatte sie bislang Chancen auf Stabilisierung und Dauerhaftigkeit. Das sollte man auch in Erinnerung behalten, wenn Rechtspopulisten das Hohelied auf die „illiberale Demokratie“ singen. Damals wie heute bekämpft der Antiliberalismus die Demokratie als Lebensform, die von Pluralität, kultureller Buntheit und individuellen Entfaltungsräumen geprägt sein soll. Feminismus, Sexualmoral, alternative Lebensstile gehören nach wie vor zu den Angriffszielen, aus denen sich die rückwärtsgewandte rechtsnationale Programmatik nährt. Fremdenhass, Antisemitismus, Verschwörungstheorien und dumpfer Geschichtsrevisionismus haben sich kaum gewandelt.
Natürlich reicht allein das Glaubensbekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung kaum aus. Sie ist ein fragiles Gut, und unsere Demokratie wäre nicht in gefährdeter Lage, wenn sie keine Schuld an ihrem derzeitigen Zustand trüge. Das Register der Fehlentwicklungen ist lang: die Technokratie der Europäischen Union, die neoliberale Inkaufnahme wachsender sozialer Ungleichheit, der fehlende Mut zum Entwurf des guten Lebens in einer künftigen ökologisch verantwortlichen Gesellschaft, die verspäteten Anstrengungen sozialer und politischer Integration von Zuwanderern, die Versäumnisse in der Prävention und Steuerung globaler Migration.
Die Stärke der liberalen Demokratie liegt darin, dass sie verbesserungs- und lernfähig ist. Garantien für ihren Bestand gibt es nicht. Die Einsichten der Weimarer Denker bleiben aktuell, weil sie die Existenzkrise der Demokratie durchdachten. Bei ihnen ging es ums Ganze, und sie erinnern uns daran, wie voraussetzungsreich das Projekt der liberalen Demokratie bis heute tatsächlich ist. Daraus lässt sich Kraft schöpfen, wenn man sich vergegenwärtigt, wie viel besser die gegenwärtige Lage und wie viel kreativer Spielraum für demokratische Politik eigentlich vorhanden ist. Demokratie war in Weimar und ist auch im 21. Jahrhundert ein Versprechen auf die Zukunft, getragen von Hoffnungen auf Verbesserung, mit dem Blick für Fehlentwicklungen und im Streit um Alternativen. Nötig bleibt der Mut, die demokratische Gesellschaft weiterzuentwickeln, lebenswerter zu machen und dabei die Freiheit entschlossen zu schützen.
In diesem Sinne handeln die hier versammelten Beiträge von der Idee der Demokratie, die sich in Krisenzeiten auf ihren Kern zurückbesinnt und gleichzeitig nicht aufhört, eine bessere Zukunft zu entwerfen. Zwar verbinden wir die liberale Demokratie stets mit grundlegenden Wertvorstellungen wie Freiheit, Gleichheit, Selbstbestimmung, Toleranz, Pluralität, Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit. Doch die Ausgestaltung dieser Werte in der konkreten lebensweltlichen Praxis – die Prägung der Demokratie als Lebensform – verändert sich. Entscheidend bleibt das Gleichheits- und Gerechtigkeitsversprechen der Demokratie, denn die Ermöglichung von Chancen und die Emanzipation der Benachteiligten sind die Motivationsressourcen für demokratische Gesellschaften, die sensibel ihre Wahrnehmung für Unrecht und Diskriminierung schärfen müssen. Die Auseinandersetzung mit den liberalen Demokraten der Weimarer Republik kann dabei helfen.
Die vorgelegten Studien sind ideengeschichtlich ausgerichtet. Ihr Fluchtpunkt bleibt in vielerlei Hinsicht die Gegenwart, aber sie folgen dem Ansatz, dass die Beschäftigung mit politischen Ideen sowohl den historischen Abstand als auch eventuelle Strukturanalogien heutiger Krisenreflexion verdeutlichen muss. In der Mehrzahl sind die Texte nach der Publikation meines Buches Existenzkrise der Demokratie entstanden, um einzelne Aspekte zu vertiefen und noch einmal neu zu belichten. Ich danke Irmela und Axel Rütters für die Initiative zu diesem Buch und für den fruchtbaren Ideenaustausch der letzten Jahre. Christoph Claussen danke ich sehr für die kritische und genaue Durchsicht des Textes, meiner Schwester Vera Hacke für einen gewohnt akribischen abschließenden Korrekturgang, den sie trotz ihrer eigenen Verpflichtungen auf sich nahm.
Gewidmet ist dieser Band dem Andenken Hans-Christoph Schröders, einem großartigen Historiker und warmherzigen Freund über zwei Jahrzehnte.
Orientierungen
Das Wagnis der Demokratie
Der Liberalismus zwischen Erneuerung und Existenzkrise
Will man die Novemberrevolution in Deutschland angemessen begreifen, so verdienen die Hoffnungen und Erwartungen der Zeitgenossen besondere Aufmerksamkeit. Wahrscheinlich gab es wenige Momente in der deutschen Geschichte, in denen optimistischer Aufbruch und Resignation eine derart spannungsvolle Melange eingingen wie in der Gründungsphase der Weimarer Republik. Dies galt vor allem für das sehr heterogene Lager des politischen und intellektuellen Liberalismus.
Der Historiker hat es mit der Evaluation von Handlungsspielräumen und Alternativen zu tun, und sicherlich wäre in politischer Hinsicht vielerlei über verspielte Chancen und verpasste Möglichkeiten zu sagen. Natürlich liegt es nahe, hier eine Geschichte des Versagens liberaler Politik zu erzählen. Sie ist hinreichend bekannt: Wir haben es uns angewöhnt, Weimars Ende mit der Erosion der bürgerlichen Mitte und dem politischen und geistigen Niedergang des Liberalismus zu verknüpfen.1
Aber in den letzten Jahren hat sich eine Perspektivverschiebung ergeben. Die erste deutsche Demokratie wird nicht mehr allein als Geschichte des Scheiterns erkundet, sondern die Errungenschaften, die Entwicklungsmöglichkeiten und die mit ihr verbundenen Neuanfänge werden stärker ins Blickfeld gerückt.2 Oder, um es anders zu wenden: Es war nicht selbstverständlich, dass trotz vielfältiger Belastungen überhaupt eine demokratische Ordnung entstehen konnte.
Arnold Brecht, ein republikanischer Ministerialbeamter und späterer Politikwissenschaftler, hat diesen Blickwechsel schon viel früher gefordert: „Das eigentlich Erstaunliche“, bemerkte Brecht zur Gründungsphase Weimars in seinen Memoiren, „ist nicht, daß dreizehn Jahre später die demokratische Verfassung in Deutschland zusammenbrach, sondern daß das nicht schon viel eher geschah.“ Statt nach Sündenböcken zu suchen, wäre es logischer, sich zu vergegenwärtigen, „welche Ereignisse und Personen dazu beigetragen haben, daß die demokratische Republik trotz des Widerspruchs zwischen den Spielregeln und den tatsächlichen Mehrheitsverhältnissen so lange funktionieren konnte“.3
Wir haben es also mit einer komplizierten Gemengelage zu tun: Vor dem Hintergrund der alsbald schwindenden Unterstützung für die Weimarer Koalition, ist die Verfassungsschöpfung aus der Revolution und die vorübergehende Stabilisierung innerhalb massiver Krisen außenpolitischer, innenpolitischer und ökonomischer Art das erklärungsbedürftige Faszinosum. Überhaupt gilt es daran zu erinnern, dass das liberale Momentum der Republikgründung zunächst gar nicht absehbar war. Immerhin war es die politische Linke, die im Rat der Volksbeauftragten und auf der Straße die Novemberrevolution prägte, während sich die bürgerliche Mitte erst einmal in der Defensive befand.
Insofern erscheint es gerechtfertigt, sich mit den Chancen, dem Neuen und auch den Wagnissen derer zu beschäftigen, die wir zum Kreis der Liberalen zählen können. Dabei werde ich den Liberalismus aus ideengeschichtlicher Perspektive behandeln und die politische Ereignisgeschichte und die komplexe Transformationsgeschichte der liberalen Parteien eher vernachlässigen.
Ich möchte dabei in vier Schritten vorgehen: Zunächst will ich versuchen zu erläutern, in welcher Weise wir überhaupt von Liberalismus als einem Sammelbegriff in der Novemberrevolution sprechen können; in einem zweiten Abschnitt möchte ich mich dann mit dem besonderen Spannungsverhältnis zwischen Liberalismus und Demokratie beschäftigen, um Weimar als Durchbruchphase zur liberalen Demokratie – etwas bis dato Neues – begreifen zu können. Drittens möchte ich auf den parteipolitischen Neuanfang unter „massendemokratischen“ Bedingungen eingehen, der in vielerlei Hinsicht revolutionär war, auch wenn der echte Aufbruch nur ein knappes Jahr dauerte. Viertens sollen aus ideengeschichtlicher Perspektive die langfristigen Innovationen des demokratischen Liberalismus in Weimar verdeutlicht werden, um am Ende zu einem knappen Fazit zu kommen.
1. Zum Begriff des Liberalismus
Es ist unmöglich, einen klar definierten Liberalismusbegriff zu präsentieren. Meiner Ansicht nach gibt es drei Möglichkeiten:
Man nimmt erstens die Selbst- und Fremdbezeichnung der Zeitgenossen ernst und bezieht jeden, der von sich oder anderen als liberal bezeichnet wird, in die Untersuchung ein. Ein solches Vorgehen ist mit dem Problem konfrontiert, dass sich im Revolutionsjahr kaum jemand als liberal exponierte; der Begriff war verbrannt, galt als Relikt des 19. Jahrhunderts und gehörte gewissermaßen zu einer im Weltkrieg untergegangenen Epoche.
Zweitens könnten wir uns den Parteien zuwenden, die nach allgemeinem Verständnis dem liberal-bürgerlichen Lager zugerechnet wurden (und bekanntlich auch nicht das Wort liberal im Namen trugen). Dies würde den Blickwinkel allerdings politisch einengen, denn der Liberalismus war stets eine unübersichtliche „Familie von Ideen und Verhaltensmustern“ (Sheehan), von Netzwerken und Gruppierungen.4 Es gehört zu seiner Eigenheit, dass er als Ensemble von Ideen und Überzeugungen in viele Richtungen diffundierte.
Dies führt uns drittens zu dem Problem, im Liberalismus so etwas wie einen überzeitlichen ideellen oder normativen Kern auszumachen. Auch dies scheint schwer möglich. Ein Blick auf den Theoretiker, der allgemein als wichtigster Repräsentant des Liberalismus gesehen wird, nämlich Max Weber, mag das illustrieren.5 Es gibt wichtige Argumente – und ich werde sie gleich vertreten –, Weber als entscheidenden Vordenker der liberalen Demokratie zu würdigen. Aber genauso gut kann man die Auffassung haben, dass an gewissen Wertüberzeugungen gemessen Weber nach heutigen Maßstäben (und wohl auch schon in den Augen anders gepolter liberaler Zeitgenossen) weit entfernt von gängigen liberalen Vorstellungen war: Weder vergötterte er den freien Markt noch war er ein Anwalt internationaler friedlicher Völkerverständigung; auch der Schutzraum des Einzelnen vor dem Staat interessierte ihn nicht besonders – und einen Fortschrittsoptimisten wird man ihn auch nicht nennen wollen, denn zu düster war sein Blick auf ‚das stahlharte Gehäuse der Hörigkeit‘, welches das moderne Individuum einenge.6 Insofern kann es im Folgenden nicht darum gehen, eine Gesamtschau des Liberalismus mit allen Licht- und Schattenseiten zu geben, sondern ich möchte einige Linien herausarbeiten, die in konstruktiver Absicht die im Entstehen begriffene liberale Demokratie konturierten.7
2. Liberalismus und Demokratie
Der englische Journalist Edmund Fawcett hat in seiner Ideengeschichte des Liberalismus noch einmal daran erinnert, dass der Kompromiss zwischen Liberalismus und Demokratie, die Kombination von Freiheits- und Bürgerrechten und demokratischer Regierungsform (begleitet vom Ringen um eine sozialverträgliche Ökonomie) hart erkämpft und historisch keineswegs zwangsläufig war.8 Ideengeschichtlich ist es ironisch, dass just in dem Moment, da Carl Schmitt die Unverträglichkeit von Parlamentarismus und Demokratie beweisen wollte, progressive Liberale von Max Weber über Hugo Preuß bis zu jüngeren wie Hans Kelsen oder Moritz Julius Bonn die repräsentative Regierungsform als einzig mögliche Realisierung der modernen Demokratie verteidigten.
Das ist nicht als Ergebnis eines durch Kriegsniederlage erzwungenen Vernunftrepublikanismus aufzufassen. Schon die Demokratisierungsdebatte während des Ersten Weltkriegs bereitete den Boden für Späteres, denn Deutschlands liberale Intellektuelle stritten in dieser Zeit vehement für Parlamentarisierung und politische Mitbestimmung.9 Auf drei Weltkriegsschriften möchte ich kurz verweisen: Hugo Preuß’ Das deutsche Volk und die Politik aus dem Jahr 1915, Max Webers Artikelserie in der Frankfurter Zeitung zu Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland aus dem Sommer 1917 und die etwas unbekanntere Schrift von Leopold von Wiese über den Liberalismus in Vergangenheit und Gegenwart, ebenfalls 1917 erschienen.
Preuß war einer der wenigen, die sich nach dem Kriegsausbruch 1914 nicht vom nationalen Überschwang anstecken ließen. Bereits im Frühjahr 1915 veröffentlichte er seine viel diskutierte Stellungnahme, die sich in großer Distanz zu den „Ideen von 1914“ befand.10 Seine massive Kritik am wilhelminischen Obrigkeitsstaat verband er mit einem Plädoyer für den „Volksstaat“. Dieser Begriff war nichts anderes als das Synonym für eine Demokratie mit republikanischem Ethos. Preuß konzipierte den Staat als „Wir-Gemeinschaft“, die sich von einem Untertanenvolk zu einem positiv politisierten Staatsvolk wandeln sollte.
Mit Sorge hatte er die „Verachtung des Liberalismus“ als Zeittendenz registriert, was allerdings dazu führte, dass auch er selbst den Begriff mied. Inhaltlich hielt er jedoch daran fest, für eine Politik der bürgerlichen Selbstorganisation zu werben. Preuß wusste, wovon er sprach, denn er hatte sich als sozialliberaler Berliner Kommunalpolitiker einen Namen gemacht; anders als den Vertretern einer liberalen Orthodoxie war ihm völlig klar, dass der Staat die zentrale politische Steuerungsinstitution war, die man mit demokratischen Mitteln handhaben musste. Wichtiger als Freiheit vom Staat war die verantwortliche Gestaltung sozialer Politik. Wenn man sich in Erinnerung ruft, dass die Weimarer Verfassung, die zu ihrer Zeit als freieste Verfassung der Welt galt, ganz wesentlich auf seinem Entwurf beruhte, dann bekommt man einen Eindruck von Preuß‘ intellektueller Statur.
Zum zweiten möchte ich an den heute weithin vergessenen Soziologen Leopold von Wiese erinnern, den der sozialdemokratische Staatsrechtler Hermann Heller noch in den 1920er Jahren zu den wichtigsten Vordenkern des „Neoliberalismus“ zählte – und Heller meinte mit Neoliberalismus natürlich nur einen „neuen Liberalismus“.11 Wieses Buch Liberalismus in Vergangenheit und Zukunft war 1917 im renommierten S. Fischer Verlag erschienen.12 Wiese wagte eine entschlossene begriffspolitische Aneignung des Liberalismus, indem er nicht nur an das normative Wertegerüst, sondern auch an die Fähigkeit des Liberalismus erinnerte, reflexiv zu lernen, sich immer wieder zu erneuern, um sich an veränderte Problemlagen anzupassen. Er wehrte sich vehement dagegen, mit dem Krieg die zivilisatorischen Werte der bürgerlich liberalen Welt zu verabschieden. Gegen den Strom bürgerlicher Kriegsbegeisterung hatte er bereits 1915 seine Gedanken über Menschlichkeit veröffentlicht.13 Menschenwürde, persönliche Freiheit, bürgerliche Selbstverwaltung, aber auch das Eintreten für eine pluralistische offene Gesellschaft bestimmen seine liberale Haltung.
Max Webers Forderung nach Demokratisierung im Weltkrieg – für ihn gleichgesetzt mit Parlamentarisierung – ist allgemein bekannt. Es ist auch wahr, dass Weber dazu keine normative Demokratietheorie brauchte. Aber seine „realistische“ politische Theorie führte liberalen Theorieskeptikern vor Augen, wie aussichtslos es war, sich gegen das Schicksal der Massendemokratie zu stellen. Er machte sich keine Illusionen darüber, dass die Gewährung der Demokratie ohnehin zum grand bargain gehörte, den der Liberalismus an die gesellschaftliche Modernisierung zu entrichten hatte. Nach dem Weltkrieg konnte man den rückkehrenden Soldaten, aber auch den Frauen an der Heimatfront die politischen Partizipationsrechte nicht mehr verwehren. Weber ging allerdings weiterhin davon aus, dass – wie ihn das Vorbild der Vereinigten Staaten lehrte – der entscheidende politische Einfluss bei den Besitz- und Bildungseliten blieb. Auch deshalb bedeutete für ihn das freie und gleiche Wahlrecht eine notwendige Kompensationsleistung: so würde die Masse zumindest im Wahlakt symbolisch gleichgestellt.14 Bedeutsam blieb auch Webers Einsicht, dass Demokratie nur als parlamentarische Parteiendemokratie vorstellbar war.