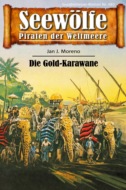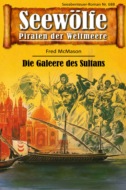Czytaj książkę: «Seewölfe - Piraten der Weltmeere 693»
Impressum
© 1976/2020 Pabel-Moewig Verlag KG,
Pabel ebook, Rastatt.
ISBN: 978-3-96688-115-9
Internet: www.vpm.de und E-Mail: info@vpm.de
Jan J. Moreno
Rache
Sie töten lautlos
Die portugiesische Karavelle „Cabo Mondego“ sank schnell.
Die tobende Feuersbrunst hatte die achtere Pulverkammer erreicht, und das Heck war von einer gewaltigen Explosion aufgerissen worden. Kurze Zeit später kündeten nur noch aufschwimmende Wrackteile vom Schicksal des Schiffes.
Schwerer Qualm hatte sich wie ein riesiger Pilz über der nördlich von Madras liegenden Bucht ausgebreitet – ein weithin sichtbares Mahnmal, das die von Bord geflohenen Portugiesen von der Rückkehr abhielt. Gegen die Soldaten des Sultans von Golkonda hatten sie keine Chance. Wenn sie überleben wollten, mußten sie dem Dschungel Südostindiens trotzen. Jede Stunde, die sie länger der dampfenden grünen Hölle widerstanden, ließ ihren Ruf nach Rache wachsen …
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Die Hauptpersonen des Romans:
Luis de Xira – nachdem seine „Cabo Mondego“ versenkt wurde, hat er nur noch einen Wunsch – den der Rache.
Drawida Shastri – der falsche Sultan ist für üble Tricks immer gut, außerdem sinnt auch er auf Rache.
Waruna Tschittanga – weiht sein Leben den Göttern, nachdem ein Blitzlicht seine Augen geblendet hat.
Bill – verliebt sich in Warunas Schwester Sumangalã und muß erkennen, daß sie aus zweierlei Welten stammen.
Philip Hasard Killigrew – hat seiner Crew Ruhe und Entspannung verordnet, ohne zu ahnen, was auf sie alle zukommt.
1.
Der Ruf des Morgenvogels weckte ihn. Eine Weile lag der junge Khande Rao noch mit geschlossenen Augen auf seinem Lager aus Stroh und lauschte dem melodischen Gesang, bevor er sich erhob und zum Fenster ging. Der Tag war noch jung, die ersten Sonnenstrahlen stiegen soeben jenseits des Dschungels empor.
Dunkel und geheimnisvoll toste der Fluß durch das enge Tal. Er stürzte nur einen kurzen Fußmarsch entfernt in schäumenden Kaskaden über glattgeschliffene Felsen in die Tiefe. Sobald die Sonne in voller Größe über dem Wald stand, würde der Fluß zu einem gleißenden Lichtermeer werden.
Khande Rao stand lange regungslos am Fenster und genoß die kühle, reine Morgenluft. Er sah zu, wie die Dämmerung die Schatten der Nacht verdrängte und die Helligkeit des Tages schließlich Sieger blieb. Aber er wußte auch, daß die Nacht wiederkehren würde. Er hatte gelernt, daß dieser stete Wechsel wie der wohl immerwährende Kampf zwischen Gut und Böse war, zwischen Göttern und Dämonen.
Das Geräusch leiser, schlurfender Schritte schreckte ihn aus seinen Überlegungen. Der alte Raghubir schritt den steinigen Weg vom Ufer herauf, um seine prächtig gedeihenden Blumen zu gießen. Sie verliehen den Terrassen entlang der Böschung einen Hauch unvergänglicher Schönheit.
Khande bewunderte den alten Brahmanen, den schon der Vater seines Vaters gekannt hatte. Der weißhaarige Raghubir schleppte einen prall gefüllten Wasserschlauch, ein Gewicht, das sogar jüngere Männer in die Knie gezwungen hätte.
Als er das Wasser versprüht hatte und wieder zum Fluß zurückwollte, hastete ein Mistträger die ausgetretenen, engen Stufen hinauf. Er balancierte zwei Eimer an einer Spange auf der Schulter und schien helfen zu wollen.
Khande Rao konnte nicht verstehen, was die beiden Männer miteinander sprachen, doch er erkannte, daß der Greis den anderen schroff zurückwies. Der Mistträger indes ließ sich nicht vertreiben.
Raghubir packte zu und wollte den Diener die Stufen hinunterstoßen, doch der war flink und krallte sich in seinem Gewand fest. Zeternd schlug der Alte um sich.
Beide gerieten an den Rand der Terrasse, die schmal und hoch war. Der Morgennebel hatte die geschliffenen Steine glitschig werden lassen. Als Raghubir den Mistträger trat, glitt dieser aus und stürzte in die Tiefe, wo er regungslos liegenblieb.
Der Greis schien selbst erschrocken über sein Tun. Ängstlich blickte er sich um.
Blitzschnell huschte Khande Rao vom Fenster zurück, weil er nicht entdeckt werden wollte. Sein Vater hatte ihn gelehrt, gütig zu sein, nachgiebig und hilfsbereit. Aber nun hatte er gesehen, wie ein Brahmane die Hand gegen einen Diener erhob, um zu töten.
Übelkeit stieg in ihm hoch. Er fror plötzlich, und sein Herz pochte wild in der Brust. Trotzdem beugte er sich wieder vor, weil er sehen wollte, was geschah.
Raghubir war die Stufen hinuntergeeilt. Der Mistträger lag regungslos da, die Beine ausgebreitet und die Arme wie schützend über den Kopf erhoben.
Khande Rao, in seiner kindlichen Neugier, konnte das Gesicht des Alten deutlich erkennen. Der Greis schwitzte. Die Furcht, entdeckt zu werden, spiegelte sich in seinen Zügen. Ohne länger zu zögern, nahm er den Toten bei den Füßen und zerrte ihn den Hang hinunter bis an das Ufer des reißenden Flusses. Dann holte er die Eimer, legte sie neben den Diener und verschwand zwischen den Bäumen.
Khande stand wie versteinert. Unfähig, wirklich zu begreifen, starrte er hinunter auf die Terrasse. Er hatte einen Diener sterben sehen, was gewiß nicht weltbewegend war, aber durch die Hand eines Brahmanen, der im Dorf als heiliger Mann galt. Und dieser „Heilige“ schlich wie ein Dieb davon.
Wie konnte jemand dem Guten das Wort reden und zugleich eine solche Tat begehen?
Irgend etwas zerbrach in diesem Moment in ihm. Er trat vom Fenster zurück und ließ sich auf seine Schlafstatt sinken.
Eine flüsternde Stimme redete ihm ein, daß vieles anders war, als er bislang geglaubt hatte. Nicht die Liebe hatte Bestand in dieser Welt – sie war lediglich von kurzer Dauer. Einzig das Böse schien mächtig genug, alles zu überdauern.
Trotz seiner Jugend gelangte er zu der Erkenntnis, daß es besser sei, über das Geschehene zu schweigen.
Die Sonne war inzwischen zwei Handbreiten höher gestiegen. Ihre Strahlen tasteten durch den Raum und ließen den Staub flimmern, als von draußen her Geschrei laut wurde.
„Ein Toter liegt am Fluß!“ vernahm der Knabe.
Eine andere Stimme rief: „Er ist ausgeglitten und zu Tode gestürzt!“
Unter Hunderten hätte Khande diese Stimme erkannt. Sie gehörte Raghubir, dem weisen, heiligen Mann.
Noch ehe sich die Sonne dem Abend zuneigte, war ein Scheiterhaufen aus dürrem Reisig aufgeschichtet. Der Leichnam wurde aufgebahrt. Seine Eimer lagen neben ihm und ebenso das Rundholz, das er zum Tragen benutzt hatte.
Vom Fenster aus sah Khande Rao die hoch auflodernden Flammen, und das Herz krampfte sich ihm zusammen.
Etliche Monate vergingen, und der Herbst brachte reiche Ernte. Schwermütig blickte der Knabe den großen Vogelschwärmen nach.
Nicht nur die Abende wurden kürzer, auch die Nebel stiegen wieder vom Fluß auf. Khande fand kaum mehr Ruhe. Immer häufiger vernahm er eine innere Stimme, die ihm die eigene Vergänglichkeit vor Augen führte. Er schreckte nachts schweißgebadet auf und erinnerte sich, vom Tod des Dieners geträumt zu haben. Schlimmer wurde alles noch, weil er mit niemandem darüber sprach – selbst sein Vater hätte ihn nicht verstanden.
Er betete häufiger als sonst am Altar der Hausgottheit der im hinduistischen Glauben lebenden Familie. Sõma, den er verehrte, war seit uralter Zeit der König der Pflanzen und zugleich das Kraut, aus welchem zu Opferzwecken ein Unsterblichkeitstrank gebraut wurde. Bei den Göttern wurde dieser „Nektar“ in einem großen Gefäß aufbewahrt – im Mond. Bei der Familie Rao tat es ein mit Wachs versiegelter Tonkrug.
Erstmals spielte Khande mit dem blasphemischen Gedanken, das Siegel ein klein wenig zu beschädigen und etwas von dem Göttertrank auf seine Lippen zu träufeln. Er fürchtete sich unbewußt, auf ähnliche Weise zu sterben wie der Mistträger.
Ausgerechnet an diesem Morgen, nachdem er den Anruf der Hausgottheit beendet hatte und mit sich selbst haderte, schreckte ihn das Geräusch von Schritten auf. Im ersten Moment hätte er nicht zu sagen vermocht, ob das gleichmäßige Knirschen des hellen Kieses nur in seiner Einbildung entstand, oder ob tatsächlich jemand vor dem Haus vorüberging, zögernd, als warte er nur darauf, daß Khande zum Fenster eilte. Doch dann entschied sich Khande, daß da wirklich jemand war. Vielleicht einer seiner Freunde.
Das Fenster, ein mit Tierhaut bespannter Holzrahmen, stand offen. Er hörte nun ganz deutlich, daß sich die Schritte zum Rand jener Terrasse entfernten, auf der der Mistträger sein Leben verloren hatte.
Aufmerksam blickte Khande Rao hinaus.
Aus dem Nebel schienen sich die Umrisse eines Mannes zu verdichten. Zwei Eimer trug er über der Schulter.
Der Knabe wagte kaum zu atmen. Seine Finger verkrallten sich in den Fugen des Mauersimses. Er achtete nicht darauf, daß ihm die rauhen Steine die Haut abschürften.
Endlich, als sich der Fremde flüchtig umwandte, konnte er dessen Gesicht erkennen.
Es war der Mistträger.
Zu Tode erschrocken, ahnte er, daß der Geist des Ermordeten erschien, um sich an dem alten Raghubir zu rächen.
Langsam schritt der Mistträger die glitschigen Stufen hinunter, an denen Ende sich das Haus des Brahmanen an die Felsen duckte.
Nichts hielt den Knaben zurück. Er mußte dem vermeintlichen Geist folgen, ob er wollte oder nicht. Er hatte Angst und versuchte zugleich, sich einzureden, daß nichts von dem wahr war, was er zu sehen glaubte.
Beklemmend legte sich der Nebel auf seine Brust. Trotzdem hastete er den Weg hinunter, so schnell er konnte.
Einmal, als sich der Mistträger abermals flüchtig umwandte, verbarg sich der Knabe im Schatten eines mannshohen Gebüschs. Zu seiner Überraschung ging der Geist an Raghubirs Haus vorbei, ohne nur einen Moment zu zögern.
War es doch nicht der Ermordete?
Khande schob alle Zweifel weit von sich. Der etwas hinkende Gang des Mistträgers war unverkennbar.
Zwanzig Schritte weiter stand die Hütte der Familie Tschittanga. Sie waren Shudras, gehörten also wie der Tote nur der niederen Dienstklasse an.
Der Geist betrat den nicht sehr großen Hof und war Augenblicke später spurlos verschwunden. Allem Anschein nach hatte er das windschiefe Gebäude durch den hinteren, nur mit schweren Tüchern verhängten Eingang betreten.
Von innen erklangen spitze, kurzatmige Schreie. Nie zuvor hatte der Knabe eine Frau so schreien hören. Eine dumpfe Männerstimme redete beruhigend auf sie ein.
Egal, was geschehen war, Khande mußte es wissen. Blindlings hastete er weiter und stieß beinahe mit einem Mann zusammen, der das Haus verließ. Im ersten Moment schrie er entsetzt auf, weil er glaubte, dem Geist gegenüberzustehen, doch die Stimme, die auf ihn einredete, war menschlich.
„Du kannst nicht hinein.“
„Warum nicht? Was ist geschehen? Hat er …?“ Entsetzliche Vorstellungen schnürten ihm die Kehle zu.
Das Kreischen der Frau ging durch Mark und Bein. Als fahre ein Dämon aus ihr hinaus! durchzuckte es ihn.
„Komm!“ sagte der Mann unvermittelt und zog ihn sanft mit sich. „Meine Schwester sieht ihrer Niederkunft entgegen. Es ist fast schon zu spät, um einen Heilkundigen zu holen.“
„Aber – der Mann, der Mistträger …“ Vor Erregung brachte er kaum noch ein Wort heraus.
Sein Gegenüber verzog das Gesicht.
„Ein Mistträger ist das Letzte, was meine Schwester jetzt braucht.“
„Er ist eben ins Haus – mit zwei Eimern. Ich habe ihn hineingehen sehen.“
„Du redest wirr. Verschwinde endlich! Da ist niemand außer Arhantika und ihrem Mann.“
Nur ein leises, verhaltenes Wimmern war noch zu vernehmen. Augenblicke später wurde die Tür aufgestoßen: „Du brauchst den Heilkundigen nicht mehr zu rufen, meine Frau hat eben einen Sohn zur Welt gebracht.“
Khande verstand, daß der Geist nicht erschienen war, um sich zu rächen, sondern um wiedergeboren zu werden. Seine Seele fand noch keine Ruhe. Nur wenn er in den heiligen Wassern des Ganges gestorben wäre, hätte ihn das von allen noch bevorstehenden Wiedergeburten erlöst. Nicht mehr wiedergeboren zu werden, war das höchste Ziel, auf das ein Hindu hinstreben konnte.
Allerdings wunderte sich Khande Rao darüber, daß der Mistträger, der in seinem letzten Leben ein Shudra gewesen war, erneut der niederen Kaste angehören sollte. Gewiß hätte er es verdient, ein Vaishya zu werden, ein Händler, oder gar den Kshatriyas, dem Kriegeradel anzugehören.
Straften ihn die Götter auf diese Weise für ein besonderes Vergehen?
Sieben Jahre zogen ins Land. Der Knabe wurde zum Jüngling, der sich oft gegen die Traditionen auflehnte, weil er verlernt hatte, dem Altüberlieferten zu vertrauen. Der Sohn der Familie Tschittanga, dem seine Eltern den Vornamen Waruna gegeben hatten, entwuchs allmählich dem Kindesalter.
Drei Jahre nach ihm war seine Schwester Sumangalã geboren worden, ein Mädchen mit ebenmäßigen Gesichtszügen und einer Haut wie Pfirsichblüten.
Waruna war anders als die Kinder in seinem Alter. Er sonderte sich ab und weilte mitunter tagelang bei seinen Tieren. Er liebte die schneeweißen Tauben, die er im Stall eines Nachbarn halten durfte, solange er dessen Zugochsen mit Futter versorgte und den Mist auf die nahen Felder karrte.
Raghubir lebte noch, allerdings vermochte Khande Rao nicht zu sagen, ob der Greis inzwischen sichtbar älter geworden war. Längst hatte der heilige Mann das faltige Aussehen einer Mumie. Deutlich zeichneten sich die Knochen unter seiner lederartig gegerbten Haut ab.
Wieder erklang der verlockende Gesang des Morgenvogels, und wieder stiegen Nebelschwaden vom nahen Fluß auf. Der Jüngling stand am Fenster, als Raghubir den schmalen Weg zu den Terrassen hinaufstieg. Vor Jahren waren hölzerne Geländer angebracht worden, um zu verhindern, daß erneut jemand zu Tode stürzte.
Waruna Tschittanga lauschte dem Gurren der Tauben, als plötzlich eine von ihnen aufflatterte und sich nahe dem alten Brahmanen auf dem Geländer niederließ. Waruna rief vergeblich nach ihr, deshalb fürchtete er wohl, sie könnte ihm davonfliegen. Als er sich in seiner Verzweiflung nicht mehr anders zu helfen wußte, hob er eine Handvoll Steine auf und begann nach dem Tier zu werfen.
Aus Versehen traf er den greisen Raghubir. Der erschrak, glitt aus, und der noch immer halb gefüllte Wassersack auf seiner Schulter zerrte ihn über das Geländer in die Tiefe. Nicht ein Laut war zu vernehmen, als der Alte aufschlug und mit ausgestreckten Beinen liegenblieb. Der Inhalt des Wassersacks entleerte sich über ihn. Das Wasser, das er vom Ufer geholt hatte, schimmerte rot wie Blut in der Morgensonne.
Für eine Weile war nur das Gurren der Tauben zu hören. Ohne einen Laut von sich zu geben, verschwand Waruna von dem Platz, an dem er gestanden hatte.
Als die Sonne höher stieg und sich die Nebel auflösten, erschienen viele, um den Alten zu suchen.
Sie fanden den Leichnam und sprachen: „Er hat den Halt verloren und sich zu Tode gestürzt.“
Und sie übergaben ihn den Flammen eines Scheiterhaufens.
Der junge Khande Rao indessen fühlte sich von den Menschen abgestoßen, die sich mit schönen Dingen umgaben und nach höheren Werten strebten – und das alltägliche Geschehen ignorierten.
Ungefähr dreitausend Kasten umfaßt die hinduistische Gesellschaft. Ein Hindu glaubt daran, nach dem Tod so oft wiedergeboren zu werden, bis er nach vielen verschiedenen Leben zur Vollkommenheit herangereift ist. Dabei erscheint ihm der Rang seiner Kaste, die er ein Leben lang nicht wechseln kann, als Gradmesser des Fortschritts, den er bis zur Erlösung von allen Wiedergeburten erreicht hat. Unberührbare büßen mit ihrem Stand für Verfehlungen eines früheren Lebens, reiche Händler hingegen genießen die Früchte ihrer guten Taten aus der vorangegangenen Existenz.
Waruna Tschittanga war vierzehn Jahre alt, als er von dem Standbild Brahmas, des Weltenschöpfers, lautstark verkündete, daß er von allen Bewohnern des Dorfes so sehnlich erwartete Monsun großes Unheil bringen würde.
Niemand schenkte ihm Glauben. Auch nicht, als er sich den Kopf kahlgeschoren und zum Zeichen der Buße mit Asche bestreute und sieben Tage lang ohne Nahrung im Tempel verweilte, die Götter anrief und nur Wasser aus dem Fluß zu sich nahm, das ihm Sumangalã, seine Schwester, brachte.
Sie war ein betörendes Geschöpf. Das lange, schwarze Haar fiel ihr bis zu den Hüften, und wenn sie es offen trug, umwehte es sie wie ein hauchdünner Schleier.
Am achten Tag brach der Sturm mit einem verheerenden Gewitter los, das fast den ganzen Tag über anhielt. Der Regen ließ den Fluß heftig anschwellen und verwandelte die Terrassen in einen schlammigen Sumpf, den das Wasser mehr als kniehoch bedeckte. Dem Vieh auf den am tiefsten gelegenen Wiesen war der Rückweg versperrt. Die Männer, die versuchten, die Kühe mit Booten zu retten, wurden von der steigenden Flut mitgerissen und kenterten an den etwas weiter flußabwärts liegenden Stromschnellen.
Blitze schlugen dröhnend in Baumriesen ein und verwandelten sie in lodernde Fackeln oder ließen sie in den Fluß stürzen, wo sich bald ein ineinander verflochtenes Bollwerk aus Stämmen, Ästen und Schlamm bildete, das die Wasser anstaute. Innerhalb weniger Stunden wurden die untersten der sorgfältig gepflegten Terrassen unterspült. Große Flächen brachen ab und verschwanden in den aufschäumenden Fluten.
Während der Nacht deckte der Sturm Hütten und Häuser ab. Lediglich der jahrhundertealte Tempel blieb von den Naturgewalten verschont.
Als am nächsten Tag das Ausmaß des Unwetters in vollem Umfang sichtbar wurde, war die Saat auf den Feldern vernichtet, das halbe Dorf, das wie die Terrassen auf verschiedenen Ebenen angelegt war, zerstört, und überall lagen die Kadaver ertrunkener Tiere herum, die in der erneut einsetzenden Hitze rasch zu verwesen begannen.
Für Trauer blieb wenig Zeit. Die Aufräumarbeiten hatten Vorrang. Die Dorfbewohner mußten wenigstens versuchen, die nächste Ernte zu retten. Entwässerungsgräben wurden gezogen, weggeschwemmtes fruchtbares Land mühsam zurückgeschleppt und vom Abrutschen gefährdete Stellen neu befestigt.
Waruna Tschittanga konnte sich an den Arbeiten nicht beteiligen. Ein in allernächster Nähe einschlagender Blitz hatte ihn geblendet und nahezu seines Augenlichts beraubt. Selbst seine Schwester erkannte er nur noch, wenn sie dicht vor ihm stand.
Waruna betete im Tempel: zu Brahma, dem Schöpfer der Welt, zu Wischnu, der von gütigem und wohlwollendem Charakter war, zu Sarasvati, der Wasser- und Flußgöttin, und zu Schiwa, in dessen Wesen sich sowohl furchterregende und vernichtungsbringende Macht als auch lebensspendende und wohlwollende Kraft miteinander verbanden.
Daß er das Unwetter vorhergesehen hatte, erfüllte ihn mit Furcht. Besaß er Kräfte, von denen er selbst nichts geahnt hatte? Nicht einmal Sumangalãs Nähe war ihm bei all den quälenden Gedanken Trost oder Zuversicht.
Von den Eltern war sie einem Mann versprochen worden, den sie zum Ende der Monsunzeit hatte heiraten sollen, doch Jayaseelam war in den Fluten ertrunken und sein Leichnam vom Fluß davongetragen worden. Sumangalã verlieh ihrem Kummer Ausdruck, indem sie fortan nicht mehr von der Seite ihres erblindeten Bruders wich und ihn pflegte und verköstigte.
Wenn Waruna nicht in tagelanges, bedrückendes Schweigen verfiel, redete er wirres Zeug. Khande Rao, der sich als einer der wenigen Dörfler gelegentlich nach seinem Befinden erkundigte, behauptete mit Nachdruck, daß es sich dabei um Erinnerungen aus einem früheren Leben handeln müsse. Er verschwieg jedoch beharrlich, woher er sein Wissen bezog.
Im Dorf wurde das Leben noch karger und beschwerlicher, als es ohnehin schon gewesen war. Die Vorräte waren aufgebraucht, und die Menschen litten Hunger, weil weder der Fluß genügend Fische noch der nahe Wald ausreichend Wild oder Beeren hergaben. Die Brahmanen und Vaishyas im Dorf, also die oberen Kasten, hatten genug zu essen, alle anderen darbten und mußten ihr beschwerliches Schicksal widerspruchslos ertragen. Nur Waruna Tschittanga zeigte sich von alldem wenig beeindruckt, er sprach sogar davon, daß die Prüfungen, die das Dorf zu erdulden hätte, noch schlimmer werden würden.
Darmowy fragment się skończył.