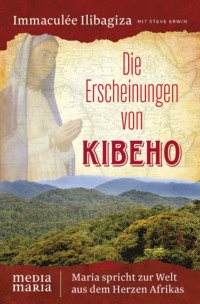Czytaj książkę: «Die Erscheinungen von Kibeho»
IMMACULÉE ILIBAGIZA
mit Steve Erwin
DIE ERSCHEINUNGEN
VON KIBEHO
Maria spricht zur Welt
aus dem Herzen Afrikas

Bibliografische Information: Deutsche Nationalbibliothek.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im
Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Titelbild auf dem Umschlag:
Die Statue Unserer Lieben Frau von Kibeho wurde 2001 von einem Team ruandischer Künstler geschaffen, die versuchten, die Beschreibungen der Seherin Anathalie detailgetreu umzusetzen. Als man ihr den ersten Entwurf zeigte, schüttelte Anathalie den Kopf und sagte: »Das kommt nicht einmal annähernd an Marias Schönheit heran!« Vierzehnmal schickte die Seherin die Künstler zurück an den Zeichentisch, bis sie sich frustriert eingestehen musste, dass kein Sterblicher die Schönheit der seligen Jungfrau Maria darzustellen vermag. Am Ende bat Anathalie die Künstler, ihr Bestes zu geben.
In sämtlichen Aufzeichnungen von Interviews mit Sehern aller Zeiten bestätigten die Betreffenden immer wieder, dass kein Bild und keine Statue auch nur im Entferntesten die wahre Schönheit der seligen Jungfrau Maria widerspiegeln würde.
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel:
OUR LADY OF KIBEHO
Mary Speaks to the World from the Heart of Africa
© 2008 by Immaculée Ilibagiza
Herausgegeben von Hay House Inc., Carlsbad, California, New York City, London,
Sydney, Johannesburg, Vancouver, Hong Kong, New Delhi
Titel der deutschen Ausgabe:
Immaculée Ilibagiza mit Steve Erwin
DIE ERSCHEINUNGEN VON KIBEHO
Maria spricht zur Welt aus dem Herzen Afrikas
© Media Maria Verlag, Illertissen 2017
Übersetzung: Dr. Gabriele Stein
eISBN 978-3-9479317-4-3
Alle Rechte vorbehalten

Unserer liebsten, geduldigsten, hingebungsvollsten und gütigsten Mutter gewidmet – dem hellsten und schönsten Stern am Firmament –, Unserer Lieben Frau von Kibeho.
Danke, dass Du in meinem Leben immer an meiner Seite gewesen bist; danke für die endlosen Tränen der Liebe; danke, dass Du so beharrlich darauf bestehst, uns vor der Dunkelheit zu retten; danke für Deine Freundlichkeit und für Deinen Liebreiz, mit dem Du Deine Kinder immer und immer wieder einlädst, Dir in die Wahrheit, den Frieden und das Licht der Herrlichkeit Gottes nachzufolgen.
Ich danke Dir aus tiefster Seele, dass Du meine Mutter bist, dass Du unser aller Mutter bist, dass Du die wahre Mutter des Wortes bist. Ich werde Dich ewig lieben.

Inhalt
Vorwort
Einleitung Zeig uns ein Wunder
Kapitel 1 Mein Glaube wurde in Fatima geboren
Kapitel 2 Maria kommt nach Ruanda
Kapitel 3 Maria wird akzeptiert
Kapitel 4 Die erste Seherin: Alphonsine
Kapitel 5 Die zweite Seherin: Anathalie
Kapitel 6 Und dann waren es drei: Marie-Claire
Kapitel 7 Die Wallfahrt meines Vaters
Kapitel 8 Vater sieht die Seherinnen
Kapitel 9 Freude im Land und die Sieben Schmerzen Mariens
Kapitel 10 Jesu seltsame Wahl der Seher
Kapitel 11 Drei weitere Seher
Kapitel 12 Wunder am Himmel
Kapitel 13 Die mystischen Reisen
Kapitel 14 Marias Tränen und ein Strom aus Blut
Kapitel 15 Maria und Kibeho und der Lauf der Geschichte
Kapitel 16 Mit Maria in Freude, Leid und Grauen
Epilog Das Neue Jerusalem
Der Rosenkranz der Sieben Schmerzen Mariens
Danksagungen
Über die Autoren
DAS AVE MARIA
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade,
der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen,
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder
jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Amen.


Vorwort

Wenn Gott von Macht spricht, dann spricht er nie in Worten, die die Welt versteht – doch er spricht unbestreitbar in Worten der Wahrheit. Die selige Jungfrau Maria, die Mutter Jesu, genießt auf der ganzen Welt und bei Millionen Menschen eine große Verehrung, und zu ihren Ehren sind mehr Bauwerke, Statuen und andere Kunstwerke geschaffen worden als zu Ehren irgendeines anderen Menschen gleich welcher Epoche (mit Ausnahme ihres Sohnes natürlich, der ihrem Dasein ja überhaupt erst diese Bedeutung verleiht).
In krassem Gegensatz zum Geld, zur Macht und zum Ruhm der Welt – flüchtigen, rasch wieder vergessenen und gelöschten Augenblicken – verkörpert und erhellt Unsere Liebe Frau wahrhaftig und für alle Zeiten Gottes ewige Macht. Sie lebt als tägliche Erinnerung, als täglicher Hinweis darauf, dass ihr Sohn Jesus stets derselbe bleibt. Er ist das »Licht der Welt« in einer Welt, die ihre klare Sicht verloren hat. An diese ewige Wahrheit wurde ich erinnert, als ich aus Zufall – oder Fügung – am Grab Jesu in Jerusalem meine Freundin Immaculée Ilibagiza traf und wir den Tag damit verbrachten, gemeinsam auf den Spuren Christi zu wandeln.
In Die Erscheinungen von Kibeho spricht Immaculée die einzige Sprache, die sie beherrscht: die der vollkommenen Aufrichtigkeit. In ihrer offenen und ehrlichen Art, die schon so viele Leser kennen- und schätzen gelernt haben, schreibt Immaculée einmal mehr einen wunderbaren, wahrheitsgemäßen und liebevollen Bericht über die Erscheinungen der Jungfrau Maria im Dorf Kibeho, die 1981 begannen.
Wenn man die verschiedenen Aussagen der Seherinnen und Seher liest, wird man – genau wie Immaculée – unweigerlich in die grenzenlose Liebe hineingezogen, die Unsere Liebe Frau für uns alle und für jeden und jede von uns empfindet. Immaculées intensiver und persönlicher Weg mit Maria, der Muttergottes, den sie vor, während und nach dem Völkermord in Ruanda zurückgelegt hat, hat in ihrer Seele einen wahrhaft unauslöschlichen Eindruck der Liebe zur Jungfrau Maria und zum Geschenk des Rosenkranzes hinterlassen. Mögen die Worte, die Sie erwarten, auch Sie durch das überirdische Licht seiner heiligsten Mutter mit Gottes Frieden, Vergebung und bedingungsloser Liebe beschenken!
Jim Caviezel
(Jesus-Christus-Darsteller im Film Die Passion Christi)

Einleitung

Zeig uns ein Wunder

»Zeig uns ein Wunder! Mach, dass wir glauben!«
Tausende flehender Stimmen drangen aus dem knisternden Lautsprecher des Kassettenrekorders, den unser Priester, Pater Apollinaire Rwagema, mitgebracht hatte.
Pater Rwagema hatte alle Kinder aus dem Dorf am Mittwoch nach der wöchentlichen Schulmesse in die kleine Kapelle eingeladen. Er hatte uns erzählt, er hätte eine große Überraschung für uns, und über zweihundert Kinder waren gekommen und erwarteten irgendetwas Aufregendes. Und wir sollten nicht enttäuscht werden.
Wir lauschten jedem Schrei und jedem Jubelruf. Einige von uns waren fasziniert von dem, was die Stimmen auf der Kassette sagten, andere starrten wie gebannt auf den Rekorder, der in der Mitte des kleinen Raumes auf einem Holztisch stand: So etwas hatten wir noch nie zuvor gesehen. Wir standen im Halbkreis um den Tisch herum und sahen zu, wie Pater Rwagema mit der rechten Hand die Pausen- und Abspieltaste bediente, während die Gesten seiner linken Hand das Gehörte unterstrichen. Er sah aus wie ein Orchesterdirigent.
»Hört jetzt genau hin, Kinder«, sagte er und wies auf das Gerät.
»Wir wollen ein Wunder sehen!«, riefen die Stimmen wieder und wieder. Wir alle waren begierig zu erfahren, was es mit dieser seltsamen Forderung der Menge auf sich haben mochte, doch niemand hätte gespannter sein können als ich.
Pater Rwagema schaltete den Rekorder aus; jetzt hatte er unsere ungeteilte Aufmerksamkeit und somit die besten Voraussetzungen für seinen nachfolgenden Bericht.
»Was ihr hier hört, sind die Stimmen von fünfzehntausend Menschen, manche davon aus unserem Dorf hier, die sich vor einer Holzbühne drängen und den Auftritt eines jungen Mannes verlangen. Schon seit einer Stunde warten sie darauf, ihn sprechen zu hören, doch in Wirklichkeit sind sie nicht daran interessiert, was er sagen wird – sie sind gekommen, um Jesus zu hören!« Pater Rwagema sprach mit dem Feuer eines leidenschaftlichen Predigers, denn genau das war er.
Er schaltete den Kassettenrekorder wieder ein, und die jubelnde Menge rief noch einmal nach einem Wunder, ehe sie plötzlich vollkommen still wurde. Das Einzige, was wir jetzt noch hörten, war das Surren der Kassette, die sich in dem Apparat drehte.
Dann begann ein junger Mann mit sanfter, ehrfürchtiger Stimme zu sprechen. »Ja, Herr, ich habe es ihnen schon so oft gesagt«, sagte er. »Nein, Herr, sie hören nicht zu … sie sagen mir immer wieder, dass sie ein Wunder wollen. Sie werden nicht glauben, dass Du zu mir sprichst, Jesus … nicht, solange sie nicht ein Wunder oder ein Zeichen sehen.« Er legte eine Pause ein, als wartete er auf Antwort, und sprach dann weiter: »Ja, ich werde ihnen sagen, was Du gesagt hast …«
Ehe der junge Mann seinen Satz vollenden konnte, brach aus dem Kassettenrekorder ein so gewaltiger Donner hervor, dass der kleine Tisch erzitterte. Der ganze Raum war mit derselben knisternden Elektrizität aufgeladen, die ich immer spürte, wenn ich mich von meinen Brüdern dazu überreden ließ, meine Zunge an die Batterie eines Transistorradios zu halten.
Jedes Kind im Raum war von dem Donner, der aus dem Lautsprecher des Rekorders dröhnte, aber auch von Pater Rwagemas Gesichtsausdruck wie gebannt. Seine Augen leuchteten vor Inbrunst; er schaute zur Decke hinauf, als könnte er durch sie hindurch und direkt in den Himmel sehen.
Ein zweiter heftiger Donnerschlag ertönte aus dem Gerät und erschreckte die kleineren Kinder, die zu weinen begannen.
»Das ist Gottes Stimme!«, verkündete Pater Rwagema. »Dieser Donner ist unser Herr Jesus Christus, der direkt zu uns spricht, hier in Ruanda! Fünfzehntausend Menschen – viele eurer Freunde, Nachbarn und Eltern – waren mit mir zusammen dort und haben dieses wunderbare Ereignis mit angesehen. Es war ein klarer, sonniger Tag, doch der Donner grollte vom Himmel wie ein Hammer. Hört gut zu, Kinder, denn ich habe jede Sekunde aufgenommen, um sie mit euch zu teilen … hört diesen Donner!
Diese vielen Tausend Menschen wollten einen Beweis, und als Gott ihnen diesen Beweis gab, gerieten sie in Angst und Schrecken. Viele liefen weg, einige wurden ohnmächtig und andere stürzten zu Boden und hielten sich die Ohren zu oder fielen auf die Knie und bekreuzigten sich. Es war ein Wunder!«
Der Donner endete genauso plötzlich, wie er angefangen hatte. Einen kurzen Moment lang herrschte wieder Stille auf dem Band, ehe die Menge in Angstschreie und Jubelrufe ausbrach: »Lob sei Dir, Jesus!« Doch als der junge Mann das Wort ergriff, wurden sie sofort wieder still.
»Jesus sagt, dass ihr keine Angst haben müsst, denn er würde seinen Kindern niemals ein Leid zufügen«, erklärte er der Menge. »Niemand hier ist verletzt worden, schwangere Frauen müssen sich nicht um ihre Kinder sorgen, und auch die mit einem schwachen Herzen werden keinen Schaden nehmen … Ja, Herr, ich werde es ihnen sagen … Jesus sagt mir, dass er euch den Donner geschickt hat, damit ihr auf seine Botschaften hört und nicht um Wunder bittet, die ohne Bedeutung sind.«
»Hört euch diesen Mann an, Kinder«, drängte uns Pater Rwagema. »Er heißt Segatashya, und ich bin ihm letzte Woche begegnet, nachdem er mit Jesus gesprochen hatte. Er ist der letzte der Seher, die Gott erwählt hat, damit die Jungfrau Maria und ihr Sohn durch sie zu uns sprechen. Mag sein, dass ihr Segatashyas Stimme hört, doch seine Worte kommen direkt von Jesus.«
»Unser Herr sagt, wir sollen nicht um Wunder bitten«, fuhr Segatashya auf der Kassette fort, »weil eure Leben Wunder sind. Ein Kind im Mutterleib ist ein wahres Wunder; die Liebe einer Mutter ist ein Wunder; ein vergebendes Herz ist ein Wunder. Eure Leben sind voller Wunder, aber ihr seht sie nicht, weil ihr euch von materiellen Dingen ablenken lasst. Jesus sagt euch, dass ihr eure Ohren für seine Botschaft und eure Herzen für seine Liebe öffnen sollt. Zu viele Menschen sind vom Weg abgekommen und gehen auf der bequemen Straße, die von Gott wegführt. Jesus sagt, ihr sollt zu seiner Mutter beten, dann wird die selige Jungfrau Maria euch zum allmächtigen Gott hinführen. Der Herr ist mit Botschaften der Liebe und dem Versprechen der ewigen Glückseligkeit zu euch gekommen, doch ihr bittet stattdessen um Wunder. Hört auf, am Himmel nach Wundern zu suchen. Öffnet euer Herz für Gott; wahre Wunder geschehen im Herzen.«
Pater Rwagema schaltete den Kassettenrekorder aus und schenkte den Jungen und Mädchen, die ihn ehrfürchtig anstarrten, ein breites Lächeln. Noch heute, fünfundzwanzig Jahre später, kann ich dieses Lächeln vor meinem geistigen Auge sehen, weil es mir gezeigt hat, dass Gott wirklich existiert.
DIESES LÄCHELN SAH MAN IN JENEN TAGEN AUF VIELEN GESICHTERN IN MATABA, dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Es liegt in Ruanda, einem kleinen und unglaublich schönen Land im Herzen Afrikas. Doch leider denken die meisten Leute, wenn sie den Namen Ruanda hören, nicht an die Schönheit des Landes; das, wofür Ruanda auf der ganzen Welt bekannt ist, ist der blutige Völkermord des Jahres 1994, bei dem mehr als eine Million unschuldiger Männer, Frauen und Kinder – unter ihnen auch ein Großteil meiner Familie – grausam niedergemetzelt wurden.
Doch an dem Tag, an dem ich mit den anderen Kindern aus dem Dorf Pater Rwagemas Kassetten anhörte, war der Tag des Genozids noch zwölf Jahre entfernt. Wenn jemand mir damals gesagt hätte, dass fast alle meine Verwandten und Freunde bald bei einem Völkermord ums Leben kommen würden, hätte ich ihn für verrückt gehalten. Für mich war mein Land ein echtes, friedliches Paradies – zumal in den frühen Achtzigerjahren, als die wundersamen Ereignisse ganz Ruanda mit einem nationalen Gefühl der brüderlichen Liebe und des Glaubens an Gott erfüllten.
In dieser Zeit erschienen die Jungfrau Maria und ihr Sohn Jesus – so unglaublich dies auch klingen mag – erstmals einer Gruppe junger Leute in einem Dorf namens Kibeho, das im Süden Ruandas liegt. Die Seher überbrachten himmlische Botschaften, die für die ganze Welt bestimmt waren: Botschaften der Liebe und Anweisungen für ein besseres Leben, ein fürsorglicheres Miteinander und ein effektiveres Beten. Außerdem aber gingen mit diesen Botschaften düstere, apokalyptische Warnungen einher: Hass und Sündhaftigkeit würden Ruanda und den Rest der Welt in einen finsteren Abgrund stürzen. Dass die Jungfrau Maria den Völkermord des Jahres 1994 vorhersagte, ist einer der Hauptgründe dafür, dass die katholische Kirche den Erscheinungen von Kibeho eine solche Aufmerksamkeit schenkte.
Im November 2001 erkannte die Kirche in einem außergewöhnlichen Schritt die Marienerscheinungen der drei Schülerinnen Alphonsine, Anathalie und Marie-Claire offiziell an. Zuvor hatten Ärzte, Wissenschaftler, Psychiater und Theologen die Mädchen aufs Strengste befragt und untersucht. Doch keine Untersuchung konnte die wunderbaren und übernatürlichen Ereignisse erklären, die geschahen, wenn die selige Jungfrau Maria den Mädchen erschien. Es war unumstößlich erwiesen, dass es sich um eine echte Erscheinung handelte, und der Ortsbischof sagte, in Ruanda habe sich zweifellos ein Wunder ereignet. Also bestätigte der Vatikan jene Stätte, die heute als »Heiligtum Unserer Lieben Frau der Schmerzen« bekannt ist. Es ist der einzige anerkannte Erscheinungsort in ganz Afrika.
Bislang hat die Kirche nur die Visionen von Alphonsine, Anathalie und Marie-Claire anerkannt und bestätigt, die zwischen 1981 und 1989 stattgefunden haben. Einige andere Seher (unter ihnen Segatashya, von dem bereits die Rede war) haben jedoch sowohl die selige Jungfrau Maria als auch Jesus gesehen und sind von demselben Expertenteam untersucht worden. Zehntausende von Augenzeugen – viele von ihnen Priester und Wissenschaftler – haben die Erscheinungen von mindestens fünf dieser anderen Seherinnen und Seher miterlebt. Die kirchliche Anerkennung dieser Erscheinungen steht zwar noch aus, doch dieses Kapitel sei, so der zuständige Bischof, noch nicht abgeschlossen, auch wenn die Ermittlungen zurzeit ausgesetzt seien. Es ist also durchaus denkbar, dass die Kirche in Zukunft noch weitere Seher anerkennen wird. Im vorliegenden Buch werde ich mich auf die acht bekanntesten Seherinnen und Seher konzentrieren, über die wir am meisten wissen.
Tatsächlich darf ich mich selbst als eine der Ersten betrachten, die die Überzeugung hegten, dass Maria und Jesus nach Ruanda gekommen waren. Lange bevor unser Ortspriester Pater Rwagema begann, nach Kibeho zu reisen und die Botschaften der Seher aufzuzeichnen, wusste ich schon tief in meinem Herzen, dass unser Land von einer göttlichen Macht berührt worden war.
Meine Eltern sind oft in Kibeho gewesen und haben mir ihre Besuche in allen Einzelheiten geschildert, und ich habe die Jungfrau Maria schon immer sehr geliebt. Neben meiner Faszination für die Erscheinungen war es diese Liebe, die mich gedrängt hat, so viel wie möglich herauszufinden und das Herausgefundene auf den folgenden Seiten mit Ihnen zu teilen. Ich bin mit den Bischöfen, Priestern und Ärzten zusammengetroffen, die die Erscheinungen untersucht haben; ich habe mehrere der Seher persönlich kennengelernt und mich mit ihnen angefreundet; und ich habe mir mehrfach Pater Rwagemas stundenlange Aufnahmen auf Kassetten von den Erscheinungen angehört. Aus diesen Quellen speist sich das vorliegende Buch. Mit anderen Worten, es handelt sich nicht um eine Geschichtsstunde, sondern um meinen persönlichen Bericht über ein echtes Wunder und seine tiefe Wirkung auf mein Land, meine Eltern und meinen Glauben.
Das Heiligtum Unserer Lieben Frau in Kibeho ist für Hunderttausende von Pilgern aus ganz Afrika zu einem Ort der Verehrung und des Gebets geworden. Viele von ihnen haben an dieser Stätte wunderbare Heilungen erlebt, und doch kennt man in den meisten Regionen der Welt nicht einmal den Namen dieses gesegneten Ortes. Es ist meine tiefste Hoffnung, dass dieses kleine Buch helfen kann, dies zu ändern, und dass Kibeho genauso bekannt werden wird wie Fatima oder Lourdes. Die Botschaften, die Jesus und Maria in Kibeho überbracht haben, sind Botschaften der Liebe – wie sie die heutige Welt so dringend braucht.

Kapitel 1

Mein Glaube wurde in Fatima geboren

Dieses Geständnis fällt mir nicht ganz leicht, aber ohne die Erscheinungen Jesu und seiner heiligsten Mutter in Kibeho hätte ich vielleicht nie so richtig an Gott geglaubt.
Wer meine ersten beiden Bücher, Left to Tell1 und Led by Faith2, gelesen hat, ist jetzt vielleicht überrascht, denn darin beschreibe ich meine Kindheit in einer sehr gläubigen katholischen Familie, die Stunden, die ich im Gebet verbrachte, und meine tiefe Verehrung für die Jungfrau Maria. Jeden Sonntag ging ich in die heilige Messe zusammen mit meinen Eltern Leonard und Rose und meinen drei Brüdern Aimable (dem Ältesten), Damascene (der ein paar Jahre älter war als ich) und Vianney (dem Nesthäkchen). Und als ich mich 1994 während des Genozids drei Monate lang versteckt hielt, beschloss ich, den Rest meines Lebens dem Dienst an Gott zu weihen.
Eigentlich sollte man also meinen, dass er in meinem Leben eine ziemlich bedeutende Rolle spielte.
Und wirklich übte, solange ich noch ein Kind war, alles, was mit Gott zu tun hatte, eine bemerkenswerte Anziehungskraft auf mich aus. Doch im Alter von etwa elf Jahren funkte mein wissbegieriger Verstand dazwischen, und die Zweifel, ob Gott überhaupt existierte, nagten am Fundament meines Glaubens. Noch ehe ich in die Pubertät kam, fragte ich mich bereits, ob ich vielleicht auf dem besten Weg war, eine eingefleischte Atheistin zu werden.
Diese jugendliche Glaubenskrise befiel mich nicht etwa, weil ich ein besonders frühreifes Kind gewesen wäre, sondern weil ich so viel Zeit damit zubrachte, über Gott nachzudenken. Meine frühesten Erinnerungen wurzeln in der Frömmigkeit. Meine Brüder rissen gerne Witze darüber und sagten, meine ersten Wörter seien nicht »Mama« oder »Papa«, sondern »Gegrüßet seist du, Maria« gewesen. Was gar nicht so abwegig gewesen wäre, denn ich erinnere mich noch ganz deutlich daran, wie meine Mutter den Rosenkranz betete, während sie mich in ihren Armen in den Schlaf wiegte.
Mit vier Jahren war ich vollkommen verliebt in Gott, Jesus und die Jungfrau Maria. Einmal im Monat brachte mein Vater eine katholische Monatsschrift mit nach Hause, die Hobe hieß: eine kleine Zeitung, die eigens für Kinder produziert wurde. Sie war voll mit aufregenden Bibelgeschichten, die von der Macht des Glaubens, den Wundern Jesu und den Abenteuern der Heiligen und Apostel erzählten. Wahrscheinlich habe ich auf diese Weise auch lesen gelernt, denn mein Vater und meine älteren Brüder mussten mir die Hobe-Geschichten immer und immer wieder erzählen, bis ich alle Wörter und ihre Bedeutung auswendig kannte. Am meisten aber liebte ich die Bilder zu den jeweiligen Geschichten.
Meine Lieblingsillustration zeigte ein typisches ruandisches Dorfmädchen – ein sehr armes, aber sehr glückliches Kind –, das seine Abendgebete sprach. Es kniete neben seinem Bett aus Bananenblättern und hielt einen hölzernen Rosenkranz in seinen gefalteten Händen. Das Licht der Kerze auf dem Nachtkästchen strahlte und umgab den Kopf des Mädchens wie mit einem Heiligenschein und es sah tatsächlich aus wie ein Engel. Solche kleine Mädchen hat Gott lieb, dachte ich bei mir und versuchte jahrelang, es ihr gleichzutun.
Als einziges Mädchen in einer Familie mit vier Kindern hatte ich gewisse Privilegien, die meine Brüder nicht hatten. Dazu gehörte auch ein eigenes Schlafzimmer, was in einem Dorf in ländlicher Umgebung ein nahezu unerhörter Luxus war. Ich nutzte diese Privatsphäre und verwandelte mein Zimmer in einen persönlichen Andachtsraum. Auf meinem Nachtkästchen stand eine Kerze, die genauso aussah wie die auf dem Hobe-Bild; und gleich daneben lagen oder standen, fein säuberlich angeordnet, immer eine Bibel, ein Rosenkranz und eine kleine Marienstatue. Jeden Abend, wenn meine Brüder zu Bett gegangen waren und meine Eltern das Licht im Haus gelöscht hatten, glitt ich aus dem Bett, zündete meine Kerze an und betete genau wie das Mädchen in der Zeitschrift auf den Knien den Rosenkranz.
Während die meisten Kinder, die ich kannte, sich auf dem Weg in die Sonntagsmesse reichlich Zeit ließen, war ich immer die Erste in der Kirche, weil ich sichergehen wollte, dass ich möglichst nahe beim Priester saß, denn dort, so dachte ich, war ich so nah bei Gott wie es nur ging. Und nach der heiligen Messe zog ich hinaus in die Welt, um gemeinsam mit ihm Abenteuer zu erleben.
Eines Sonntags, als ich fünf Jahre alt war, beschlossen meine Freundin Patricia und ich, an den Rand des uns bekannten Universums – auf die andere Seite des Dorfs – zu gehen, um zu sehen, ob wir nicht vielleicht in der Ferne einen Blick auf Gott erhaschen könnten. Als wir unser Ziel erreicht hatten – das eine gefühlte Tagesreise, tatsächlich aber nur knapp zwei Kilometer von unserem Zuhause entfernt war –, knieten meine Freundin und ich uns in der Mitte der staubigen Straße nieder, falteten unsere Hände zum Gebet und begannen, das Vaterunser zu beten. Wir glaubten, dass unsere Frömmigkeit den allmächtigen Vater dazu bewegen würde, sich mit uns zu unterhalten, doch anstelle seiner majestätischen Stimme schreckte uns ein heiseres Kichern aus unserer Andacht auf.
»Was um alles in der Welt fällt euch Kindern nur ein, hier mitten am Tag auf der Straße zu beten?«, fragte Lionel, ein Hirte aus unserem Dorf, der mit einem halben Dutzend Ziegen vorbeikam. Patricia und ich hatten gerade in der letzten Hobe-Zeitschrift gelesen, dass Kinder sich niemals dafür schämen durften, weil sie zu Gott beteten, denn wenn sie sich für ihre Liebe zu ihm schämten, dann würde er sich umgekehrt auch für seine Liebe zu ihnen schämen. Also hielten wir die Augen fest geschlossen, beteten nur umso inbrünstiger weiter und ignorierten Lionel und die Ziegen, deren borstiges Fell unsere Arme streifte. Lionel lachte weiter und wir beteten weiter. Als wir beim »Amen« angelangt waren, hatte der Hirte aufgehört zu lachen. Stattdessen hörten wir ihn grummeln: »Was soll aus dieser Welt werden, wenn Kinder lieber beten statt zu spielen?«
In meiner Welt überschnitten sich Gebet und Spiel. Eines meiner liebsten Kinderspiele hatte ich selbst erfunden, es hieß »Himmelsfotos«. Jedes Mal, wenn ein Meteoritenregen die Nacht über unserem Dorf erhellte, was in den Sommermonaten häufig vorkam, trommelte ich ein Dutzend Kinder zusammen und lief mit ihnen auf eines der Bohnenfelder meines Vaters. Während die Sternschnuppen kreuz und quer über den Himmel schossen, rannte ich von einem zum anderen und sorgte dafür, dass sich alle in Richtung Himmel in Positur stellten.
»Das sind die Blitzlichter von Gottes Fotoapparat«, erklärte ich ihnen dann und wies auf die leuchtenden Meteoriten. »Ihr müsst ein freundliches Gesicht machen, denn Gott macht Fotos von uns und wird sie uns zeigen, wenn wir bei ihm im Himmel sind!«
Als ich sechs Jahre alt wurde, galt ich zu Hause und in meinem Dorf als ein sehr frommes Kind. Das machte mich glücklich, denn ich war mir sicher, dass sowohl Gott als auch meine Eltern deshalb stolz auf mich waren. Dennoch gab meine Mutter mir gelegentlich zu verstehen, dass ich es mit meiner christlichen Nächstenliebe zu weit trieb – wie jenes eine Mal, als ich einer barfüßigen Mitschülerin am ersten Schultag meine nagelneuen Schuhe schenkte.
»Immaculée, wie konntest du nur diese Schuhe weggeben? Weißt du, was sie gekostet haben?«, fragte sie mich verzweifelt. (Allzu böse konnte sie allerdings nicht werden, denn sie und mein Vater, die beide Lehrer waren und mehr Geld verdienten als die meisten Leute im Dorf, waren weit und breit für ihre Wohltätigkeit bekannt.)
»Mama, ich muss dreizehn Kilometer bis zur Schule gehen, aber sie muss fünfzehn Kilometer gehen. Sie brauchte die Schuhe nötiger als ich«, antwortete ich.
»Also gut, wenn du das nächste Mal das Bedürfnis hast, Schuhe zu verschenken, dann nimm lieber deine alten«, sagte sie mit einem Lächeln.
ALS KIND WAR ICH DIE MEISTE ZEIT ÜBER mit einem unerschütterlichen Glauben an Gott gesegnet. Doch etwa ein halbes Jahr vor meinem elften Geburtstag begann ich unerklärlicherweise, alles infrage zu stellen, was ich bis zu diesem Augenblick ganz selbstverständlich als die Wahrheit des Evangeliums akzeptiert hatte. Vor allem die Bibelgeschichten, die ich immer so gern gehört hatte, wurden für mich zu einer beunruhigenden Quelle unbeantwortbarer Fragen.
Es kann nicht sein, dass Jona in einem Fischbauch überlebt hat! Das ist völlig unmöglich, murrte ich. Oder meine Gedanken liefen Sturm gegen den Priester, der in der Kirche über die Bibel sprach: Woher will er wissen, dass Noah wirklich eine Arche gebaut und mit allen Arten von Tieren beladen hat – also wirklich! Als ob Kühe und Ziegen vierzig Tage überstehen würden, wenn außer ihnen auch noch Löwen und Krokodile an Bord sind! Und was die Geschichte mit Saul angeht: Außer ihm und seinem Esel und Gott war niemand dabei … und das Ganze ist vor über zweitausend Jahren geschehen!
Plötzlich erschien mir alles suspekt, was man mich gelehrt, was ich gehört und blind geglaubt hatte: Gibt es wirklich etwas Übernatürliches? Gibt es einen Himmel oder sogar einen Gott? Sind diese ganzen Dinge eine Erfindung der Erwachsenen, damit die Kinder sich benehmen? Oder eine Erfindung der Kirche, damit sie Macht ausüben kann? Woher soll ich wissen, wer die Bibel geschrieben hat? Ich kann es nicht wissen! Wer kann beweisen, dass es Jesus wirklich gegeben hat? Niemand kann das! Vielleicht haben diese Priester und Pastoren jahrhundertelang alle zum Narren gehalten!
Wenn es Gott und den Himmel gar nicht gibt, was geschieht dann, wenn wir sterben? Werden wir einfach in ein Loch im Boden geworfen, mit Staub bedeckt und für alle Ewigkeit im Dunkeln gelassen? Heißt das, dass ich nicht mit meiner Familie zusammen im Himmel sein werde, wenn wir alle gestorben sind? Und wenn das so ist, was für einen Sinn hat es dann zu leben, wo es doch so viel Traurigkeit, Krankheit und Leid in der Welt gibt?
Das war alles zu viel für meinen kindlichen Verstand, und so vergrub ich die düsteren Gedanken, so tief ich nur konnte, und versuchte die aufsteigende Niedergeschlagenheit zu ignorieren, die, das wusste ich, mein Herz überfluten würde, wenn ich mich damit abfand, dass es Gott nicht gäbe. Ich bekam Albträume, in denen ich von Teufeln und Dämonen verfolgt wurde, und wachte davon auf, wie ich zu Gott um Hilfe schrie.
Meine Eltern, die sich so über meinen Glauben gefreut hatten, wären am Boden zerstört gewesen, wenn sie gewusst hätten, welche Zweifel ich hegte. Also verbarg ich den Aufruhr in meinem Inneren vor ihnen. Ich ging nach wie vor mit meiner Familie in die Kirche und sprach meine Nachtgebete, doch die heilige Messe erschien mir wie eine leere Hülse, und die Gebete, die ich ohne Überzeugung sprach, konnten mich weder trösten noch beruhigen. Viele mögen die Glaubenszweifel einer Elfjährigen für bedeutungslos und wenig folgenschwer halten, doch Gott und das Gebet waren ein so wesentlicher Teil meines Daseins gewesen, dass ich mich ohne sie nun ganz verloren und verletzlich fühlte. Wenn ich mir eine Welt vorstellte, in der es keinen Gott gäbe, dann, so schien es, erwartete mich ein schweres, sinnloses Leben. Bestenfalls.