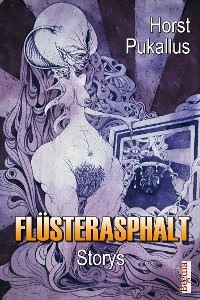Czytaj książkę: «Flüsterasphalt»
Horst Pukallus
Flüsterasphalt
fantastic episodes X
© 2014 Begedia Verlag für diese Ausgabe
© der Geschichten: Horst Pukallus
Lektorat: Begedia Verlag
Umschlagbildgestaltung: Helmut Wenske
ebook-Bearbeitung: Begedia Verlag
ISBN: 978-95777-044-8
Besuchen Sie unsere Webseite
http://verlag.begedia.de
Inhalt
Schatten ohne Lächeln © 2001
Letzte Trendansage © 2009
Tango Is a Virus © 2006
Placebo © 2009
Die Ära der brennenden Berge © 1989 und 2013
Flüsterasphalt © 2013
Nachwort von Michael K. Iwoleit
Schatten ohne Lächeln
O Herz, gib ganz der Sehnsucht dich hin!
Der letzte Zweifel ist jetzt auch gelöst.
Was furchtsam du für leuchtend Feuer hieltst,
ist ein Juwel, das man berühren kann.
Kalidasa: Sakuntala
Ganz nervös wichst Broder Erckelenz übers Balkongeländer in die Tiefe. Er befürchtet, dass der Stress ihn noch umbringt. Dermaßen steht er unter Zugzwang. Indem er hinaus in die Welt wichst, zeigt er ihr, dass er zu ihr Kontakt hält und sein Bestes gibt. Seit er daheim ist, hat er schon eine Flasche Wein geschlürft. Er braucht den Alk, um den Durchblick zu behalten. Zum Glück ist er bloß Alpha-Alkoholiker. Der Segen sprinkelt hinab als Beweis seines fruchtbaren Schaffens.
Es ist Nacht und schwül. Broder zurrt die Hose zu. Müde kehrt er in die Wohnung zurück. Zerrt sich das schweißklamme T-Shirt vom Oberkörper. In den letzten Wochen hat er vom Weißwein wieder mal Bauchspeck angesetzt. Er will ausgiebig Sport treiben, sobald der Erfolg da ist: Wenn die pharmazeutische Sensation ihn oben plaziert, wo man die Gelder in Unschuld wäscht.
Er zockelt durchs halbdunkle Zimmer zur Workstation. Nimmt das Glas in die Hand. Hockt sich gebückt an die Tastatur. Der Bügel des Infrarot-Kopfhörers hängt ihm im Nacken. Gregorianische Choräle dröhnen ihm ins Gehör. Sie ermöglichen es ihm, einen bestimmten Level innerer Spannung zu bewahren. Wenn er erlahmt, reißt ihn der Endreim aus der Ermattung. So wie es früher den Mönchen ging.
Vor vierzehn Tagen hat er die Penthouse-Wohnung bezogen.
Die meisten Räume stehen noch so gut wie leer. Immerhin hat er schon ein Elektronisches Aquarium. Diesen Aufstieg verdankt er dem NI-Projekt. Termindruck und Torschlusspanik bewogen das Van-Helmont-Institut zu großzügigen Abschlagszahlungen. Schwupp!, katapultierte es den kleinen Broder, 32 (bis dahin lediger Biochemiker mit Teilzeitstelle beim Lebensmitteluntersuchungsamt), aus der 42-m²-Bude an der Müllverbrennung in die zentral gelegene, nagelneue 152-m²-Dachgeschosswohnung. Mit Blick auf City oben und unten. Swimmingpool im Atrium.
Und das kam so: Das Van-Helmont-Institut forscht schon jahrelang nach NI: nach Nutri-Intelligenz. Fressbarem Wissen. Soll das Lernen, weil die Kids solchen Zumutungen nicht mehr gewachsen sind, überflüssig machen. Selbstverständlich hängt das Institut am Finanztropf eines Pharmaziekonzerns. Ebenso selbstverständlich klebt an dem Pharmaziekonzern ein Medienkonzern, will das verzehrbare Informationsmedium vermarkten. Alle schwelgen im Überschwang der Börsenorientiertheit. Noch nie da gewesen, so was von Innovation. Durchbruch. Synergie. Umwälzung. Blahblahblah. Usw.
Aber es klappt nicht. Vor allem fluppt es nicht. Zu dumm, dass ein Direktor viel zu früh etwas hinaus in die Öffentlichkeit gequakt hat. Muss nun das Gesicht wahren. Verwirrung an der Börse beilegen. Darum stänkern die Medienzaren bei den Pharmabonzen; und diese Herren erinnern das Van-Helmont-Institut täglich daran, dass man über moderne Daumenschrauben wie Etatkürzung, Entlassung und Leistungsbeschneidung verfügt.
Da traute sich eines Morgens ein allzu übel gemobbtes Mitglied des Forschungsteams nicht mehr ins Labor. Aus Ratlosigkeit erhängte sich der Ärmste im Bahnhofsklo. Hoppla! Woher am nächsten Tag einen fähigen Nachfolger rekrutieren?
Ein Kollege des undankbaren Realitätsflüchtigen erinnerte sich an Broder. Kannte ihn vom Studium. Ein Halbdutzend Telefonate, und unversehens hüpfte Broder aufs Quereinsteiger-Trittbrett. Wusste kaum, wie ihm geschah. Die ersten Tage verbrachte er im Taumel des Glücks. Aber jetzt... Belastung und Verantwortung haben ungeheure Ausmaße. Stückchenweise verschlingt ihn der Stress, nagt an seinen Nerven. Erhöht jeden Tag ein bisschen mehr den Blutdruck. Seit einer Woche plagt ihn vor dem Einschlafen Herzrasen. Die erzwungene Untätigkeit der Nachtruhe verursacht ihm ein schlechtes Gewissen.
Eines jedoch ist klar: Wenn er diese Chance nicht nutzt, geht die Zeit über ihn hinweg. Über alles hinweg walzt die Zeit. Schwund ist immer. Das dekonstruktivistische Wohn- und Ladenpassagenzentrum, in dessen oberster Etage er seit Kurzem wohnt, hat man auf dem früheren Gelände des Nordfriedhofs gebaut.
Broder merkt, dass seine Finger zittern, während sie über die Tasten flitzen. Er hat ernsthafte Sorge, ob er vielleicht eine Gesundheitsschädigung erleidet. Ganz davon zu schweigen, dass ihm der soziale Tod auf die Pelle rückt. Sein Privatleben ist praktisch auf Null geschrumpft.
Gegenüber wohnt eine nette Nachbarin, ist ihm aufgefallen. Keine Deko-Schnepfe. Schwarze Pagenfrisur. Schleicht in anthrazitfarbenem Kostüm durch den Korridor. Kann also sein, sie hat Geschmack. Laut Namensschild heißt sie Klemmt. Wäre sie nicht, er kriegte wohl vor lauter Maloche keinen Ständer mehr. Broder nimmt sich vor, in den kommenden Tagen bei seinem Server zu recherchieren, ob sie eine E-Mail-Adresse hat.
Heliane Norina Klemmt, 28, ehedem Logopädin in spe, war zwar wegen Elektrosensitivität berufsunfähig geschrieben, aber dank ihres Biochip-Computers stand sie trotzdem in Verbindung mit Gott und der Welt. Vor allem mit Gott. Sie hatte nur einen ganz kleinen Fernsehapparat, damit sie von der sündigen Welt nicht so viel sah.
Während sie sich auf der Home-Page des Vatikans die Aktualitäten anschaute und dazu Kamillentee trank, downloadete ihr Computer die schönsten Sacro-Popsongs des Kirchenfunks und die sehr schönen Poetext-Verse diverser Online-Poeten.
Trotz der Berufsunfähigkeit musste sie nicht darben. Ihr vor sechs Jahren verstorbener Vater, zu Lebzeiten zuletzt frühpensionierter Ministerialdirektor, hatte sein Hab und Gut versoffen und verhurt, aber ihr eine Briefmarkensammlung vererbt. Weil Heliane jeder tiefere Sinn für die bunten Bildchen fehlte, hatte sie die Alben einem Auktionator zur Versteigerung überlassen, der dafür eine Summe erzielte, über deren Höhe sich Heliane gern in Schweigen hüllte. Jedenfalls hatte sie fast den gesamten Betrag als Festgeld angelegt und konnte im Wesentlichen von den Zinsen leben.
Sie leistete sich eine kleine, aber schöne Dachgeschosswohnung, wie sie nicht jede hatte, ausgestattet mit schönen origo®-Möbeln. Sie las schöne Bücher, hörte schöne Musik und brachte nach langem Ausschlafen schöne, ruhige Abende zu, erst am Computer, dann im Gebet.
Ihr Dasein war wunderschön und friedlich gewesen. Bis drüben, in der größeren Wohnung, die wegen hoher Miete anfangs leer geblieben war, der neue Nachbar einzog.
Bei den ersten, gelegentlichen Begegnungen im Korridor hatte sie ihn lediglich am Rande wahrgenommen. Doch irgendwann bewog irgendetwas sie zu guter Letzt, völlig gegen ihre Gewohnheit, zum Hinsehen. Seitdem glichen ihre Gedanken Raketen, die allesamt ein und dieselbe Richtung nahmen: Ständig zielten sie auf den Unbekannten hinter der Tür auf der anderen Seite des Korridors.
Seine Anziehungskraft wirkte auf Heliane mit geradezu unwiderstehlicher Eindringlichkeit. Sie befand sich unter einem regelrechten Bann.
»Viele Menschen achten sorgsam darauf, unter welchem Stern ihr Leben steht«, erzählte Internet-Prediger Pater Damasus, zu dessen WebSite sie inzwischen per Link übergewechselt war; eine virtuelle Persönlichkeit, die bei Eingeweihten längst im Rufe der Heiligkeit stand. »Es ist ihnen nicht einerlei, ob es ein Stern ist, der Gutes verheißt, oder ein Stern, der Dunkles ankündigt. Der helle Morgenstern, der den kommenden Tag ankündet, ist Christus. Wie der Morgenstern auf die aufgehende Sonne, so verweist Christus auf Gott, die unverzichtbare Sonne der Gerechtigkeit ...«
Es verhielt sich nicht so, dass sie sich ein bisschen in jemand Unerreichbares verliebt hätte; so etwas war ihr schon mehrmals passiert, und jedes Mal hatte sie es verwunden. Nein. Dieses Mal fuhren die Gefühle ihr hinab in die Scharte (wie ihre Mutter, einst Europameisterin im Mariechentanz, das weibliche Geschlechtsteil stets genannt hatte) und lösten Empfindungen aus, deren Ungestümheit sie erschreckte. Keine harmlose Vernarrtheit hatte sie befallen. Sie verspürte wollüstiges Verlangen. Ihr Leib gierte nach einem Mann, von dem sie nur den Namen wusste, der auf seinem Türschild stand.
»Wer sein Leben unter den Stern Christi stellt, dessen Leben steht unter einem guten Stern, denn es steht unter dem Stern der Hoffnung...«
Ach, was für schöne Worte Pater Damasus immer spricht, dachte Heliane. Sie geriet darüber richtig in Erregung. Nein. Ihre eigene Hand erregte sie. Ohne dass sie es so recht gemerkt hatte, war ihre Linke hinab zum Schamhügel geglitten und umstrich dessen fleischige Wölbung. Unruhig zuckten unterm hochgerutschten Rock ihre Oberschenkel. Schon zweimal hatte sie, seit der Nachbar drüben wohnte, seinetwegen masturbiert, einmal vor dem Schlafengehen, und einmal, weil sie aufgewacht war, mitten in der Nacht, aber natürlich hatte sie sich jedes Mal am folgenden Tag einer Computer-Beichte unterzogen.
Ein Kribbeln prickelte durch die Wurzeln ihrer Schamhaare. Unwillkürlich senkte sich ihr Zeigefinger in die Falte, die sich an ihrem vergewaltigungssicheren Petite-fleur-Slip abzeichnete.
Heliane überlegte, dass sie bei ihrem Online-Dienst nachgucken könnte, ob der neue Nachbar eine E-Mail-Adresse hatte.
Als Broder die Wohnung betritt, reißt er sich das Jakko herunter. Das Ding stinkt nach Snackeria. Er flitzt zur mit dem Institut vernetzten Workstation. Schaltet den Computer und den LCD-Monitor ein. Er ist spät dran.
Täglich zwölf bis vierzehn Stunden Geschufte im Labor. Zähe Debatten mit unfähigen Laboranten. Er müsste noch länger bleiben, wäre nicht jedem einsichtig, dass ein Mensch Pausen benötigt. Dann um 22 Uhr Videokonferenz. Kommt immer pünktlich zustande. Anders als früher. Im vergangenen Jahrhundert gab es dauernd Kommunikationsschwierigkeiten. Ständig hieß es: F.P. 1 antwortet nicht. Metaluna 4 antwortet nicht. Datex-J antwortet nicht. Oder ähnlich. Damit ist es seit Längerem vorbei.
Dennoch nimmt er sich Zeit, um flugs dem Kleinen Dicken einen Räucherkegel anzuzünden. Das ist nach der Heimkehr unweigerlich seine erste Handlung.
Der Kleine Dicke steht auf einer Kommode gleich hinter der Wohnungstür. Streng genommen ist er eine Kupferstatuette Ganeshas (H 36,4 cm). Ganesha ist eine hinduistische Gottheit mit Elefantenhaupt, Schmerbauch und vier Armen. Seine Hände halten: eine Muschel, ein Diskus, eine Keule, eine Wasserlilie. Er scheint damit zu fuchteln. Er gilt als Gott der Weisheit und Beseitiger aller Hindernisse; als Schenker des Erfolgs im Weltlichen ebenso wie im Spirituellen.
Nicht dass Broder Bedarf an Übersinnlichem hätte. Die Statuette erinnert ihn daran, wie er früher mal war: Ein kleiner, dicker Junge. Fuchtelte herum. Fing viel an, brachte wenig zu Ende. Tendenzieller Versager.
Irgendwann hat er doch noch die Kurve gekriegt. Seitdem zündet er dem Kleinen Dicken jeden Tag ein Räucherkegelchen an. Zum Gedenken an alle kleinen, dicken Jungs, die nicht wissen, was aus ihnen werden soll.
Lieber würde er sofort eine Flasche Chante-Alouette aufmachen. Stellt sich aber im Hinblick auf die Videokonferenz eine Flasche Perrier hin.
Täte auch lieber erst einmal wichsen, um den ärgsten Stress abzubauen. Beim Durchhetzen des schiefwinklig verglasten Korridors hat er wieder die Nachbarin gesehen. Diesmal zum grauen Kostüm blaue Kniestrümpfe. Sah aus wie eine Schuluniform. Verhalf ihm augenblicklich zu einer Latte.
(Irrt er sich, oder trifft er sie neuerdings häufiger im Hausflur?)
22 Uhr. Zack-zack!, teilt sich der Bildschirm. Da sind Dr. Lubok und Dr. Schratz. Von Anfang an ist Dr. Schratz Broders besonderer Spezi geworden. Sobald eine Videokonferenz ausgestanden ist, schiebt er unweigerlich zu Dr. Schratz’ Würdigung unverzüglich die CD mit W.A. Mozarts seltener gesungenem Kanon »O du eselhafter Peierl« (Köchel-Verzeichnis # 560a) mit dem unzweideutigen Bescheid »Leck mich doch geschwind im Arsch« in den Player.
Das Palaver nimmt seinen Lauf.
»Die Kernresonanzspektroskopie hat wieder zu keinen neuen Erkenntnissen geführt, was die Parameter der Ligand-Protein-Wechselwirkung angeht«, sagt Dr. Lubok.
Dr. Schratz’ Visage verzerrt sich zu Grimassen. Wohl unbewusst. »Weitere Moleküldynamiksimulationen sind ebenfalls negativ geblieben.« Auf dem Monitor schimmern seine Kontaktlinsen leicht rötlich. »Herr Erckelenz, wann wird die alternative Syntheseplanung abgeschlossen?«
Es gibt ein Problem. Codierte elektrische Schwingungen prägen Wissenspakete in Matritzenform künstlichen, aus Aminosäuren bestehenden Liganden ein, die an bestimmten Rezeptoren der Gehirnzellen andocken. Der datenhaltige Ligand hat in diesem Fall eine sperrige Molekülstruktur und einen multiplen Bindungsmodus. Daraus entsteht ein unerwünschtes Zusammenwirken mit anderen Rezeptoren. Beim Mäuse-Test kommt es zu epileptischen Symptomen ähnlichen Nebeneffekten. Keine Chose mit sales appeal.
Wird die Molekülstruktur reduziert, tritt ein vorzeitiger Zerfall der Informationsmatrize ein. Unklare Ursache. Ligand muss optimiert werden.
Die Syntheseplanung erfolgt virtuell. Und was Computer anbelangt, ist Dr. Schratz ein Depp. Gerne sagte Broder es ihm ins Gesicht. Aber damit würde er seine Karriere im Keim ersticken.
»Herr Dr. Schratz«, antwortet er daher lediglich, »die Berechnungen können sich hinziehen.« Der Pharmakophor, der die Molekülstruktur des Liganden beschreibt, ist nämlich ein Tetraeder mit 4 Ecken und 6 Kanten; hat deshalb eine Millarde Kombinationsmöglichkeiten. Allein deren Abspeicherung erfordert tausend Gigabyte. »Ich versuche Deskriptorenvarianten zu entwickeln, die sich auf die Topologie der Moleküle beschränken und durch Reduzierung der Datenmasse die Bearbeitungsdauer verkürzen.«
Dr. Luboks Miene bezeugt unterschwelliges Gefrette. »Sind Sie imstande, einen Termin zu nennen?«
»Nein.«
Wie jedes Mal verfällt Dr. Schratz in Geschwafel. Zur Illustration lädt er die zur Auswahl gestandenen, computergenerierten Ligandendesigns. Statt der Gesprächspartner sieht Broder nun molekulare Strukturmodelle der Bindungstaschenanalyse, des Docking und Linking auf der Bildfläche.
Gleich schweift seine Fantasie zur Nachbarin ab. Dr. Schratz’ Geplapper erbringt ihm keinen Nutzen. Gängige Verzwirnungen, Faltungen, Verschlaufungen und Verknäuelungen der Nukleinsäuren sind für ihn ein offenes Buch. Aber hier soll einem bekannten Buch ein neues Kapitel angehängt werden.
Broder greift sich an den Schritt und kratzt sich am Sack. Wenn die Nachbarin ihn anschaut, so seine Beobachtung, setzt sie einen verkniffenen Gesichtsausdruck auf; hat einen ganz kleinen Mund. Als müsste sie ein Schmunzeln unterdrücken. Verhuschtes Wesen. Schatten ohne Lächeln.
Broder stellt sich – nicht zum ersten Mal – vor, dass er ihr den Rock hochschiebt. Eine Hand um die Hüfte in die Gesäßfalte gleitet. Die andere Hand über die Mooskuppe abwärts tastet. Malt sich aus, durch ihr Höschen die Feuchtwärme der Möse zu fühlen.
Sein Halbsteifer schwillt zum harten Bolzen an. Starke Beengung in der Hose. Broder öffnet den Reißverschluss. Lässt den Pfeifenkopf Frischluft atmen.
Zack-zack!, kehren die beiden Konterfeis auf den Bildschirm zurück. »Sie haben vollkommen Recht, Herr Dr. Schratz«, äußert Broder, ohne bei der Sache zu sein. »Ich muss die Angelegenheit einmal gründlich durchficken.«
Heute Abend hatte Heliane Norina den Nachbarn verpasst. Als sie mit der Mülltüte in den Korridor schlüpfte, war er bereits zu Hause. An der Tür spürte sie die chlorig riechenden Elektroemissionen seiner Wohnung auf der Haut wie harte Strahlung. Er musste ungewöhnlich viele und starke Elektrogeräte betreiben.
Auf dem Rückweg von der Müllklappe bemerkte sie die feine Anspannung ihrer Muskeln, die ein erneutes Erwachen ihrer schrecklichen Begierden ankündete. Schon auf der Schwelle zu ihrer Wohnung gloste zwischen ihren Beinen Lüsternheit. Drinnen lehnte sie sich rücklings an die Tür, schloss die Lider und ließ die Hände über den Bauch an sich hinab rutschen, bis sich die Zeigefinger beiderseits des Schamhügels in die Winkel der Oberschenkel pressten. Unter dem Dreieck zwischen ihren Händen schien ein Schwelbrand sich langsam aufwärts zu fressen.
Nein. Sie durfte nicht schwach werden.
Heliane kam der Gedanke, sich zur Ablenkung eine Internet-Predigt anzuhören. Vielleicht konnte Erbauung aus berufenem Mund die Aufgewühltheit ihrer Seele beschwichtigen.
Sie warf sich aufs Kokosfaser-Sofa, schleuderte die
Hausschuhe von den Füßen auf den Hanfteppich.
»Mancher Irregeleitete bildet sich ein, es ginge ihm etwas an Glück verloren«, predigte Pater Damasus, »wenn er sich nicht bedenkenlos einer billigen Form sinnlichen Genusses hingibt. Zwar gewinnt er dadurch eine flüchtige Scheinfreude, aber dafür büßt er mit der Entwertung seines eigentlichen Seins ...«
Nein. Es half nicht. Helianes Brüste fühlten sich schwerer an, die Brustwarzen hart wie Lakritz. Sie hatte gewünscht, die Beine von sich strecken zu dürfen, aber mittlerweile krampfte sich ihr Körper aus Sehnsucht geradezu zusammen, schmiegte sich um den Mangel, den ihre Arme nicht umfangen, ihre Schenkel nicht umschlingen konnten. Sie verzehrte sich nach der durch nur wenige Türen von ihr getrennten, fremden Gestalt, als würde sie sie längst so genau kennen, dass sie ihr wie eine verheißene Erfüllung zustand.
Mit der Eile verspäteten Tuns fuhr Helianes Hand unter den Rocksaum und ins Höschen. Ihre Furche schwoll von Hitze. Willig spreizten sich ihre Beine wie eine Schere. Sie hörte die Patriarchenstimme des virtuellen Predigers nur noch als Raunen, dem sich kein Sinn entnehmen ließ.
Zwischen Zeige- und Mittelfinger einer Hand klemmte sie den Kitzler. Mit drei Fingern der anderen Hand rührte sie in der Triefnässe ihrer Pforte, drückte die Forken allmählich tiefer hinein. Ihr Unterleib kreiste mit solcher Hingabe um das Bohren und Reiben der Finger, dass sie es selbst mit größter Willensanstrengung nicht hätte verhindern können.
Helianes Atemzüge beschleunigten sich, sie masturbierte mit aller Kraft, in ununterbrochener Folge schneller Stöße stemmte sie ihre Klemme den Lustspendern entgegen, indem ihre Pobacken mit Wucht das Sofapolster pufften.
Ihr Stöhnen steigerte sich zum Japsen, während sie sich zappelig auf dem Sofa wand, und bald, als der Kleister der Lust ihre Fingerspitzen umfloss, erlebte sie von Neuem das Gefühl glückseligen Zerschmelzens, sie klappte die Schenkel zusammen, krümmte sich um den Brennpunkt des Entzückens. In einer Brandung der Wonnetrunkenheit entspannte der Orgasmus ihre Glieder und senkte sie in eine Verfassung rauschhaften Gelöstseins.
Nach einem Weilchen stieß Heliane dennoch einen Seufzer des Kummers aus. Sie hatte keine E-Mail-Adresse des Nachbarn ausfindig machen können. Irgendwie war die Welt wieder einmal gegen sie.
»Gott gibt uns die Nüsse«, sagte Pater Damasus, »aber er knackt sie nicht.«
Was?
Heliane stutzte, setzte sich benommen auf, beugte sich vor. Sie zupfte den Rock zu den Knien hinab, obwohl die virtuelle Persönlichkeit des Internet-Predigers sie gar nicht sehen konnte.
Was? Was?
Entgeistert betrachtete sie Pater Damasus’ Curd-Jürgens-Gesicht. Er hatte an sie eine ganz private Mitteilung.
Gott gibt uns die Nüsse ...
Na freilich.
... aber er knackt sie nicht.
Nein. Ihr Lebtag lang hatte sie alle Nüsse allein knacken müssen.
Ach so.
Sie brauchte gar keine E-Mail-Adresse. Sie hatte die Möglichkeit, drüben an der Tür zu klingeln.
Voller satter Genugtuung schaut Broder seinem Samen nach. Der Schwall zerspritzt. Sprinkelt hinunter auf die 30 m tiefer gelegene Straße. Erleichtert zieht er den im Erschlaffen begriffenen Hobel unter der obersten Geländerstange hervor. Retourniert ihn in die Hose.
Die Abendluft ist lau und angenehm. Ein frisches Windchen, das nach Kfz.-Abgasen, Staub und dem Hefemief einer nahen Brauerei riecht, kühlt ihm den schweißigen Körper. Er beschließt, noch für eine Weile auf dem Balkon zu bleiben. Setzt sich in einen Korbsessel. Er muss nachdenken. Bis zur Videokonferenz um 22 Uhr hat er noch anderthalb Stunden Zeit.
Im Verlauf der Tage hat Broder immer stärker den Eindruck erlangt, dass die Existenz der Nachbarin seine Arbeit beeinträchtigt. Sie beflügelt seine Fantasie in stets kürzeren Abständen. Am hellen Tag hat er Lustträume. Infolgedessen wichst er zusehends häufiger.
Glücklicherweise haben Dr. Lubok und Dr. Schratz den Freud'schen Versprecher, der ihm vorgestern bei der Videokonferenz rausgerutscht ist, kommentarlos übergangen. Vermutlich angesichts des wichtigen Diskussionsstoffs als belanglos abgetan. Aber der Vorfall beweist, er ist geistig nicht mehr hundertprozentig bei seiner Aufgabe. Wegen Nachbarin.
Allerdings glaubt er, dass ihm eine viel heiklere Auseinandersetzung mit den zwei Institutskoryphäen bevorsteht. Dabei geht es nicht um einen irrelevanten sprachlichen Lapsus. Broder hegt nämlich den Verdacht, dass die Schwierigkeiten des NI-Projekts nicht aus der Molekülstruktur des Liganden resultieren. Sondern aus der elektromagnetischen Matrizenprägung.
Bloß durchblickt er die Zusammenhänge noch nicht. Beweisen kann er nichts. Manchmal hat er so eine Ahnung, als wäre er der Lösung ganz nah. Darum muss er in Ruhe überlegen. Es ist erforderlich, dass sein Gehirn mit Reibungslosigkeit und Luzidität funktioniert.
Die reinen Klänge japanischer Musikinstrumente harmonisieren sehr mit den bioelektrischen Strömen in seinen Hirnzellen. Begünstigen das diskursive Denken. Bringen ihn in den Zustand des kreativen Eustress.
Also geht er in die Wohnung und legt die CD mit japanischer Traditionsmusik ein. Den Kopfhörer auf den Ohren, kehrt er zurück auf den Balkon.
Am liebsten hört er Genroku hanami odori, Musik für zur Zeit der Kirschblüte übliche Tänze. Instrumente: Samisen, Koto, Taiko, Kokyu. 18. Jahrhundert.
Eine E-Mail-Adresse der Nachbarin hat er nicht entdeckt.
Offenbar benutzt sie auch kein WebTalk.
Ihr Bild drängt sich in die Molekülstrukturen und Datenmosaike des Wirkstoffdesigns. Unaufhaltsam. Mit aller Plastizität.
Soviel ihm aufgefallen ist, hat sie einen kurvigen Knackarsch. Prall wie ein Paar Kürbisse.
So etwas lässt keinen Raum für die Skizzenhaftigkeit molekularer Mechanismen. Neurotransmitter und Signalproteine sind reizlos im Vergleich zu solchen Halbkugeln. Virtuelle kombinatorische Chemie kann gegen eine lebendige Frau nicht konkurrieren.
Broder spürt, dass sich ihm der Sack zusammenzieht. Sein Schwengel neigt wieder zur Versteifung. Er fantasiert, dass er mit seinem Kolben der Nachbarin den Steiß spaltet. Durch kraftvolles Rammeln ihr Sitzfleisch zum Schaukeln bringt. Und dass sie beim Ficken schreit und kreischt. Dann kommt er nämlich besonders in Fahrt.
Er tupft sich Schweiß von der Nasenwurzel. Bombenschwer spannt ihm eine neue Erektion die Hose.
Es ist ihm unmöglich, sich auf die Probleme der Syntheseplanung zu konzentrieren. Nicht einmal die kristallklaren Töne der japanischen Lauten flößen ihm noch Gelassenheit ein.
Verdrossen hebt er den Kopfhörer von den Ohren. Tappt in die Wohnung. Entnimmt dem radarblauen Lloyds-Großraum-Cooler eine Flasche Weißwein. Entkorkt sie an der Rapid-Entkorkmaschine.
Ein Glas Wein in der Hand, bleibt Broder vor dem Elektronischen Aquarium stehen. Mit Pflanzen garnierter Lava-Hintergrund. Gemächlich ziehen Schmetterlingsfische in Knallgelb ihre Kreise. Flossenschlag um Flossenschlag. Hin und her. Und umgekehrt. Usf. Leuchten sogar im Dunkeln.
Der Wein ist gut gekühlt. Auch das Elektronische Aquarium strahlt Kühle aus. Vom Deckenventilator quirlt kühler Abwind herab.
Aber Broder ist dermaßen erhitzt, als wäre er gerade im Mikrowellenherd geschmort worden. Ihm gehen die Hinterbacken der Nachbarin nicht aus dem Sinn.
Es hat keinen Zweck. So kann er nicht nachdenken. Erst muss er noch einmal wichsen.
Er findet keinen Frieden mehr.
Plötzlich läutet die Dreiton-Türglocke. Verdutzt nimmt Broder die Hand vom Hosenreißverschluß. Er schlurft zur Tür. Hausmeister oder Vorwerk?
Durch den Spion erkennt er die Nachbarin. Aus Verdatterung erweicht sein Steifer. In Sekundenschnelle.
Mann, ist das Mädchen cool! Einfach bei ihm zu bimmeln. Genial.
Sein Herz wummert, als er die Tür öffnet. Diese Schicksalswendung kommt über ihn wie eine Lawine. Er wird völlig überrumpelt. »Entschuldigen Sie ... ich wollte Sie etwas fragen. Haben Sie einen DVD-Brenner? Ich habe da eine größere Anzahl Audiodateien gespeichert ...«
Sie hat wundervolle braune Augen.
Broder ist kein Besitzer eines DVD-Brenners. Jedoch trifft er in diesem Moment den Entschluss, unverzüglich so ein Gerät zu kaufen.
»Nein, nicht«, antwortet er. »Aber ich will einen anschaffen. Morgen hole ich so‘n Ding, dann packen wir Ihre Musik auf ‘ne Scheibe. Ich gebe Ihnen Bescheid, sobald er da ist. Sie können sich drauf verlassen.« Er merkt, dass er viel zu hastig spricht. Wohl aufgrund der wiederkehrenden Härte in der Hose. Er grinst und tritt beiseite. »Wie wär’s, wenn Sie reinkommen?«
Zuerst macht sie eine spontane Vorwärtsbewegung. Aber stockt. Schneidet eine undeutbare Miene. Wahrscheinlich packt sie jetzt Bammel vor der eigenen Courage. So was soll es ja geben.
»Danke, lieber nicht«, sagt sie. »Ich mag nicht stören.«
Und schon huscht sie lautlos fort.
Broder möchte sie an sich ziehen. In die Arme nehmen. Küssen. Die Brüste streicheln. Den Arsch kneten. Doch er bewahrt Beherrschung.
Geduld. Morgen.
Morgen wird er bei ihr klingeln.
Heliane weinte die ganze Nacht lang. Als zu tief und bitter empfand sie nach der Erleuchtung, die sie zu der Entscheidung verleitet hatte, gegenüber an der Tür zu läuten, die Enttäuschung.
Ihr war es zu banal gewesen, zum Vorwand etwa nach Selleriesalz oder Ähnlichem zu fragen. Stattdessen hatte sie sich nach dem Vorhandensein eines DVD-Brenners erkundigt, um das Ersehnte mit etwas Nützlichem zu verbinden. Schon seit Längerem hegte sie nämlich den Wunsch, Pater Damasus’ Internet-Predigten chronologisch auf einer DVD zusammenzufassen und - quasi als Anhang - um die WebChristen-Audio-Chatroom-Diskussion über das Thema zu ergänzen, ob Pater Damasus wirklich, wie seine Home-Page behauptete, per Internet-Anschluss das Wunder wirken konnte, Zahnamalgam in Zahngold zu verwandeln.
Aber über ihr Anliegen hatten sie erst gar nicht gesprochen. Zum Glück war ihr Blick noch rechtzeitig auf das heidnische Götzenbild gefallen, das im Flur, nur zwei, drei Schritte hinter der Tür, umwogt von Schwaden beißend-herben Räucherwerks, in infernalischem Glanz auf einer Kommode prunkte.
Wie entsetzlich! Ihr Nachbar war Neoheide.
Das Leben schlug sie mit einer Grausamkeit ins Gesicht, für die sie aus persönlicher Erfahrung bisher kein Beispiel kannte. Dicht vor ihm hatte sie gestanden, zum Greifen nah war sie ihm gewesen. Die Bitterkeit trieb ihr die Tränen in unaufhörlichen Rinnsalen zu den Augen hinaus, als genügte die Menge der Körperflüssigkeiten nicht, um den Schmerz fortzuschwemmen. Die Elektroemissionen seiner Wohnung hatten ihr schier die Haut versengt. Er hauste in einer Strahlenhölle. Und wie er geredet hatte ... eine wahre Logorrhö war ihm entsprudelt.
Das in ihrer Brust angestaute Weh brach sich nur nach und nach Bahn, in unregelmäßigen Schüben spien Schluchzer den Gram aus ihrer Kehle wie Auswurf.
Gott im Himmel! Beinahe hätte sie seine Wohnung betreten.
Doch selbst als ihre verpressten Laute des Leids verebbten, fand das Elend kein Ende. Ihr Körper widerstrebte den Einsichten der Seele. Es hatte keiner stärkeren Reize als des flüchtigen Nahseins bedurft, um ihren Leib zu einer Ballung unbezähmbarer Begehrlichkeit zu degradieren. In diesem Zustand strotzte sie geradezu von Saft und Kraft, sie masturbierte in immer kürzeren Abständen und biss dabei auf einen Zipfel des Kopfkissens, damit keine Lustschreie das ganze Haus weckten.
Es nützte nichts. Das Feuchtheiße zwischen ihren Schenkeln, egal wie oft sie es mit der Hand stopfte, klaffte ohne Aussicht auf Sättigung. Jedes Mal kam sie einer Ohnmacht nah, es schien ihr, als zerrissen gleichzeitig das Gewebe der Welt und das Gewirk der Hemmungen in ihrem Innern.
Indessen konnte die Sünde der Selbstbefriedigung, mochte sie auch zur Sucht werden, ihr nicht auf Dauer schaden, jede Computerbeichte läuterte ja ihr Gewissen von der Befleckung, und eine wirksamere Abhilfe als das Masturbieren wusste sie nicht. Einmal hatte sie sich – vor Jahren, als sie im Umgang mit der Sexualität noch andere Ansätze verfolgte – eine Nonnentracht geliehen und gehofft, ihr wäre darin rein und züchtig zumute; doch geschehen war das Gegenteil: Je keuscher sie sich fühlen wollte, um so stärker plagte sie der Wunschtraum, vergewaltigt zu werden (damals entjungferte sie sich mit einer O-Saft-Flasche), und im Ergebnis hatte sie aus Unbehagen per Mausklick vergewaltigungssichere Unterwäsche erworben.
Nein. Der Satan stellte ihr eine andere Falle.
Der Versucher, selbst ein Gefallener, verlockte sie mit einer anderen Art von Paradies, und sie schwebte in unmittelbarer Gefahr, seine Jüngerin zu werden. In ihrer vollkommenen Erniedrigung hätte sie alles getan, buchstäblich alles, um doch das Ziel ihres Verlangens noch zu erhaschen.