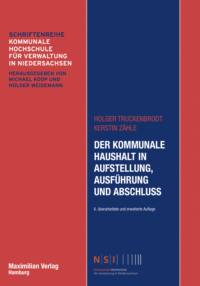Czytaj książkę: «Der Kommunale Haushalt in Aufstellung, Ausführung und Abschluss»


Vorliegende Ausgabe erscheint als Band 2 in der Schriftenreihe der
Kommunalen Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen, herausgegeben
von Prof. Dr. Michael Koop und Prof. Holger Weidemann.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.
6. überarbeitete und erweiterte Auflage
Redaktionsstand: 01.07.2020
eISBN 978-3-7869-1018-3
© 2020 im Maximilian Verlag GmbH & Co .KG, Hamburg
Ein Unternehmen der 
Alle Rechte vorbehalten.
Layout und Produktion: Inge Mellenthin
ePub Konvertierung: Datagrafix GmbH
INHALT
Vorwort
1 EINFÜHRUNG
1.1 Grunddaten und -begriffe
1.2 Haushaltsaufstellung
1.3 Haushaltsausführung und -abschluss
1.4 Kommunalverfassung
1.5 Finanzmittelbeschaffung in der Kommune
1.6 Grundlagen der Kosten- und Leistungsrechnung
2 HAUSHALTSPLANUNG UND -BEWIRTSCHAFTUNG
2.1 Aufstellung und Abrechnung des Haushalts – ein Haushaltskreislauf über mehrere Phasen
2.1.1 Aufstellungsphase
2.1.2 Beschlussphase
2.1.3 Erlassphase
2.1.4 Haushalts- und Kassenvollzugsphase
2.1.5 Abschlussphase
2.1.6 Prüfungsphase
2.2 Haushaltsplan – Aufbau, Inhalt und Bedeutung in Grundzügen
2.2.1 Grundlagen
2.2.2 Aufbau des Haushaltsplans
2.2.3 Bedeutung des Haushaltsplans
2.3 Haushaltssatzung – eine Satzung eigener Art (»sui generis«)
2.3.1 Aufstellung und Inhalte der Haushaltssatzung
2.3.2 Genehmigungsbedürftige Teile der Haushaltssatzung
2.3.3 Festsetzung des Haushaltsplans durch die Haushaltssatzung
2.3.4 Nachträgliche Korrekturen der Haushaltssatzung
2.4 Haushaltsplan – Aufbau, Inhalt und Bedeutung in Vertiefung
2.4.1 Erster Bestandteil des Haushaltsplans: Ergebnishaushalt
2.4.2 Zweiter Bestandteil des Haushaltsplans: Finanzhaushalt
2.4.3 Dritter Bestandteil des Haushaltsplans: Teilhaushalte
2.5 Mittelfristige Planung – eine Planung über das Haushaltsjahr hinaus
2.5.1 Integrierte mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
2.5.2 Investitionsprogramm
2.6 Haushaltsgrundsätze – historisch gewachsene Prinzipien
2.6.1 Stetige Aufgabenerfüllung
2.6.2 Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit
2.6.3 Haushaltsausgleich
2.6.4 Jährlichkeit
2.6.5 Haushaltseinheit
2.6.6 Vollständigkeit
2.6.7 Bruttoprinzip
2.6.8 Periodengerechtigkeit
2.6.9 Kassenwirksamkeit
2.6.10 Einzelveranschlagung
2.6.11 Haushaltswahrheit
2.6.12 Haushaltsklarheit
2.7 Deckungsregeln in der KomHKVO – Flexibilität in der Bewirtschaftung
2.7.1 Gesamtdeckung
2.7.2 Ausnahmen zur Gesamtdeckung (Zweckbindung)
2.7.3 Sachliche Bindung
2.7.4 Ausnahmen zur sachlichen Bindung (Deckungsfähigkeit)
2.7.5 Unechte und echte Deckungsfähigkeit
2.7.6 Zeitliche Bindung
2.7.7 Ausnahmen zur zeitlichen Bindung (Übertragbarkeit)
2.8 Vorläufige Haushaltsführung – Bewirtschaftungen in der haushaltslosen Zeit
2.8.1 Vorläufige Haushaltsführung nach dem NKomVG
2.8.2 Vorläufige Haushaltsführung nach Sondervorschriften
2.9 Budget – eine Bewirtschaftungseinheit
2.9.1 Grundlagen
2.9.2 Bewirtschaftungserleichterungen
2.10 Über- und außerplanmäßige Finanzvorfälle – Bewirtschaftungen abweichend vom Haushaltsplan
2.10.1 Grundlagen
2.10.2 Zulässigkeit über- und außerplanmäßiger Finanzvorfälle
2.10.3 Entscheidungsbefugnisse und Unterrichtungspflichten
2.10.4 Haushaltsvorgriff
3 BUCHFÜHRUNG UND BILANZIERUNG
3.1 Grundlagen
3.1.1 Grundbegriffe
3.1.2 Bilanzveränderungen durch Finanzvorfälle
3.1.3 Bestandskonten
3.1.4 Buchungssätze
3.1.5 Eröffnungs- und Schlussbilanzkonto
3.1.6 Ergebniskonten
3.1.7 Finanzkonten
3.1.8 Abgrenzung relevanter Begriffe im Rechnungswesen
3.1.9 Drei-Komponenten-System
3.2 Organisation der Buchführung
3.2.1 Kontenrahmen
3.2.2 Belegorganisation
3.2.3 Bücher der Finanzbuchhaltung
3.3 Sachvermögen
3.3.1 Anschaffungswerte
3.3.2 Herstellungswerte
3.3.3 Abschreibungen
3.3.4 Geringwertige Vermögensgegenstände
3.3.5 Verkauf von Vermögensgegenständen
3.3.6 Bestandsorientierte Beschaffung von Vorräten
3.3.7 Aufwandsorientierte Beschaffung von Vorräten
3.4 Zuwendungen
3.4.1 Gewährung
3.4.2 Empfang
3.5 Kommunale Abgaben
3.5.1 Steuern
3.5.2 Gebühren
3.5.3 Beiträge
3.6 Zahlungs- und Kreditbereich
3.6.1 Grundlagen
3.6.2 Anzahlungen und Abschlagzahlungen
3.6.3 Kredite
3.7 Personalbereich
3.7.1 Grundlagen der Gehaltsabrechnung
3.7.2 Buchung der Entgelte und Gehälter
3.8 Wirtschaftliche Betätigung einer Kommune
3.8.1 Umsatzsteuer
3.8.2 Buchungstechnische Ermittlung der Zahllast
3.8.3 Verkauf von Produkten
3.8.4 Handelswaren
3.8.5 Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
3.9 Jahresabschluss
3.9.1 Grundlagen
3.9.2 Sonstige Forderungen und Sonstige Verbindlichkeiten
3.9.3 Aktive und Passive Rechnungsabgrenzungsposten
3.9.4 Rückstellungen
3.9.5 Bewertung von Forderungen
3.9.6 Darstellung des Jahresabschlusses
4 KOSTEN- UND LEISTUNGSRECHNUNG
4.1 Kostenartenrechnung
4.1.1 Grundlagen
4.1.2 Neutrale Abgrenzungen
4.1.3 Kalkulatorische Abgrenzungen
4.1.4 Abgrenzungsrechnung
4.1.5 Weitere Kostenarten
4.2 Kostenstellenrechnung
4.2.1 Arten von Kostenstellen
4.2.2 Primäre Kostenverteilung
4.2.3 Sekundäre Kostenverteilung
4.3 Kostenträgerrechnung
4.3.1 Kostenträgerzeitrechnung
4.3.2 Kostenträgerstückrechnung
4.4 Teilkostenrechnung
4.4.1 Mängel der Vollkostenrechnung
4.4.2 Deckungsbeitragsrechnung (Direct Costing)
4.4.3 Stufenweise Fixkostendeckungsrechnung
5 FALLSTUDIE ZUR ANWENDUNG DES PLANUNGS- UND RECHNUNGSWESENS
5.1 Aufgabe
5.2 Lösung zur Fallstudie
6 ANHANG
6.1 Abkürzungsverzeichnis
6.2 Literaturverzeichnis
6.3 Abbildungsverzeichnis
VORWORT ZUR 6. AUFLAGE
Nach nunmehr fünf Auflagen ohne wesentliche Änderungen am Aufbau des vorliegenden Lehrbuchs haben wir die 6. Auflage zum Anlass genommen, um die formalen Strukturen des Buches noch nutzerfreundlicher zu gestalten.
Dies äußert sich beispielsweise an der neuen deutlich schlankeren Gliederung mit durchgehend nur noch drei Gliederungsebenen und einer kompakteren Darstellung der Beispiele insbesondere im Buchführungsteil. Im Haushaltsplanungs- und -bewirtschaftungsteil sind die Erfahrungen aus den Lehrveranstaltungen und den Prüfungen eingeflossen. Hierzu wurden die zentralen Themen der Fragestellungen aus dem Kreis der Lernenden und der Aufgabenstellungen in mündlichen und schriftlichen Leistungsnachweisen aufgegriffen und hinsichtlich der erforderlichen Subsumtion der Rechtsgrundlagen noch deutlicher dargelegt. Zudem wurden die verschiedenen Sachverhalte, bei denen sich eine Kommune wirtschaftlich betätigt, zu einem Kapitel zusammengefasst, um dem veränderten Stellenwert der wirtschaftlichen Betätigung durch die neue Gesetzeslage zur Umsatzsteuer besser gerecht zu werden.
Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, dass Lernende sich die Inhalte auch alleine noch besser aneignen können.
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in diesem Lehrbuch die gewohnte männliche Sprachform bei personenbezogenen Substantiven und Pronomen verwendet. Dies impliziert jedoch keine Benachteiligung des weiblichen Geschlechts, sondern soll im Sinne der sprachlichen Vereinfachung als geschlechtsneutral zu verstehen sein.
Abschließend möchten wir uns bei all jenen bedanken, die an der Erstellung dieses Buches mitgewirkt oder durch ihre Hinweise und Fragen die Weiterentwicklung angestoßen haben. Gerne würden wir aber noch stärker mit den Nutzern dieses Werkes in Kontakt treten. Wir bitten deshalb alle Leser, uns mitzuteilen, wenn Ihnen etwas gut aber auch weniger gut an dem Lehrbuch gefallen hat, denn nur durch konstruktive Kritik von Ihrer Seite können wir das Werk beständig weiter verbessern. Senden Sie doch einfach eine E-Mail an eine der folgenden Adressen:
Würzburg und Hannover, im Juli 2020
Holger Truckenbrodt und Kerstin Zähle
VORWORT ZUR 5. AUFLAGE
Auch die 4. Auflage dieses Lehrbuchs war deutlich schneller vergriffen, als ursprünglich erwartet, so dass eine Neuauflage erforderlich wurde.
Dies haben wir zum Anlass genommen, einige Sachverhalte und Beispiele zu überarbeiten und zu präzisieren, wo es uns sinnvoll erschien. Einzig das Kapitel zur Umsatzsteuer wurde aufgrund der neuen Gesetzeslage weitergehend verändert. Leider hatten sich aufgrund der umfangreichen Änderungen der letzten Auflage durch die Umstellung auf die neuen gesetzlichen Regelungen auch einige Fehler eingeschlichen, die wir bei dieser Neuauflage ebenfalls korrigiert haben.
Würzburg und Hannover, im Juli 2018
VORWORT ZUR 4. AUFLAGE
Bereits im Oktober 2016 wurde die Änderung des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) beschlossen, die auch viele Haushaltsvorschriften änderte. Im April 2017 wurden sodann die überarbeiteten Fassungen der Verordnung zur Ausführung des kommunalen Haushaltsrechts (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung -KomHKVO-) und des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) veröffentlicht. Allein durch die neue Bezeichnung der Verordnung (von GemHKVO zu KomHKVO) wird deutlich, dass die Änderungen substanziell sind, und deshalb auch unmittelbar Eingang in die Lehre finden müssen. Demzufolge war es uns ein großes Anliegen, bereits für das neue Schul- bzw. Studienjahr mit Beginn im August 2017 die Anpassungen auch in dieses Lehrbuch einzuarbeiten, damit es von den Lernenden als Grundlagenwerk für die kommunale Haushaltsaufstellung und -ausführung sowie für den Jahresabschluss in Niedersachsen problemlos eingesetzt werden kann.
Der bewährte Aufbau wurde vollständig beibehalten
Würzburg und Hannover, im August 2017
VORWORT ZUR 3. AUFLAGE
Nachdem die zweite Auflage Ende 2013 vergriffen war, wurde erneut eine Neuauflage erforderlich. Dies haben wir zum Anlass genommen, das Lehrbuch um den Teil Kosten- und Leistungsrechnung zu ergänzen, so dass nunmehr das Modul Rechnungswesen mit den drei Teilbereichen Haushaltsplanung- und bewirtschaftung, Buchführung sowie Kosten- und Leistungsrechnung vollständig abgedeckt ist. Damit haben sowohl die Studierenden im Bachelorstudiengang der kommunalen Hochschule in Hannover als auch die Teilnehmer in den VFA, AI, AII, BI und BII Kursen in ganz Niedersachsen und alle interessierten Praktiker in den niedersächsischen Kommunen ein eingängiges Lehrbuch, um sich die Grundlagen des Planungs- und Rechnungswesens erarbeiten zu können. Da die konkrete Umsetzung der Kosten- und Leistungsrechnung in den Kommunen gesetzlich nicht näher ausgeführt ist, liegt der Fokus in diesem Teil primär auf den grundlegenden Methoden. Ziel ist es, den Lernenden ein Grundverständnis der Kosten- und Leistungsrechnung zu vermitteln, so dass sie verstehen, welche Methoden in welcher Situation im kommunalen Umfeld zu einem sinnvollen Ergebnis führen können. Entsprechend der klassischen Begriffsverwendung wird auch hier von Kosten- und Leistungsrechnung gesprochen, obwohl die Leistungsrechnung nur an wenigen Stellen behandelt wird und die Kostenrechnung im Mittelpunkt der Darstellung steht.
Um die Übersichtlichkeit des gesamten Buches zu erhöhen, haben wir die Gliederung dahingehend verändert, dass der erste Teil die Einführung mit Einführungsbeispielen und die wesentlichen Grundbegriffe des kommunalen Planungs- und Rechnungswesens umfasst. Der zweite Teil ist der Haushaltsplanung und -bewirtschaftung gewidmet. Daran schließt sich die Buchführung mit den Grundlagen der Bilanzierung an und der neue vierte Teil behandelt die Kosten- und Leistungsrechnung. Ebenfalls neu ist der fünfte Teil. Hier haben wir eine Fallstudie mit Lösung konzipiert, in der die drei vorher behandelten Themen in einem umfassenden Beispiel behandelt werden, um die Zusammenhänge praxisorientiert in anschaulicher Form darzulegen.
Außerdem wurde der zweite Teil »Haushaltsplanung und -bewirtschaftung« zur Erhöhung der Anschaulichkeit an einigen Stellen grundlegend überarbeitet und auch im dritten Teil »Buchführung« wurden einige Aktualisierungen vorgenommen.
Hannover und Würzburg, im März 2014
VORWORT ZUR 2. AUFLAGE
Mit großer Freude haben wir bereits zu Beginn dieses Jahres feststellen können, dass die erste Auflage dieses Lehrbuchs vollständig vergriffen war und somit eine Neuauflage erforderlich wurde.
Dies haben wir zum Anlass genommen, um einige Änderungen vorzunehmen. Diese betreffen insbesondere den Aufbau, die Darstellung sowie die Aufnahme weiterer Übungsfälle mit ausformulierten Lösungen und weniger inhaltliche Aspekte. Zudem wurden im Buchführungsteil Abbildungen zur besseren Veranschaulichung zusätzlich eingefügt und im Planungsteil die bereits vorhandenen Abbildungen überarbe itet. Leider hatten sich in die erste Auflage auch einige Fehler eingeschlichen, die wir bei der Neuauflage ebenfalls korrigiert haben.
Hannover, im Juli 2012
VORWORT
Dieses Lehrbuch haben wir konzipiert, um Lernende bei dem Erwerb systematischer Kenntnisse im kommunalen Planungs- und Rechnungswesen für niedersächsische Kommunen zu unterstützen. Es richtet sich insbesondere an die Studierenden der Bachelorstudiengänge »Allgemeine Verwaltung« und »Verwaltungsbetriebswirtschaft« der Kommunalen Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen, die in den ersten beiden Trimestern die Grundlagen der kommunalen Haushaltswirtschaft, der Buchführung und der Kosten- und Leistungsrechnung erlernen. Daneben stellt es aber auch die Basisliteratur für alle Teilnehmer zur Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten, für die Lehrgangsteilnehmer der Angestelltenlehrgänge sowie für die Auszubildenden der Landeshauptstadt Hannover im Studiengang Verwaltungsfachwirt dar, wobei im Unterricht wegen des geringeren Stundenumfangs nicht alle Aspekte in der hier dargestellten Tiefe behandelt werden können.
Ziel des Lehrbuchs ist eine systematische Einführung in die wesentlichen Grundlagen und Zusammenhänge des kommunalen Planungs- und externen sowie internen Rechnungswesens, durch das auch Anwender in der Praxis einen fundierten Überblick über die Thematik erhalten. Auch die Rechtssystematik des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes und der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung wird vorgestellt. Das Werk enthält eine fachlich fundierte und didaktisch sinnvolle Erläuterung des Themas. Es erhebt gleichwohl keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann und soll auch die Arbeit mit einem Kommentar nicht ersetzen.
Insbesondere für Teilnehmer ohne Vorkenntnisse werden im ersten Kapitel die Grundlagen des kommunalen Planungs- und Rechnungswesens vorgestellt. Um diesen wichtigen Einstieg so anschaulich wie möglich zu gestalten und einen schnellen Zugang zum doppischen Haushaltswesen zu erhalten, werden die relevanten Begrifflichkeiten anhand eines familiären Haushalts erklärt und fortwährend Parallelen zum Haushalt einer Kommune gezogen. Darüber hinaus sind im ersten Kapitel eine Erklärung der notwendigen Grundbegriffe, die für den kommunalen Kontext im Haushalts- und Rechnungswesen erforderlich sind und eine Einführung mit Erläuterung der grundlegenden Begriffe und Verfahren der Kosten- und Leistungsrechnung zu finden. Das Kapitel zwei befasst sich mit der Haushaltsplanung und -bewirtschaftung, d. h. hier werden die grundlegenden Inhalte des Teilmoduls kommunale Finanzwirtschaft vorgestellt und angewandt. Im dritten Kapitel werden die Grundlagen der Buchführung systematisch erarbeitet. Dabei wird auf die in Niedersachsen zu verwendenden Konten nach dem niedersächsischen Kontenrahmen explizit eingegangen und buchungstechnische Sonderfälle werden eingehend behandelt, wobei das Ende dieses Kapitels die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallenden Vorgänge beinhaltet. Wann immer sinnvoll und möglich wird in den Beispielen ein Bezug zu der in Kapitel zwei behandelten Planungsphase gezogen. Dazu werden nach der Aufgabenstellung die relevanten Konten mit ihren Kontonummern aufgelistet. Danach wird dargestellt, wie der relevante Sachverhalt in den Haushalten zu veranschlagen ist, bevor zum Abschluss die erforderlichen Buchungen aufgeführt werden, sofern die Finanzvorfälle wie ursprünglich geplant umgesetzt werden. Ziel dieser Vorgehensweise ist es, den Lernenden durchgehend die Beziehungen zwischen der Haushaltsplanung und der buchungstechnischen Dokumentation der Umsetzung der einzelnen Finanzvorfälle zu verdeutlichen.
Wichtige Schlagworte und Begriffe sind in den einzelnen Kapiteln fett markiert.
Wie in einem Lehrbuch üblich, wird im Text weitestgehend auf die Angabe von Literaturquellen verzichtet. Die verwendete und darüber hinausgehende Literatur ist im Literaturverzeichnis aufgeführt. Lediglich bei wörtlichen Zitaten oder, wenn direkte Verweise auf bestimmte Literaturquellen sinnvoll sind, sind diese als Fußnote angegeben.
1EINFÜHRUNG
Das Planungs- und Rechnungswesen einer Kommune scheint für viele Bürger erst nur sehr wenig mit dem Alltag zu tun zu haben. Dies stimmt aber nicht wirklich, denn jeder von uns muss in seinem eigenen Haushalt mit knappen Geldmitteln auskommen und verwendet deshalb in der Regel fast täglich ganz intuitiv schon einige Methoden und Begriffe, die auch im Planungs- und Rechnungswesen einer Kommune Anwendung finden. Deshalb werden in diesem einführenden Kapitel zunächst einige wesentliche Grundbegriffe des Planungs- und Rechnungswesens anhand einer Familie und damit eines klassischen Familienhaushalts anschaulich dargestellt. Zudem werden einige Parallelen und Unterschiede zwischen einem familiären und einem kommunalen Haushalt aufgezeigt. Daran schließen sich erste grundlegende Informationen über die Kommunalverfassung mit ihren handelnden Organen an, und es wird die Frage geklärt, welche Möglichkeiten eine Kommune hat, sich Finanzmittel zu beschaffen. Abschließend werden noch die Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung als Teil des Rechnungswesens vorgestellt und wesentliche Zusammenhänge innerhalb des Planungs- und Rechnungswesens erläutert. So wird im Planungswesen mit geplanten Größen gearbeitet, d. h. es werden voraussichtliche Sollgrößen festgelegt (Ex ante Sicht). Im Rechnungswesen werden demgegenüber die tatsächlich erreichten Istgrößen erfasst und dokumentiert (Ex post Sicht).
Um die Orientierung in den Kapiteln zu erleichtern, haben wir die einzelnen wiederkehrenden Elemente im Lehrbuch mit folgenden Symbolen gekennzeichnet:
zeigt an, dass ein Gesetzestext folgt, der grau hinterlegt ist.
ist das Symbol für ein Beispiel mit Aufgabenstellung und Lösung, das ebenfalls grau hinterlegt ist.
weist auf das Ende eines Kapitels hin, das durch die eingerahmte Rubrik »Auf einen Blick« abschließt. Darin wird der Inhalt des vorangegangenen Kapitels in knapper und prägnanter Form wiederholt.