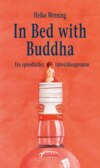Czytaj książkę: «Mein wunderbarer Wedding», strona 3
Haus Bottrop
Wenn man lange genug im Wedding wohnt, kennt man eigentlich die Regeln. Lungernde migrationshintergründische Jugendliche zum Beispiel – bei Sichtung weiträumig umschiffen, also Straßenseite wechseln, oder halt Dialog der Kulturen, wenn man gerade Zeit und Nerven für so was hat.
So gesehen ist es ein dummer Fehler von mir, als ich an einem Samstagabend auf dem Weg zu einem Haus Bottrop mache, für einen kleinen Benefiz-Auftritt zu Gunsten politischer Kiezaktivisten. So etwas mache ich gelegentlich, wenn mir die Leute sympathisch sind.
Eher teilautistisch gehe ich also erst über den »harten Beton des U-Bahnhofs Wedding« (Der Spiegel) über die Schönwalder Straße durch »eines der härtesten Krisengebiete unseres Landes« (Der Spiegel) und bemerke sie zu spät, die »Kids« (Der Spiegel). Sie gehen zu langsam, sodass selbst ich nicht umhin komme, sie zu überholen, was natürlich, das ist mir klar, unweigerlich Interaktion zur Folge haben wird. Egal, zu spät, so bleibt man wenigstens im Gespräch mit der Jugend. Alles verläuft erwartungsgemäß. Ich drücke mich vorbei an den Dreien, die vielleicht so um die 18 Jahre alt sind, unmotiviert über den Bürgersteig schlurfen und also offenkundig nichts mit dem Abend anzufangen wissen, derweil irgendwelches bushidoeskes Zeug aus ihrem Handy dröhnt. Der Erste, wohl der Boss des Trios, tänzelt mit irgendwelchen Hiphop-Bewegungen prompt neben mir her. Ich seufze unmerklich. Wir sind auf Höhe Schönwalder 31, das Haus Bottrop trägt die Nr. 4 – Mist. Das wird anstrengend. Zunächst reagiere ich, wie man es im Grundkurs »Berlin für Zugezogene« lernt: freundliches Ignorieren. Also nicht zu böse gucken, aber eben auch nicht drauf einsteigen, einfach weitergehen. Bis Nr. 29 greift die Strategie, dann hat der Bengel genug von seinen etwas kurios anmutenden Antanz-Versuchen mit den leicht gestört wirkenden zuckenden Arm- und Handbewegungen und eröffnet das, nun ja, nennen wir es halt: Gespräch. Zunächst die üblichen Versatzstücke über meine Figur, wobei ich »Moby Dick« sogar ganz originell finde. Offenbar habe ich es mit intellektuellen Ghetto-Bewohnern zu tun. Überhaupt wirkt der Junge nicht direkt unfreundlich, sein Grinsen hat etwas schwer auslotbares Dauerironisch-Spöttisches, nichts Aggressives.
»Moby Dick!«, ruft er zum wiederholten Mal. Nr. 25.
»Ja, Queequeg«, antworte ich, aber ganz so weit her ist es dann wohl doch nicht mit seiner Literaturkenntnis, er schaut kurz verständnislos, dann fährt er fort.
»Moby Dick!« Nr. 23. Ich gehe weiter.
»Ey, wir sind voll die Ghetto-Kids!«, stellt er sich und seine Freunde nun erst einmal vor – immerhin höflich also, die jungen Herren.
»Ja, klar, seh ich doch«, erwidere ich.
»Ey, voll die Ghetto-Kids! Voll perspektivlos, weißtu?« Er grinst wieder ironisch unter seinem weißen Baseball-Cap.
»Ja sicher. Schön.«
»Ey, nix schön! Voll das Ghetto!«
»Ja, ich weiß. Ich wohne hier auch.«
»Hier? Aber ich hab dich noch nie gesehen hier!«
»Ja, nicht direkt hier. Mehr so Müller/Ecke See.«
»Müller/Ecke See? Ey, das ist doch anders. Krasse Spießergegend. Hier ist voll das Ghetto!« Anklagend zeigt er auf die Nr. 19, ein eher unauffälliges Durchschnittshaus.
»Ja gut«, gebe ich mich kompromissbereit.
Er grinst weiter: »Ey, das ist ein Überfall.«
»Ja sicher«, sage ich und gehe weiter.
»Ey, das ist ein Überfall, weißtu? Wir sind voll die krassen Ghetto-Kids, und das hier ist ein verfickter Überfall. Gibstu jetzt Portmonee und Handy!« Er grinst weiter freundlich.
Nr. 15, die Sache wird mir allmählich unheimlich. Einerseits: Die Jungs sehen definitiv nicht so aus, als wäre die Situation irgendwie bedenklich. Der Anführer guckt freundlich-ironisch, die anderen beiden gehen eher versetzt hinter mir. Der Zweite versucht, so cool wie möglich zu wirken, was offenkundig seine gesamte Konzentration in Anspruch nimmt, dem Dritten dagegen scheint die Sache eher peinlich zu sein, was er durch gelegentliche Grunzlaute zu kompensieren sucht. Zusammengefasst sehen sie also nicht gerade furchteinflößend aus. Einerseits. Und andererseits steht es einem dann doch plötzlich vor Augen, das Bild vom Wedding-Adoleszenten »südländischen Aussehens« aus der B.Z. und dem Spiegel. Klar, jahrelang habe ich mich lustig gemacht über die Ghetto-Panikmache, über die Katastrophengebietskarikaturen der Medien, über das Gerede vom gefährlichen Wedding. Und nun stehen drei dieser Abziehbilder plötzlich vor mir und legen noch eins drauf:
»Ey, wir sind bewaffnet, Mann!«
Tja. Das sieht aber gar nicht danach aus. Andererseits, wer weiß schon, was die unter ihren merkwürdig aufgeplusterten Jacken immer so tragen.
»Ey, gibstu jetzt Portmonee!« Klar in der Sache, aber immer noch nicht unfreundlich im Tonfall. Entweder habe ich hier die höflichsten kriminellen Homies des Kiezes Reinickendorfer Straße vor mir, oder eben einfach gelangweilte migrationshintergründische Jugendliche, die genau wissen, was in den Medien so über gelangweilte migrationshintergründische Jugendliche steht und was demnach Leute wie ich sofort für Bilder über gelangweilte migrationshintergründische Jugendliche im Kopf haben, und mein Gesprächspartner will nur mal die Klischees ein bisschen tanzen lassen, sozusagen eine Art Meta-Pöbeln. Aber was, wenn die es tatsächlich ernst meinen? Nr. 12.
»Ey, glaubstu nicht, aber das ist ein Überfall. Gibstu jetzt Handy und Portmonee!«
»Ich habe überhaupt kein Handy.«
Das verwirrt ihn einen kurzen Moment, man sieht deutlich, dass diese Möglichkeit in seiner Vorstellungswelt gar nicht vorkommt.
»Wie? Hastu vergessen, oder was? Hastu Handy vergessen?«
»Nee, ich hab einfach keins.«
»Kein Handy?« Er ist kurz fassungslos, fängt sich aber schnell wieder.
»Tja, Pech, kannstu nicht mal Polizei rufen nach Überfall gleich.«
Punkt für ihn.
»So, komm, gibstu jetzt Portmonee.«
Jetzt kommt die blöde Panke, die irgendwelche irren Stadtplaner hier nicht unter die Erde verlegt, sondern mit so einem bekloppten Naherholungsgrünstreifen umsäumt haben, ein paar Meter nur, aber eben ein paar Meter, wo man jemand schön ins dunkle Gebüsch zerren könnte, von der Straße weg, was ein Überfallszenario doch erheblich realistischer erscheinen lässt, verdammt, hat er das etwa mit einberechnet?
»So, und jetzt Portmonee.«
Die bekloppten Stadtplaner haben genau bei der Panke-Brücke samt Grünstreifen auf jede Straßenbeleuchtung verzichtet, sehr pfiffig. Wahrscheinlich haben sie gedacht, dass nachts eh keiner mehr am Fluss entlang läuft, wozu dann also Licht. Oder das ist irgendeine irre Naturschutzmaßnahme, damit die Fische nicht geblendet werden. Oder die Schildkröten nicht abgelenkt, wenn sie zur Eiablage an den Pankestrand kriechen. Wie dem auch sei, die Straße wird merklich dunkler, und gleich wirken die Jungmänner einen Zacken bedrohlicher. Niemand sonst ist zu sehen. Auf der anderen Seite leuchten die Wohnsilos, eines davon muss die Nr. 4 sein – verdammt, die meinen das doch nicht etwa ernst? Und überfallen mich hier gerade? Mich!?!
Ich merke, dass ich die bloße Möglichkeit, ich könnte überfallen werden, hier, mitten im Wedding, als persönliche Beleidigung empfinde. Das können die doch nicht machen!
»Hört mal zu, Jungs«, der Fluss ist überquert, wir bewegen uns auf dem jenseitigen Grünstreifen auf die nächste Laterne zu, »ich soll hier bloß ein paar Geschichten vorlesen, das ist alles, ein paar Geschichten, hört ihr?«
Mein Gegenüber ist erneut offenkundig irritiert, mit dieser Ansage kann er erkennbar nichts anfangen. Daher ergänze ich: »Auf so einer Feier. Von irgendwelchen Leuten, die hier im Kiez was politisch machen, versteht ihr?«
»Politik? Achtu Scheiße. Bistu CDU, oder was?«
»Seh ich so aus?«
»Keine Ahnung«, er mustert mich eindringlich, »nee, du siehst einfach nur scheiße aus.«
Jetzt werde ich doch langsam unwirsch. »Hör mal ...«, hebe ich an.
»Schon gut, ich mein nur, ey, guck mal: Deine Hose, deine Jacke, was ist denn das für ein Outfit? Das ist doch voll kein Styling! Das sieht doch krass scheiße aus! So kannstu nicht auf ’ne Feier gehen.« Das hätte meine Mutter ganz ähnlich formuliert. Jetzt bin kurz ich etwas fassungslos.
»Politik!«, sagt jetzt verächtlich der schweigsame Coole, sein erster Beitrag zu unserer langsam etwas ausufernden Konversation, »da gibt’s doch keine geilen Weiber!«
»Nee, wahrscheinlich nicht«, pflichte ich ihm leicht resignierend bei.
»Bistu schwul, oder was?«, sagt der Anführer und setzt sofort nach: »Ey, das ist doch voll eklig, wenn Männer so an sich rummachen!« Er weiß, was von ihm als korrekten Migranten erwartet wird, er grinst genau so, dass man sieht, dass er das weiß, und ich weiß doch nicht, was er will. Außer womöglich Geld, aber selbst das weiß ich ja nicht sicher, jedenfalls aber wird er nun etwas redundant: »Gibstu jetzt Portmonee«.
Wir haben den Pankestreifen inzwischen passiert, auf der anderen Straßenseite leuchtet die Nr. 5, ein 70er-Jahre-Betonwohnsilo, ich zeige rüber und sage, dass ich da irgendwo hin muss, zur Nr. 4.
»Das ist dahinter«, sagt mein Gesprächspartner, »komm, wir zeigen’s dir.« Sie deuten auf einen kleinen, schmalen eher dunklen Gang. Verdammt, ist das jetzt eine Falle? Aber langsam ist mir alles egal. Ich komme mit. Wir laufen an dem Mietshaus vorbei, dahinter taucht tatsächlich die Nr. 4 auf, Haus Bottrop steht in großen bunten Buchstaben an die Wand gemalt, davor stehen einige Menschen, es ist geschafft.
Meine drei Begleiter gackern laut auf und verabschieden sie sich artig – per Handschlag. Dann verschwinden sie im Durchgang zwischen zwei weiteren Betonwohnsilos. Verwirrt betrete ich Haus Bottrop.
Entfesselte Leidenschaft
Es gibt ja so Abende, da läuft’s einfach. Ich weiß nicht, was sie an mir gefunden hatte, und ehrlich gesagt war mir auch nicht ganz klar, was ich an ihr und wie wir uns gefunden hatten, aber jetzt war es halt so, wir saßen im Taxi, und da der Wedding erheblicher näher an eben jenem seltsamen Kleinkunstclubkeller als Karlshorst lag, waren wir nun also auf dem Weg zu mir. Eigentlich habe ich in solchen Situationen immer Wert darauf gelegt, genau das zu vermeiden, denn meine Wohnung ist, nun ja, nicht wirklich, sagen wir: affärenkompatibel. Bei echten Liebschaften – kein Problem. Im Gegenteil: Ein zuverlässiger Indikator, ob es lohnen könnte, sich überhaupt näher auf eine Frau einzulassen, war eigentlich immer ihre Reaktion auf meine Wohnung.
Wer da schon komisch guckte, irgendwas murmelte in Richtung »hier müsste man aber mal richtig durchputzen« oder gar ein wenig quiekte, wenn sie auf meine Leguane stieß, die ich in durchaus ansehnlicher Zahl dort pflege, konnte zuverlässig als untauglich sofort wieder entsorgt werden. Wie überhaupt mal eine Wahrheit festgehalten werden muss: Frauen, die sich vor Kriech- und Krabbeltieren ekeln, sind schlecht im Bett. So. Sagt ja sonst keiner, wenn ich es nicht tue.
Apropos Bett, dann mal weiter in eben dieser Geschichte. Die Ausgangslage war also klar, Karlshorst wirklich indiskutabel, und an den Echsen konnte ich sie leicht vorbeischleusen. Diese Bekanntschaft hatte ohnehin längst einen Stand erreicht, der ausschloss, dass wir zunächst eine Wohnungsbesichtigung durchführen mussten. Denn wenn schon in der Kneipe die Knutscherei mit eifrig unter den Textilien grabbelnden Händen endet, ist der Weg nach der Ankunft doch vorbestimmt. Vermutlich gibt es eine Art DIN für diese Fälle. Wohnungstür aufschließen, noch beim Zudrücken wildes Küssen, und mindestens ein paar Kleidungsstücke müssen bereits hier ungeordnet zu Fall gebracht werden, sonst gilt es nicht. Wir beschränkten uns auf die Jacken, ihren Pullover und meinen Gürtel, dann quiekte sie plötzlich auf, und zwar genau so, als hätte eine doofe Frau einen meiner Leguane gesehen. Ich kenne die diversen Varianten des doofe-Frau-sieht-tolles-Tier-Quieken ziemlich gut. Ich hoffte inständig, dass mir keiner meiner Pfleglinge am Nachmittag bei der Fütterung entwischt war und jetzt auf ein spontanes Sonnenbad unter der gerade aufgegangenen Lampe im Flur hoffte. Ich ließ also von ihr, guckte prüfend, was los sein könnte, da quiekte sie noch mal und deutete auf etwas sehr Kleines, Flatterndes, ah, jetzt konnte ich es erkennen – eine Motte. Eine Motte! Sie quiekt wegen einer Motte. Damit war ja immerhin schon mal geklärt, dass dies hier maximal ein One-Night-Stand würde, vielleicht reichten ja auch ein paar Stunden, machte ich mir Mut, die S-Bahnen nach Karlshorst fahren ja schließlich die ganze Nacht. »Ih, eine Motte!«, unterstrich sie ihre Disqualifizierung.
Nun ist es ja so: Motten sind mir schnurz. Ich meine, es ist schön, dass es sie gibt, aber ich habe kein besonderes Interesse an ihnen. Und Kleidermotten finde ich lästig. Aber auch nicht so lästig, dass ich großen Ehrgeiz aufbringe, sie loszuwerden, was zu einer recht stabilen Kleidermottenpopulation in meiner Wohnung geführt hat. Nun trage ich eigentlich gar keine Kleidung, die für Kleidermotten von Interesse sein könnte, die haben ja doch einen recht speziellen Geschmack. Woher die gerade recht florierende Population also ihre Nahrungsgrundlage bezog, war mir völlig unklar, aber auch gleichgültig. Sie flatterten halt nachts hier und dort rum, und ich machte schnapp mit der Faust, wenn mir eine zu nahe kam – mehr hatten wir nicht miteinander zu tun, die Motten und ich. Dementsprechend machte ich auch jetzt schnapp, und das Mottenproblem war gelöst. Und die Karlshorsterin ließ im nächsten Moment ihren BH von sich abtropfen. Die Sache hatte also keine negativen Auswirkungen auf die weitere Abendgestaltung. Ich war zufrieden. Allerdings leitete ich sie jetzt doch schnurstracks ins Schlafzimmer, um ein Zusammentreffen mit weiteren Tieren sicher zu vermeiden.
Dort angekommen, zog sie sich zu meiner Überraschung umstandslos komplett aus. Damit hatte ich nun nicht gerechnet. Also, im Ergebnis schon, aber die DIN-Vorschriften für solche Nächte verlangen ja doch eher nach gegenseitigem Entkleiden während leidenschaftlichem oder zumindest leidenschaftlich gespieltem Geknutsche, einfaches Ausziehen ist ja eher was für fest Liierte, die keine Zeit mehr mit sinnlosem Drumrum verlieren wollen, weil sie danach noch die Spülmaschine ausräumen müssen. Darum ging es aber nicht, wie sich im nächsten Moment zeigte. Sie forderte mich auf: »Los! Verbind’ mir die Augen!«
Also – so schlimm sah es nun auch wieder nicht aus. Aber ehe ich weiter darüber nachdenken konnte, präzisierte sie: »Los! Verbind mir die Augen und fessle mich!« Hupps. Na, das ging ja ordentlich zur Sache hier. Das steht aber nicht in der Erste-Nacht-Verordnung. Aber andererseits, hey – das hier ist Berlin, da hat man nicht einfach nur Sex, wenn man abends mal wen abschleppt, wir sind hier ja schließlich nicht in Braunschweig oder Heidelberg oder Stuttgart, nein, hier ist Szene, hier ist hip, hier ist postmodern, hier ist halt Fesseln und Augenverbinden zum Kennenlernen. Also gut, meinetwegen. Ich hatte vorhin schließlich schon irgendwelche merkwürdigen In-Cocktails getrunken, da konnte ich jetzt auch gleich so weitermachen.
Einzig: womit die Augen verbinden? Woran fesseln? Ich wollte nun auch nicht zu mauerblümchenmäßig dastehen, also klar, Fesseln, wo habe ich sie nur gleich hingeräumt, die Fesseln, ähm – da! In einer Ecke auf einem kleinen Wäschehäufchen lag noch dieser Schal, den meine Mutter mir zu Weihnachten gestrickt hatte. Den schon mal fix über die Augen gebunden, dann konnte ich mich immer noch in Ruhe nach Fesseln umsehen. Ohne zu zögern schnappte ich mir also den Schal, nahm die mir hier ja offenkundig zugedachte Rolle als dominanter Kerl an, presste das Teil vor ihr Gesicht, zog kräftig an und machte zwei feste Knoten. Sie stöhnte lustvoll auf dabei. Oha. Na, das konnte ja heiter werden. So, sie jetzt erst mal aufs Bett gestoßen, ein bisschen ruppiger als nötig, sie stöhnte erneut, dann hauchte sie: »Fessle mich! Los, bitte, fessle mich!« Aber womit denn, verdammt, womit bloß? »Ruhe!«, herrschte ich sie an und traf damit offenbar genau den Ton, der hier erwartet wurde, sie wand sich vor Wonne, während ich mich fieberhaft umsah. Na ja, nicht besonders erotisch, aber was soll’s, sie sah es ja nicht, also nahm ich ein paar dieser komischen karierten Spültücher, das würde schon gehen. Die Dinger fix um ihre Handgelenke gebunden, dann um den Rahmen vom Lattenrost, na also.
So lag sie nun da, in doch recht eindeutiger Pose, die sie durch ihre Beinpositionierung noch unterstrich, wand sich weiter dabei und hauchte: »Fick mich! Los, fick mich!« Also, ich weiß ja nicht. Das ist nun wirklich eher nicht so mein Stil. Kurz überlegte ich, ob ich sie nicht auch gleich knebeln sollte, ganz oder gar nicht, könnte ich dann sagen. Aber Knutschen tät’s vielleicht ja auch, also los.
Es ging nun also recht schnell seinen vorgezeichneten Gang, viele Möglichkeiten gibt es ohnehin nicht, zwei Körper sinnvoll auf einem Bett anzuordnen, von denen einer gefesselt auf dem Rücken und der andere nur mäßig gelenkig ist, wenn man dabei auch noch die Münder aufeinander pressen muss. Und wenn man einmal damit angefangen hat, macht es ja eigentlich meistens auch Spaß.
Wir waren also schon recht kräftig dabei, als mir plötzlich über all das Gekeuche und Geruckel eine sonderbare Bewegung aus den Augenwinkeln auffiel. Was war das denn? Einen Moment brauchte ich, um mich zu orientieren – sie interpretierte mein plötzliches Innehalten wohl als besonderen liebhaberischen Kniff und ohmmte ein wenig genießerisch – da, tatsächlich, da bewegte sich etwas. Und zwar irritierenderweise kurz vor ihrer Stirn, auf ihren Augen sozusagen, zweifelsfrei – eine Made, die sich in erhöhtem Madentempo vom geschätzten unteren Augenlid Richtung Nasenwurzel bewegte und unweigerlich auf die nicht textilbedeckte Stirn zusteuerte. Einen kurzen Moment war ich wie gelähmt, dann schossen mir blitzschnell einige ungeordnete Gedankenfetzen durch den Kopf, etwa so: ach du Scheiße – was ist das denn? – oh, oh, das geht bestimmt nicht gut – wenn sie schon bei einer Motte – und jetzt eine Made – sie darf auf keinen Fall was merken – verdammt ...
Ihr Ohmmsen wurde schon etwas ungeduldiger, also bewegte ich mich ein bisschen, sie stöhnte auf, gut, jetzt konnte ich erst mal wieder innehalten und weiter nachdenken. Aber – au weia, ohne Frage: Eine zweite Made krabbelte in Höhe ihrer rechten Schläfe und steuerte direkt auf die Haare zu. Was um Himmels Willen ... – plötzlich wurde es mir schlagartig klar: Das sind keine Maden, das sind Raupen. Mottenbabys! Der Wollschal – da also war die Wiege meiner Kleidermottenpopulation. Mensch, da hätte ich ja auch wirklich schon mal eher drauf kommen können. Guck mal, da haben wir ein praktisches Problem schon wieder gelöst. Da musste ich ja nur den ollen Schal wegwerfen, und schon wäre ich die Plagegeister los. Einerseits. Andererseits hielt meine Freude über diesen kleinen Teilerfolg auf dem immerwährenden Hindernislauf des Lebens sich doch arg in Grenzen, denn ein anderes Problem war dadurch ganz offenkundig gerade erst entstanden: Wie kam ich schadlos aus dieser Geschichte hier wieder heraus? Zumal Raupe Nr. 1 jetzt kurz vor ihrer Stirnpartie angekommen war, nicht auszudenken, wenn sie bemerken würde, dass das Tierchen dort anlandete. Es wirkte ziemlich hektisch, das kleine Kerlchen, in der ganz typischen Raupenmanier, bei der man diese kleine Welle durch den winzigen Körper laufen sieht, es hatte ein kleines, dunkel abgesetztes Köpfchen – ganz niedlich, eigentlich. Vielleicht noch 3 cm. Ich konnte sie ja schlecht mit dem Finger wegschnipsen, das wäre dann doch eine Änderung der Bewegungsabläufe, die eher nicht mehr als kamasutrische Finesse durchginge, 2 cm noch, einer, gleich würde sie die offene Stirn betreten. Hör auf, Raupe, komm zurück, jetzt – verdammt. Es gab nur eine Möglichkeit. Die Raupe war unmittelbar vor der Stirn, da schnappten meine Lippen zu. Insekten sollen ja gesund sein. Oh, da war schon der nächste Kriseneinsatz nötig, Raupe Nr. 2 schickte sich an, das unter dem Schal lugende Ohrläppchen zu betreten, da half nur die Zunge. Wie ein Chamäleon, dass seine Beuteinsekten mit dieser langen Klebezunge abschießt, hinderte ich die Raupe an ihrem finalen Fehltritt, bugsierte sie direkt zu ihrem Kumpel in meinem Magen und bohrte zur Gesichtswahrung schnell noch meine Zunge in ihr Ohr, was sie mit einem leidenschaftlichen Seufzer quittierte – Glück gehabt, das kommt ja mal so und mal so an. Als ich damit fertig war und also dachte, dass es nun endlich ungestört weiter gehen könne, fielen mir Nr. 3 und 4 auf. Die eine hatte es in die Haare geschafft, die andere krabbelte bereits auf ihrem Kinn herum und war zum Glück offenbar noch nicht aufgefallen, die ganze Sache weitete sich zusehends in so eine Ableck-Nummer aus, ich schleckte und schnappte an allen Ecken und Enden, verdammt, wie viele von diesen Drecksviechern hatten sich denn da eingenistet?
Irgendwie musste ich die Sache jetzt allmählich mal zu Ende bringen, ich beschleunigte also auf allen Fronten. Sie schien meine zunehmend panisch-unkoordinierten Körperbewegungen als blanke Ekstase misszuverstehen und kam mit einem lauten Schrei. Dabei zuckte sie mit dem Kopf nach oben, verdammt, jetzt sah ich, dass unter ihrem Kopf bestimmt ein Dutzend Raupen aufgeschreckt in alle Richtungen stob. Ich simulierte einen Orgasmus, als würde ich mich als Schauspieler in einem extrem schlechten Pornofilmchen verdingen, mit viel Gezucke, Geröchel und Gegrabbel, vor allem an, um und unter ihrem Kopf, wobei mein einziges Interesse darin bestand, die blöden Raupen von der Matratze zu fegen. Gut, jetzt war keine mehr zu sehen. Mit einem forschen Handgriff streifte ich noch den Schal ab und pfefferte ihn in die entgegengelegendste Ecke des Zimmers – uff, geschafft.
Erleichtert, gelöst und erschöpft, wie selbst der beste echte Orgasmus es nicht hätte bewirken können, sank ich neben ihr nieder, löste ihre Fesseln und atmete tief durch. So lagen wir beide postkoital schweigend nebeneinander, aber dachten vermutlich sehr unterschiedliche Dinge.
Darmowy fragment się skończył.