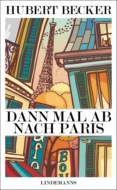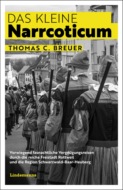Czytaj książkę: «Stillstände»

Götz Großklaus, geboren 1933, Dr. phil. Prof. em. für Neuere Deutsche Philologie an der Universität (TH) Karlsruhe; Studium der Germanistik, Geschichte und Philosophie; Staatsexamen an der Universität Hamburg; Promotion an der Universität Freiburg; Habilitation an der Universität Karlsruhe (TH); Mitbegründung und kollegiale Leitung des Instituts für Angewandte Kulturwissenschaft an der Universität Karlsruhe (TH) (1983 – 1990); Assoziierter Professor für Mediengeschichte an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe; Gastprofessuren an der Cairo University (1974 – 1976), der University of Melbourne (1983) und der Universität Istanbul (1995). Hauptarbeitsgebiete: Vergleichende Literaturwissenschaft, Kultursemiotik, Mediengeschichte und -theorie. Zahlreiche Veröffentlichungen zu Natur-Raum, Medien-Zeit, Medien-Raum, Medien-Bildern, zur Kulturgeschichte der Natur sowie zur Literatur in einer industriellen Kultur. Letzte Buch-Veröffentlichungen: „Heinrich Heine. Der Dichter der Modernität (2013)“, „Das Janusgesicht Europas. Zur Kritik des kolonialen Diskurses“ (2017).
Götz Großklaus
Stillstände
Das Gedächtnis der Kriegskinder
1939 – 1989
Lindemanns
Vorwort
Wenn man von der Generation der „Kriegskinder“ sprechen will, hat man zumeist die zwischen 1930 und 1940 Geborenen vor Augen; schon des Öfteren wurde sie als die vergessene Generation bezeichnet und zwischen der prominenten Generation der schon zum Wehrdienst einberufenen sog. „Flakhelfer“ und der zahlreichen Generation der Nachkriegskinder kaum wahrgenommen.
Aus der Perspektive eines dieser „Kriegskinder“ schildert der vorliegende Text in neun exemplarischen Episoden Schlüssel-Erlebnisse, wie sie für diese Generation typisch und prägend waren. Versucht wird, in Thematisierung bestimmter lebens- und zeitgeschichtlicher „Stillstände“ so etwas wie Wendepunkte und Zäsuren sichtbar werden zu lassen, von denen aus die individuelle und die kollektive Geschichte einen anderen Verlauf nehmen sollte.
Die autobiographischen Lebensstationen stehen somit exemplarisch für Lebens-Stationen einer ganzen Generation zwischen den Jahren 1939 und 1989: dem Kriegsausbruch und dem eigentlichen Kriegsende mit der Wiedervereinigung der beiden deutschen Teil-Staaten.
Götz Großklaus
Karlsruhe, im November 2020
Im Schein der Wintersonne
22. Februar 1944
Die Piloten und Besatzungen der die kleine Stadt am Nordrand des Harzgebirges anfliegenden B17-Bomber der 8. US-Air Force hatten an jenem 22. Februar des Jahres 1944 – einem sonnigen, wolkenlosen Wintertag – eine herrliche Sicht auf die schwarzen Harzwälder, den leuchtenden Gipfel des Brockens und auf die vor ihnen auftauchenden Umrisse einer menschlichen Siedlung – ihr „target of opportunity“.
Zu diesem Augenblick stand er auf dem Balkon des großväterlichen Hauses in Wernigerode am Harz – über sich den von Kondensstreifen zerfurchten Himmel – sein Blick von oben in die Weite der nördlichen Tiefebene und auf die Altstadt unten im Tal – Straßen und Dächer mit einer leichten Schneedecke im Schein der Wintersonne – für viele Stadt-Bewohner werden das die letzten Augenblicke und Minuten ihres Lebens sein.
Seit die Stadt Wernigerode zur Lazarettstadt deklariert und einige Dächer mit dem „Roten Kreuz“ gekennzeichnet worden waren, wähnte man sich in trügerischer Sicherheit. Auch die letzte der Sirenen hatte zu dieser Mittagsstunde gegen 14 Uhr im Konzert aller Sirenen schon längst ihr Entwarnungsgeheul absinken und langsam verklingen lassen.
Aufgeschreckt durch das plötzlich in diese Stille einbrechende Dröhnen von Flugzeugmotoren nahm er ein metallisches Aufblitzen am Himmel wahr, in Sekundenbruchteilen gefolgt von einem pfeifenden, dann fauchenden Geräusch, dem Donnerschlag einer Detonation und dem augenblicklich über der Altstadt aufsteigenden Rauchpilz. Das Haus des Großvaters erbebte in seinen Grundfesten. In Panik war er die Treppen hinuntergestürzt in den Keller. Er verharrte dort regungslos wie betäubt im Stillstand. Der Zehnjährige wusste nicht, wie ihm geschehen war. Der äußersten Beschleunigung, in der die Schockmomente des anschwellenden Dröhnens, des blendenden Blitzes, des grellen Pfeifens, des sich dem ganzen Körper mitteilenden Bebens der Detonation, der augenblicklich atmosphärischen Verdüsterung durch den sich aufblähenden Rauchpilz aufeinander folgten, war sein Wahrnehmungsvermögen nicht gewachsen: Sein Hirn wiederholte ihm das Sekundengeschehen in der quälenden Dehnung eines Zeitlupenfilms – und legte eine tiefe Gedächtnisspur. Erst nach und nach, als die Betäubung wich und die Wiederholung ausblieb, gelang es ihm, die einzelnen Schockmomente in die Momente eines zusammenhängenden Geschehens zu übersetzen: Offenbar waren gegen alle Erwartung in der Entwarnungszeit aus heiterem Himmel Flugzeuge über der Stadt erschienen, deren metallische Körper es waren, die im Lichte der Wintersonne kurz aufblitzten, während gleichzeitig die metallische Bombenlast pfeifend und fauchend niederging und die Explosionen jenen Rauchpilz aufsteigen ließen, der einen schon nicht mehr heiteren Himmel, der seine Unschuld längst verloren hatte, vollends verdüsterte.
Durch die geöffnete Kellertür starrte er auf die dichte Rauchdecke, die jetzt über der Stadt lag. In seiner Vorstellung musste alles Leben unter dieser Decke erstickt sein, die Stadt in Schutt und Asche versunken sein. Er empfand keine Angst. Die Plötzlichkeit und die rasende Geschwindigkeit der Gewalteinwirkung ließen irgendwelchen Angst-Gefühlen keine Zeit. Nur ein kurzfristiges Zittern, das seinen Körper wie einen Fieberschauer erfasste, vermittelte dem Zehnjährigen ein noch undeutliches Gefühl hautnahen Bedrohtseins, der Schutzlosigkeit gegenüber einer übermächtigen Gewalt. Er erfuhr – ohne sich dessen bewusst zu sein – eine tiefer gehende Erschütterung seines Urvertrauens in eine immerwährende Geborgenheit. Gerade die Kellerräume des großväterlichen Hauses hatten für ihn, die Mutter und seine Brüder, in den vorangehenden Jahren der nächtlichen Fliegeralarme und der bedrohlichen Überflüge die Bedeutung von Flucht- und Schutzhöhlen angenommen; so versteckten und verkrochen sie sich unten in der Kellerhöhle, während oben tausend Lancaster-Bomber über Haus und Stadt hinwegflogen. Das Stunden andauernde, an- und abschwellende, mal dumpfe, mal heulende Dröhnen einer Masse von Flugzeugmotoren setzte alles in Vibration und löste in ihm quälende Angstgefühle aus, die er bis zu diesen Nächten nicht gekannt hatte.
Jetzt, während dieser Minuten von 14:02 bis 14:04 des 22. Februar 1944, schien es, als habe der Schock alle Angstgefühle in einem Punkt der Exaltation gerafft und konzentriert – und als habe diese Exaltation die Angst in ihm ausgebrannt wie ein Geschwür. Er fühlte sich auf irgendeine Weise ins Freie geworfen. Rechenschaft darüber, was in ihm vorging, konnte sich der Zehnjährige nicht geben. Erst Jahrzehnte später sollte sich offenbaren, dass die Ausbrennung Wunden hinterlassen hatte. In Alpträumen erschien das Geschehen des 22. Februar in einer fremden Landschaft.
Man rief nach ihm, und er erwachte aus seinem Stillstand, verließ den Keller und ging noch einmal mit dem Großvater auf den Balkon; sie blickten auf die unter Qualm und Rauch verschwundene Stadt hinunter. Zu diesem Zeitpunkt hatte das kleine US-Geschwader von 19 B17-Bombern die nördlichen Harzränder längst in Richtung auf die nordwestlich gelegenen Flugbasen in Südengland überflogen. Die Piloten konnten Anfang 1944 schon davon ausgehen, unbehelligt von deutschen Abwehrjägern ihre Flughäfen zu erreichen. Ihren offiziellen Auftrag im Rahmen der sog. „Big Week“ – eines Großangriffs auf Zentren der deutschen Luftrüstungsindustrie – hatten sie mit der Bombardierung der Wernigeröder Altstadt verfehlt; die Rautal-Zulieferwerke und ein kleinerer Junkers-Zweitbetrieb an der Peripherie wurden nicht getroffen. Dem präzisen Ausklinken der Bomben über dem Altstadt-Zentrum fallen 191 Zivilpersonen zum Opfer: in diesem Fall eher zufällig als „target of opportunity“. Die Wahrnehmung der jugendlichen US-Piloten und Bombenschützen war wesentlich gerichtet auf das, was ihnen die Ziel-Koordinaten und die Navigations-Instrumente vorgaben; jetzt wollen sie vor allem nur noch zurück zu ihrem Ausgangs-Flughafen. Der von ihnen verursachte Tod von 191 Menschen ereignete sich für sie wahrnehmungslos, bewusstlos als technischer Vollzug aus großer Ferne.
An einem der nächsten Tage nach dem Angriff kommt er auf seinem Schulweg an der Turnhalle des Lyzeums vorbei, wo die 191 Toten des 22. Februar aufgebahrt liegen: für den Schüler eine bedrückend hohe Zahl, gemessen an den Hekatomben in Lagern und an Fronten eine verschwindend geringe.
Die Stadt geriet in der Zeit nach dem Angriff in Panik. Schon während des einsetzenden Geheuls der Alarmsirenen flüchteten Massen von Frauen, Alten und Kindern durch die Straßen, um die fürstlichen Felsenkeller an den Berghängen zu erreichen. Nur einmal hatte er mit seiner Mutter, den jüngeren Brüdern und der Großmutter in einem dieser nasskalten Felsenkeller die Zeit des Alarms abgesessen.
Die Tagesalarme nahmen 1944 ständig zu. Bomberströme zogen geschützt von eigenen P51-Mustang-Jägern ungehindert ihre Bahn am Himmel. Während der Alarme blieb er jetzt mit seinem Großvater im Haus; mit dem Fernglas beobachteten sie im Garten das verzweifelte Drama des letzten Gefechts, wenn sich vereinzelte deutsche Kamikaze-Jäger wie Raubvögel auf ihre Beute stürzten.
Er fühlte sich von jeder Angst befreit; er fühlte sich dem Großvater ebenbürtig; er war stolz, nicht mehr mit den Frauen und den Brüdern in den Felsenkeller ziehen zu müssen. Er hatte eine Grenze überschritten. Später wurde ihm bewusst, dass er nicht mehr zurückkonnte. Es war der Weg zurück in das Reich der Kindheit, der ihm ein für alle Mal verlegt war. In dem Augenblick, zu dem die Stadt in Schutt und Asche versank, versank auch das Land seiner Kindheit.
Endspiele
11. und 12. April 1945
Wenn man diesen Nachmittag im April des Jahren 1945 – zumindest für jene kurze Zeitspanne zwischen 12 und halb 3 Uhr mittags am elften Tag des Monats – als einen strahlenden und leuchtenden Frühlingstag wie jeden anderen Tag im April beschreiben wollte, verfehlte man seine Einzigartigkeit: die besondere atmosphärische Aufladung, die in der Luft lag und sich augenblicklich auf jene Menschen, die sich gerade vor ihrem Haus zur Kaffeestunde niedergelassen hatten, übertrug wie auf Elemente eines elektrischen Feldes. Was sie jetzt wahrnahmen aber war eine ungewohnte Stille, die in ihnen kurzfristig Erinnerungen an längst vergangene Friedenszeiten wachriefen, in denen „der Frühling sein blaues Band durch die lauen Lüfte flattern ließ.“
Diese Stille aber, die plötzlich herrschte, verhängte einen Ausnahmezustand völligen Stillstandes. Kein Lüftchen wehte am Himmel, um blaue Bänder flattern zu lassen, nur die Spuren der weißen Kondensstreifen, die die Bomberflotten der Vortage hinterlassen hatten, hingen wie gefroren am Himmel. Verstummt war das Heulen der Alarmsirenen; gewöhnt an ihr tägliches Geheul und an das Gedröhn der Liberator- und Boeing-Fortress-Bomber musste den jetzt vor dem Haus in der Sonne Sitzenden die trügerische Ruhe als nicht geheuer vorkommen; sie barg neue Schrecken, noch unbekanntes Unheil. Die da auf den Korbstühlen saßen, waren sich der außergewöhnlichen Schwebe-Situation nicht bewusst; sie befanden sich in einer leeren Gegenwart, ohne ihr Wissen schon in einer Art Niemandsland. In der Unheimlichkeit der Stille schlug sich nieder, was sich, von ihnen unbemerkt, gleichzeitig außerhalb ihres Gesichtskreises ereignete. Gerade jetzt, in diesem Augenblick während sie Kaffee tranken, stand ihre Existenz auf dem Spiel: dem zum Kampf-Kommandanten ernannten Wehrmachtsoberst wurde befohlen, die Stadt bis zum Äußersten gegen die anrückenden Amerikaner zu verteidigen. Wenig später entschließt sich der mutige Oberst, den Befehl zu verweigern, während der für sie unsichtbare Vormarsch der 9. US-Armee am nördlichen Rand der „Harzfestung“ längst die Vororte der Stadt erreicht hatte.
Weder der Großvater noch die Großmutter oder seine Mutter, die sich mit ihm zufällig zu diesem Zeitpunkt auf einem Nebenschauplatz des Kriegstheaters befanden, hatten eine Vorstellung davon, dass sie schon längst Komparsen dieses kollektiven Theaters waren; sie wussten nicht, dass sie gerettet waren; sie wussten nicht, dass sie zukünftig aufzutreten hatten als Zeugen einer Katastrophe, von der sie wiederum nicht wussten oder wissen wollten, in welche Tiefe eines moralischen Abgrunds sie hineingerissen werden sollten.
Plötzlich, gegen 2 Uhr mittags, zerriss ein pfeifend-fauchendes Geräusch die verwunschene Stille dieses Apriltages. Die aufgeschreckten Augen des Enkels suchten den stahlblauen Himmel ab; Flugzeuge aber waren nicht zu erblicken. Nach dem unmittelbar folgenden Explosionsknall befahl der Großvater, den Platz vor dem Haus augenblicklich zu verlassen, es sei eindeutig Artillerie-Beschuss. Als Veteran des 1. Weltkrieges musste er es wissen.
„Geht in den Keller!“ Von der geöffneten Tür der Waschküche aus konnten sie eine Reihe von Einschlägen auf dem in einiger Entfernung gegenüberliegenden Schlossberg und am Schloss selbst beobachten. Der Großvater schien nicht allzu beunruhigt; er war der einzige Mann in diesem Haus voller Frauen und Kinder; zwei seiner Töchter waren mit ihren Kindern aus ihren Städten wegen der Bombenangriffe geflohen; eine der Töchter galt als „ausgebombt“ wie man damals sagte – ihr Wohnhaus im sächsischen Merseburg war durch einen Bombenvolltreffer zerstört. Drei Flüchtlingsfrauen kamen mit einem Kind aus dem von den Russen eingeschlossenen Breslau. Es war dieser, 1945 schon 80-jährige Großvater, der den Hitler immer einen Anstreicher nannte – der mit ihm den BBC-Feindsender hörte am leise gestellten Volksempfänger im sog. Musikzimmer. Auf das Abhören dieses Senders stand die Todesstrafe. Es war dieser Großvater, der seinem 11-jährigen Enkel schon einmal verbat, sein Haus mit dem Braunhemd der Jungvolk-Pimpfe zu betreten. Es war dieser kaisertreue Großvater, an dem er vollkommen diffus und unverstanden wahrnahm, dass das, was dieser sagte und tat, auf keine Weise mit dem übereinstimmen konnte, was er in der Schule und bei den Jungvolk-Pimpfen zu hören bekam. Der Großvater wurde irgendwann gegen Ende des Krieges von der politischen Polizei vorgeladen; als er bis zum späten Nachmittag nicht zurückgekommen war, gerieten die Frauen im Haus in helle Aufregung. Es ging um Briefe von ihm, die bei einer offenbar schon verhafteten alten Studienfreundin gefunden worden waren.
Auf dem Gymnasium erteilte ihm ein Studienrat in Schaftstiefeln und SA-Uniform Unterricht in Geschichte. Der 11- bald 12-Jährige konnte die unterschiedlichen Botschaften, die Schule und Großelternhaus aussandten, nicht versöhnen. Seinen gutbürgerlichen Klavierunterricht hatte er bei einem adligen Fräulein, musste ihn aber aufgeben wegen der ständigen Luft-Tagesalarme; bei den Pimpfen grölten sie: „Und heute
gehört uns Deutschland – und morgen die ganze Welt.“ Das Unversöhnliche dieser disparaten Welten tritt noch nicht ins Bewusstsein des Jungen, aber die unbewusst erfahrenen Verstörungen legen eine traumatische Spur.
Jetzt, in diesem Augenblick, zu dem am 11. April 1945 der Artillerie-Beschuss der unheimlichen Stille ein Ende setzt, leitet sich für den Enkel dieses Großvaters der Untergang genau dieser Welt ein, in die er mit seiner Geburt im Jahre 1933 hineingeboren wurde.
Nachdem irgendwo am Stadtrand ein letztes verirrtes Geschoss niedergegangen war, hörten sie das Rasseln von Panzerketten. Auf der Lindenbergstraße, die unterhalb des Hausgartens verlief, konnten sie vom Balkon aus die Panzer-Kolosse sehen, die auf den Deckplatten einen weißen Stern trugen, der die Großmutter zu dem Aufschrei: „Die Russen kommen!“ veranlasste. Der Großvater belehrte sie, dass es die Amerikaner sein müssten. An jenem 11.4. um 14.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit war somit für die „bunte Stadt am Harz“ der Untergang des „Tausendjährigen Reiches“ besiegelt. Tatsächlich ereignete sich der Untergang in einer Vielzahl von Untergängen auf ganz unterschiedliche Weise. Anderenorts zur gleichen Zeit schlossen die sowjetischen Armeen gerade ihren Ring um Berlin; der Diktator diktiert im Bunkerverließ sein Testament. Die amerikanischen Panzer rollten friedlich und kampflos durch die Lindenbergstraße in Wernigerode am Harz, als möglicherweise gleichzeitig, wenige Brockenbahnstationen bergaufwärts bei „Drei Annen Hohne“ der Oberst Gustav Petri, der Retter Wernigerodes, wegen Befehlsverweigerung standrechtlich erschossen wurde.
Im Mühlental überrollten die amerikanischen Panzer die vom Volkssturm und von Pimpfen des Deutschen Jungvolks nicht ganz fertiggestellten Panzersperren. Als Pimpf hatte er mitgeschaufelt beim Ausheben von T-Gräben für die Kämpfer mit der Panzerfaust. Der Großvater versuchte am späten Nachmittag dem Volksempfänger einige Laute zu entlocken: vergeblich, der Apparat blieb stumm, und der Brocken erschien in südlicher Richtung in deutlichen Umrissen am Abendhimmel. Das Harzgebirge strahlte jene Ruhe aus, die einem Gebirge aus der erdgeschichtlichen Frühzeit gemäß ist.
Am nächsten Tag, dem 12. April 1945 – ein herrlicher Frühlingstag wie der Vortag –, steht der Enkel an der Schützenwiese, wo die amerikanischen Soldaten ein Zeltlager errichten, und nimmt fremdartige Gerüche wahr, die in Schwaden die Wiese überziehen; es riecht nach Benzin, den Ausdünstungen laufender Motoren, nach Zigarettenrauch; er hört exotische Musikfetzen, die aus den Zelten dringen, und er sieht zum ersten Mal in seinem Leben Jeeps und schwarze Soldaten, von denen einer ihm einen Kaugummi zuwirft, das er – unter den missbilligenden Blicken einer vorüberkommenden Dame der alten untergehenden Welt – neugierig aus dem Silberpapier entfaltet, während zur selben Stunde ein hysterischer Diktator in seinem Berliner Bunker den eben jetzt bekannt gewordenen Tod Roosevelts als Rettungswink des Schicksals sehen will – wie dereinst der Große Friedrich den Tod der russischen Elisabeth im siebenjährigen Endkampf um Schlesien: als das berühmte, rettende „miracle de maison de Brandenbourg“.
Das Ring-Pendel
1945
Als in den ersten Junitagen des Jahres 1945 die Vorhut der sowjetischen Besatzungstruppen auf kleinen Panjewagen die Stadt Wernigerode erreicht hatten, waren die schlesischen Flüchtlinge im Hause des Großvaters längst in Panik nach Westen in die englische Besatzungszone aufgebrochen. Sie setzten ihre Flucht vor „den Russen“ aus dem eingeschlossenen Breslau während der eisigen Januartage desselben Schicksalsjahres fort.
Der zu diesem Zeitpunkt elfjährige Enkel des Großvaters bedauerte den Abzug der Kaugummi kauenden Amerikaner mit ihren Jeeps. Allein die Flüchtlinge schienen hellsichtig genug zu sein um zu erkennen, dass dieser Exodus mehr bedeutete als ein Tauschgeschäft, das den Westalliierten erlaubte, in Berlin Fuß zu fassen; sie erahnten in ihm schon die zukünftige Teilung der Hemisphären. Das Haus des Großvaters stand schon nicht mehr auf dem Boden dessen, was man von nun an „die westliche Welt“ zu nennen pflegte – und der Brocken, Wanderziel deutscher Dichter von jeher, bei dem man „an die große mystische Nationaltragödie vom Doktor Faust“ zu denken hatte, sollte schon sehr bald zum Standort der effektivsten Spionage- und Ausspäh-Installation der östlichen Welt werden: permanente Walpurgisnacht der Radar-Hexen auf dem Zaun der Welten-Scheide.
Als die Flüchtlinge damals im März 1945 in die bunte Stadt am Harz gekommen waren, sammelten sich auf dem Brocken eigentlich schon verzweifelte Wehrmachtssoldaten zum letzten Gefecht. In der Stadt herrschte Chaos, Tumult und Aufregung; die Front im Westen rückte näher; Aachen war als erste deutsche Stadt gefallen; britische und amerikanische Truppen überschritten den Rhein; die siegesgewissen Geschichtslehrer in den Schulen gerieten an den Landkarten, auf denen sie die Frontverläufe aufzuzeigen und zu kommentieren hatten, ins Schwitzen. Die Alarmsirenen wurden der raschen Ein- und Überflüge nicht Herr. Am Himmel erschienen die allerneuesten doppelrümpfigen Lightning-Jagdflugzeuge. Die Flüchtlingsströme aus Oberschlesien und Ostpreußen ergossen sich in eine Stadt, deren Hotels, Pensionen und sonstige öffentliche Unterkünfte schon von kriegsverwundeten Soldaten und evakuierten Bombenflüchtlingen aus den Großstädten überfüllt waren. Häftlings-Kolonnen wurden aus den Wernigeröder Zweigstellen des Konzentrationslagers Buchenwald durch Nebenstraßen zum Bahnhof getrieben; die Vernichtungslager im äußersten Osten aber würden sie nicht mehr erreichen. Aus dem Osten kamen im Schutze der Nacht die Flüchtlingszüge an, denen die Fahrt am Tage wegen der Jagdbomberangriffe auf offener Strecke als zu gefährlich galt. Die HJ-Führung befahl Jungvolk-Pimpfe zur Nachtzeit an den Bahnhof, um von dort Flüchtlingsgruppen von Frauen und Kindern durch die Finsternis der im Luftkrieg verdunkelten Stadt zu ihren privaten Zielquartieren zu geleiten. Der Großvater hatte einen HJ-Führer angeschnauzt, was es solle, Elfjährige nächtens zu derartigen Aufgaben heranzuziehen, konnte aber das Argument des HJ-Führers nicht entkräften, es gäbe keine Hilfskräfte außer den ganz jungen Pimpfen, wenigen Krankenschwestern und einigen ziemlich alten Volkssturmmännern, alle anderen seinen im Kriegseinsatz. Gerade war der Jahrgang 1928 zum Kriegsdienst eingezogen worden. Jetzt stand der Enkel auf dem dämmrigen Bahnhof in einer kühlen Märznacht und wartete mit seinen Kameraden auf den Zug aus dem Osten. Nur einzelne gedämpfte Rufe und Befehle hallten aus der Bahnhofshalle auf die Bahnsteige, sonst eine eigentümliche Stille, bedrohlich, angespannt, in Erwartung von Menschen, von denen man nicht wusste, wie man ihnen begegnen sollte. Die Schatten-Gestalten, die dann müde und zerschlagen aus dem Zug stolperten, erschreckten sie durch ihre Teilnahmslosigkeit und ihr Schweigen; wortlos standen sie unschlüssig beieinander, Kinder schliefen in den Armen der Mütter, die schon herrschende Stille umschloss sie wie eine Schutzhülle. Die Pimpfe folgten den Befehlen und machten sich mit den ihnen zugeteilten Menschen auf den Weg durch die dunkle Stadt: keine Straßenlaterne, keine erleuchteten Fenster, Totenstille auf den Straßen. Die Sprachlosigkeit der Flüchtlingsfrauen, die sie geleiteten, begann die jungen Pimpfe zu ängstigen. Wohl wussten sie vage von der furchtbaren Flucht der Frauen aus dem untergehenden Breslau; gehört hatten sie von dem Dresdner Inferno, dem diese schlesischen Flüchtlinge mit knapper Not entkommen waren – und doch konnten sie jene Empathie noch nicht aufbringen, die ihnen hätte sagen können, was in diesen Menschen vorging.
Die jungen Pimpfe konnten der Situation nicht gewachsen sein und reagierten auf das Schweigen mit Angst, die sie sich keinesfalls zugeben wollten.
Auch die zwei jüngeren Frauen mit dem Sohn und der Mutter einer der Frauen, die im Haus des Großvaters während dieser Märzwochen Zuflucht gefunden hatten, waren für ihn fortan von dieser Aura des unnahbaren Schweigens umgeben. So war er verwundert, als eine der Flüchtlingsfrauen ausgerechnet ihn, den Elfjährigen, um ein kleines Gespräch bat; sie müsse ihn um etwas bitten, etwas für sie sehr Wichtiges und Ernstes. Sie erzählte ihm, dass sie und ihre Schwägerin seit ihrer Flucht aus Breslau von ihren Männern nichts mehr gehört hätten – wohl aber erfahren hätten, dass Breslau jetzt irgendwann in den ersten Maitagen von der Roten Armee eingenommen worden sei und dass Schreckliches in der Stadt vorginge. Sie seien verzweifelt. Die Schwägerin habe sich an alte, als abergläubisch verspottete Prozeduren der Schicksalsbefragung auf schlesischen Bauernhöfen erinnert; ausgeführt von Frauen, wobei die Haarsträhne einer Frau, ein Ring und ein Bild beim Auspendeln einer schicksalhaften Option eine Rolle spielten. So kam es dazu, dass er, von den Frauen als Medium auserkoren, mit ihnen in einem abgeschlossenen, dämmrigen Zimmer schweigend an einem Tisch saß und den am Haar einer der Frauen hängenden Ehering über dem Bild des abwesenden Mannes zum absoluten Stillstand zu bringen hatte. Minuten vergingen in jener gespenstischen Stille, in der die Frauen auf den Ring starrten. Setzte sich der Ring von sich aus kreisend über dem Bild in Bewegung, würden sie es als untrügliches Zeichen des Lebens deuten: der Mensch auf dem Bild, über dem der Ring kreist, muss füglich am Leben sein; bleibt der Ring bewegungslos ist es ein Zeichen des Todes. Noch hielt er den Ring bewegungslos über dem Bild. War es Spiel oder Ernst? Ohne dass es ihm bewusst sein konnte, geriet er für diese Minuten in den Strudel des Absurden dieser Tage des Zusammenbruchs, in die Gleichzeitigkeit des Ungeheuerlichen an den entferntesten Orten. Das Kreisen oder der Stillstand des Ringpendels sollte magisch Auskunft geben über Leben und Tod an einem fernen Ort – vielleicht in einem Keller oder Erdloch im schlesischen Breslau. Die Frauen hatten ihn als Medium dieses Orakelspiels in eine Situation gebracht, die er zu seinem Glück nicht durchschauen, aber als schwindelerregend wahrnehmen konnte. Immer noch hatte er den Ring am Haar der Frau über dem Bild stillgehalten, bis er ihn unmerklich in kreisende Bewegung versetzte und damit das ominös-haarsträubende Spiel mitzuspielen begann. Der Augenblick des Stillstands aber: der noch unbewegte Ring am Haar der Frau an seinem Finger, der starre Blick der Frauen, das Schweigen in diesem abgeschlossenen Zimmer im Haus des Großvaters sollten in seinem Gedächtnis haften. Für diesen kurzen Moment wurde er in der von den Frauen inszenierten Farce gezwungen, eine Rolle zu übernehmen auf der Bühne eines absurden General-Theaters, in dem die Verzweiflung lächerlich und die Lächerlichkeit verzweifelt erscheinen musste. Die Schrecken, die das Geschehen außerhalb des Zimmers im Hause des Großvaters prägten, die Exzesse der Vernichtung warfen die Menschen zurück auf Angstzustände, aus denen sie sich in farcenhaften Beschwörungen verlorener Gewissheiten zu erretten suchten. Die Pendelszene mit dem Frauenhaar ließ ihn verwirrt zurück; den Widerschein der allgemeinen Nullpunkt-Situation im Stillstand des Pendels zwischen den Polen von Überleben und Tod konnte er nicht erfassen.