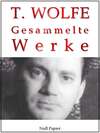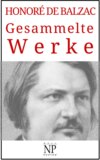Czytaj książkę: «Gabriele Reuter – Gesammelte Werke», strona 12
Zweiter Teil
I.
Eugenie war nach der Geburt ihres ersten Kindes immer noch hübscher geworden. Sie strahlte förmlich in Gesundheit und fröhlicher Laune. Wenn der stramme kleine Kerl auf dem Arm der Wärterin neben ihr ausgeführt wurde, trugen Mutter und Kind dieselben runden tellerförmigen Kappen aus weißer Wolle auf den blonden, rosigen Köpfen, und das machte sich ganz allerliebst. Eugenie dachte sich immer etwas Besonderes aus in ihrer Toilette, das die Leute ärgerte oder freute und worüber man in jedem Falle verschiedener Meinung war.
»Ein neuer Einfall meiner Frau!« pflegte der Lieutenant Heidling dann zu sagen, und in dem Ton, mit dem er hinzufügte: »ja, diese kleine Frau« verriet sich eine beinahe knabenhafte Verliebtheit.
Verglichen die Bekannten Walter mit seiner reizenden Frau, so fiel ihnen sein beunruhigtes und oft gedrücktes Wesen auf. Er hatte Launen. Seine Stirn, seine einfachen, jugendlichen Züge konnten ohne ersichtlichen Grund von Unmut verfinstert werden. In Gesellschaften, wo Eugenie sich unterhielt, lachte, tanzte und sich von seinen Kameraden den Hof machen ließ, stand er schweigsam umher und beobachtete sie. Zuweilen warf er ihr einen bittenden Blick zu. Meist wollte er früh aufbrechen, doch ließ er sich stets von ihr bedeuten – er konnte seinen Willen nicht durchsetzen gegen sie, und dann wurde er verdrießlich. Ihm war die Gesellschaft verhasst, am liebsten wäre er immer allein mit seiner Frau geblieben. Hätte er es ihr verraten, so hätte sie über ihn gelacht. Und ihr Lachen tat ihm weh, er forderte es nicht gern heraus. – Ja – und – – es war doch ihr Geld, von dem sie ein Haus machte, Toiletten anschaffte u. s. w. Würde sie ihm das einmal vorwerfen … Darauf durfte er es nicht ankommen lassen. Die Furcht vor diesem Worte, welches Eugenie sprechen konnte, vermehrte noch die Unsicherheit, in die seine große Liebe ihn stürzte. Er war maßlos eitel auf seine Frau, auf ihre Triumphe – sogar auf ihre Koketterie. Verächtlich und mitleidig äußerte er sich in Bezug auf alle übrigen Frauen. Aber – Regierungsrat Gevatter stehen. Eugenie hatte aber … Er hatte sich ihr Verhältnis früher ganz anders gedacht. Eine Vernunftheirat – und sie musste noch froh sein, wenn er ihr Vermögen nicht beim Jeu verbrauchte. Ja – ja – ja – die Ehe bringt zuweilen wunderliche Überraschungen.
Vor der Taufe des Kindes hatte Agathe einem heftigen Streit zwischen Walter und Eugenie beigewohnt. Walters Hauptmann, Herr von Strehlen, der gnädigen Frau allergetreuester Verehrer, sollte neben dem alten Wutrow und dem Hauptmann schon vor Monaten versprochen – in Walters Gegenwart, er musste sich doch erinnern – ihr erstes Kind sollte, falls es ein Junge werde, nach dem Hauptmann »Wolf« genannt werden. Der Junge war auf die Welt gekommen, und Walter war doch auch ganz zufrieden mit der Tatsache. Ein altes Versprechen nicht zu halten, weil es ihm plötzlich nicht mehr passte, das ging ja nicht – das musste er doch einsehen. Ein ältlicher Junggeselle legt Wert auf so etwas. Mein Himmel, warum ihm nicht die Freude gönnen? Strehlen war nun einmal Walters Vorgesetzter – daran ließ sich nichts ändern, man durfte ihn nicht erzürnen. Walter würde das sonst schon in seiner Carrière zu fühlen bekommen.
Sie sprach sehr verständig, und nachdem Walter anfangs heftig genug gewesen, gab er schließlich ihren guten Gründen nach.
Der Junge wurde Wolf genannt. Herr von Strehlen kam fast täglich heran, um sich nach den Fortschritten in der Entwickelung seines Patenkindes zu erkundigen. Auch wenn er nicht anwesend war, tönte sein Name in tausend Liebkosungen durch die Wohnung. Hielt Eugenie ihr Söhnchen auf dem Schoß und spielte mit ihm, beim Baden und Ankleiden, das sie als gewissenhafte Mutter immer selbst besorgte, hieß es fortwährend unter Küssen und Schäkern: Mein Wolfimäuschen! Mein alter Zuckerwolf! Mein Brüllwölfchen! Mein kleiner, süßer Herzenswolf!
Und die scharfen, grauen Augen der jungen Frau blickten unter halbgeschlossenen Lidern mit listiger Schelmerei zu Walter hinüber und sahen, dass er litt – immerfort litt – sich Vorwürfe machte über eine so unsinnige Qual – dass er seine Ehre und sein Vertrauen zu ihr und seine Vernunft, die ihr nichts vorwerfen konnte, zu Hilfe nahm, und sein Zartgefühl, welches sich schämte, auch nur mit einem Worte seine Unzufriedenheit zu äußern über etwas ganz Selbstverständliches – ihr Scherzen mit dem Kleinen – und dass er dennoch litt.
Sie lächelte ganz heimlich darüber.
Lieber Gott – der langweilige Hauptmann … Der wär’ ihr gerade der Mühe wert gewesen …
Aber die unbarmherzigen Gedanken hinter den kühlen, grauen Augen, unter der weichen Haarmähne, die wussten, wenn Walter diese blonde Fülle abends in seine zitternden Hände nahm und mit schmerzlicher Wonne küsste – dass Leidenschaft aus Leiden wächst. Und das zehrende Feuer, das da an Eugeniens Seite loderte, die angstvolle, vor ihrem Verlust bebende Anbetung wärmte sie höchst angenehm. Es war ihr Geheimnis – ihr Jugendborn – dem sie, wie der Vogel Phönix seinem Flammenneste, in immer neuer Kraft und Schöne entstieg.
Vielleicht betrachtete nur ein Mensch die liebenswürdige Heiterkeit der jungen Frau Heidling, die alle Welt entzückte, mit schweigender Verachtung, und das war ihre Schwägerin.
Seit Agathe sich ganz dem Leben der Pietät, der Selbstaufopferung und der Entsagung hingegeben hatte, wurde sie streng im Urteil über ihre Nächsten, die nicht demselben Ideal herber Pflichterfüllung folgten.
»Mit Agathe ist rein nichts mehr anzufangen«, erklärte Eugenie. »Sie liest den ganzen Tag in der Bibel, wenn sie nicht in der Sonntagschule ist oder ihre Armen besucht. Es ist wirklich schade um das Mädchen!«
»Letzten Mittwoch ist sie sogar in der Betstunde bei den Jesubrüdern gewesen«, sagte Lisbeth Wendhagen, »draußen hinter den Scheunen, wo Fleischermeister Unverzagt predigt! denkt Euch doch nur …!«
»Wenn Papa das wüsste, der würde sie!« sagte Eugenie lachend. »Kinder – der dicke Amandus Unverzagt als Beichtvater für zerknirschte Mädchenseelen! Nein, Walter, wir dürfen wirklich nicht leiden, dass Agathe sich durch ihre Bigotterie zum Gespött der Leute macht.«
Eugenie begann infolge dieser schwesterlichen Erwägung Agathe, sobald sie ihr begegnete, mit ihren Jesubrüdern zu necken. Als das Mädchen zu den jungen Heidlings kam und Wölfchen aus dem Wagen heben wollte, um mit ihm zu spielen, riss Eugenie ihr den Kleinen fort, rümpfte die Nase und sagte: »Ich mag nicht, dass Du ihn trägst – wer weiß, was Du uns für Krankheiten von den Ungeziefer-Kindern Deiner armen Leute ins Haus bringst.«
Sie drückte ihren Knaben mit einer stolzen Mutterbewegung an ihre Brust und ließ ihn fern von Agathe in ihren Armen auf- und niedertanzen, als habe sie ihn siegreich einer großen Gefahr entzogen.
Agathe schossen die Tränen in die Augen. Doch demütigte sie sich so weit, Eugenie flehentlich zu bitten, solche Bemerkungen wenigstens nicht in Gegenwart von Papa zu machen.
Abends in ihrem Zimmer lag Agathe halbe Stunden lang auf den Knien und betete mit Schluchzen und Weinen, der Herr möge sie stärken, das kleine Martyrium, das Eugenie ihr auflegte, in Geduld zu tragen, wie sie um seinetwillen so vieles versuchte – auch die Armenbesuche – auch die heimlichen Gänge zu den Jesubrüdern.
Mit Angst und Verzweiflung fühlte sie, dass die dumpfe, unklare Abneigung gegen Eugenie zum Hass wurde – zu einem Hass, so tief, so giftig und so bitter, wie nur zwischen alten Freunden und nahen Verwandten, die sich sehr gut kennen und sehr viel verkehren müssen, gehasst wird.
Wie konnte das geschehen? Welche bösen schrecklichen Instinkte trieben da ihr Wesen? Ihr ganzes Gemüt sollte doch von der Liebe zum Heiland und zum Nächsten erfüllt sein … Und sie hatte nicht einmal verständige Gründe, Eugenie zu hassen. – Eugenie war ja die einzige, die freundlich versucht hatte, – damals – ihr Lutz nahe zu bringen … Ja – um das Vergnügen zu haben, so ein kaltes, grausames Vergnügen, ihre stumme Qual zu beobachten … sagte sofort eine scharfe höhnische Stimme in ihr – um Lutz ins eigene Haus zu locken – und wenn er nur gewollt hätte … aus überquellender Seelengüte für Agathe hatte Eugenie ihm wohl nicht die Notenblätter vor die Füße gestreut.
Warum – warum vertraute ihr Agathe nur … sie schämte sich, dachte sie nur daran. Sie war ja damals überhaupt nicht zurechnungsfähig – sie war wie verzaubert.
Aber die Gewalt, unter der sie gelitten, war nun gebrochen – sie war befreit – Gottes Kind – des Herrn Magd. O süße helle Seligkeit – in seine Wunden zu tauchen – von seinem Blute sich überströmen zu lassen – zu vergessen – alles – alles – nur sein Erlöserauge zu sehen – einsam über dem Chaos von Elend – Enttäuschung und Not … Eingehüllt von seiner Liebe – geborgen an seinem flammenden Liebesherzen – hingegeben – aufgelöst – sich vergehen fühlen unter den Schauen seiner Gnade …
*
Mit Papa und Mama ging Agathe alle vierzehn Tage in den Dom. Man brauchte sich nicht zu eilen, um zu rechter Zeit zu kommen. Standen auch unzählige Menschen in den Gängen – ihre Bank blieb leer, bis Agathe das kleine Türchen mit dem Schlüssel, den sie aus ihrer Kleidertasche nahm, öffnete.
Auch Eugenie besaß einen Schlüssel und saß dort mit ihrem würdevollsten Schmelzumhang, den sie nur zum Kirchgang trug. Rings auf den reservierten Plätzen glitzerte und funkelte es in dem gedämpften bunten Licht, das durch die Glasmalereien der gotischen Fensterbogen fiel, von Helmen und Epauletten und silbernen Degenquasten, da rauschten die schweren, pelzverbrämten Wintermäntel und raschelten die Posamenterieen1 und Perlen an den Damentoiletten. Man grüßte sich diskret, man begleitete den Gesang zu den brausenden Orgeltönen mit halber Stimme, man stand während des Gebetes in ernster Haltung, die Herren mit den Helmen oder den schwarzen Seidenhüten im Arm, die Damen mit leicht ineinandergeschlungenen Fingern und gesenkten Blicken – wie es sich eben schickt.
Bei der Predigt vergossen viele von den älteren Frauen Tränen, einige schlummerten auch. Und nach Schluss des Gottesdienstes begrüßte man sich vor den Kirchtüren, gähnte ein wenig, stand in kleinen Gruppen mit den Bekannten zusammen und freute sich, wenn der Pastor recht ergreifend geredet hatte. Agathe bemerkte, dass die meisten der älteren Herrschaften dann schon nicht mehr als einzelne Worte aus der Predigt behalten hatten. Die jungen Mädchen und Frauen schwatzten gleich drauf los von Schlittschuhlaufen und Gesellschaften und Bällen. Die Referendare und Lieutenants benutzten die Gelegenheit, um sich der beliebtesten Tänzerinnen für die ersten Walzer zu versichern. Sie gingen nur dann regelmäßig zum Gottesdienst, wenn sie eine Flamme hatten, der sie dort bequem begegnen konnten.
Darum war Agathe zu den Jesubrüdern gekommen: sie hoffte hier eine tiefere, strengere Andacht zu finden, als zwischen den herrlich aufstrebenden Säulen, den kunstvollen Stein-Gewölben des Domes, wo die gute Gesellschaft von der in Gold und Sammet strotzenden Kanzel herab in gewählter, salbungsvoller Sprache die Mahnung empfing, ihr Kreuz auf sich zu nehmen und der Welt und ihren Lüsten zu entsagen.
Bescheiden genug fand Agathe es ja bei den Jesubrüdern. Um zu ihrem Betsaal zu gelangen, musste man von der Straße einen langen feuchten und dunklen Gang zwischen Speichern und Scheunen entlang wandern – der glich wirklich recht der engen Pforte, die zum Himmelreich führt. Dann kam man auf einen schmutzigen Hof, wackelige Steine zeigten den schlüpfrigen Weg durch tiefe Lachen übelriechender Flüssigkeit, die sich von großen Düngerhaufen aus verbreitete. Gackernde Hühner suchten hier ihr Futter. Armselige Lumpen hingen zum Trocknen aus den Fenstern der hohen Hinterhäuser. Über einem Pferdestall lag der Versammlungsort der Jesubrüder, auf halsbrecherischer Treppe zu erklimmen. Ein niedriger weißgetünchter Raum mit abscheulichen Öldruckbildern aus der heiligen Geschichte an den kahlen Wänden und einem von schwarzem Tuch bedeckten Tisch als Altar.
Agathe traf neben sich meist ein kleines altes Fräulein, über das bei Heidlings viel gelacht wurde, weil es scheu und flüchtig, aber regelmäßig wie die Schwalben im Frühling erschien und um Gaben für bedürftige, vom Unglück verfolgte herrliche Menschen bat, die sich dann später ebenso regelmäßig als unverbesserliche Trunkenbolde oder Diebinnen erwiesen. Trotz der unaufhörlichen Enttäuschungen war das winzige, dürftige, alte Jungferchen glückselig in ihrer Eile und Geschäftigkeit, bei Mangel und Hunger, die sie für das Wohl jener zweifelhaften Mitmenschen litt. Sie musste einen heimlichen Schatz in ihrem flachen kleinen Busen unter der Filetmantille tragen, von dem sie sich sättigte und den strahlenden Glanz ihrer Augen in dem von Barthaaren besäeten, verschrumpften Gesichtchen nährte. Sie hatte Agathe von den Jesubrüdern erzählt.
Das Niedrige, Armselige, Versteckte der Umgebung, die Dunkelheit, welche durch die zwei Talglichter auf dem Altar kaum gebrochen wurde, und in der die leise eintretenden Handwerker, die in ihre Tücher vermummten, abgezehrten Gestalten hüstelnder Näherinnen, zitternd herantappender Greisinnen auftauchten und verschwanden – das gemahnte an die heimlichen Zusammenkünfte der ersten Christen in abgelegenen, verborgenen Winkeln – das warf, wie die Lichtstümpfe, die nun hie und da angezündet wurden, um die Verse des Gesangbuches zu entziffern, einen flackernden Schein von Romantik über die Szene. Hier konnte niemand beobachten, ob beim Gebet die heißen Tropfen der Verzweiflung oder der Liebe strömten. Ja – es war, als könne die Seele sich fesselloser, brünstiger zum Herrn aufschwingen, wenn der Leib, hingeworfen, auf den Knien liegend, sich erniedrigte.
Und Gott sei Dank, Pfarrer Zacharias verfiel nicht in die sentimentalen Jammertöne des alten Fräuleins an Agathes Seite.
Eine breite, plumpe Bauerngestalt, ein wuchtiger Kopf, in den Umrissen wie Dr. Luther stand der Wanderprediger vor seinen Anhängern und erklärte ihnen mit zorniger Eindringlichkeit Gottes Wort. Der Mann glaubte noch an den Teufel. Da gab’s kein Umschreiben – keine Konzessionen. Alles oder nichts, hieß es hier … Wenn Du lau bist, so will ich Dich ausspeien aus meinem Munde – so spricht der Herr, Dein Gott, und der Herr lässt seiner nicht spotten.
Agathe schauderte vor Furcht und Schrecken. Aber es wurde ihr so wohl – so wohl unter dieser Härte. Das war etwas! Sie war lau – o sie war ein schwankendes Rohr – ein glimmender Docht – nun blies der heilige Geist seine Flammen in ihr an und wärmte ihr kaltes verödetes Herz.
Hätte man sie selbst nur in der Verborgenheit, die ihr so angenehm war, kommen und gehen lassen. Aber in einem Augenblick tiefer Ergriffenheit hatte sie zu einer Sammlung für eine andere arme Jesubrüdergemeinde ihr goldenes Armband gegeben. Sie hatte ihren Namen nicht genannt, doch man erkundigte sich nach ihr. Die frommen Handwerker beeilten sich, der Tochter des Regierungsrates, die der Herr zu ihnen geführt, eine Strohdecke auf die Kniebank zu legen, ihr Licht und Gesangbuch zu bringen. Sie drängten sich am Schlusse des Gottesdienstes heran, ihr die Hand zu reichen und sie als ein Glied ihrer kleinen Gemeinde willkommen zu heißen.
Das war ja geradezu grässlich. Wenn Fleischermeister Unverzagt die Bibelstunde hielt, sah Agathe den aufgeblasenen Hochmut in seinem Gesicht und suchte vergebens nach der Erhebung, die sie anfangs ergriffen hatte.
Auch hier nicht – auch hier nicht?
Lag es nur an ihrer mangelnden Kraft? Warum war sie so entsetzlich sensitiv gegen alle Unvollkommenheiten?
Sie ängstigte sich vor den Besuchen bei den Armen und Kranken. Wie konnte sie Trost und Hilfe bringen? Die Schwierigkeiten, mit denen diese Leute rangen, sah sie riesengroß und ihre Fähigkeiten, das Elend zu mildern, so winzig – so erbärmlich klein. Es war ja überhaupt nur Illusion. Wie sie die Damen beneidete, die mit einer naiven Sicherheit den Armen Moral, Religion und Reinlichkeit predigten.
Warum sollten sie denn nicht stehlen, wenn sie hungerten? Warum an Gott glauben, der sich nicht um sie kümmerte? Wie konnten sie reinlich sein, wenn sie kein Geld hatten, Seife zu kaufen? Agathe schämte sich, mit gutem Schuhwerk, in ihrer warmen Winterjacke zu ihnen zu kommen – sie schämte sich, etwas zu geben, das, wie sie wohl wusste, die Not nicht ändern konnte – mit dem sie selbst sich nur die Vollendung im Glauben erkaufen wollte.
Trotz heißer Bemühungen wurde sie keine tapfere, fröhliche, bekenntnismutige Nachfolgerin des Herrn, wie ihre Cousine Mimi Bär.
… Als ein Kreuz vom Herrn die Lächerlichkeit und das Vergebliche, das all ihrem Tun anhaftete, auf sich, nehmen und in Geduld tragen – vielleicht ging es auf die Weise.
Der Kampf um den Glauben, um den Frieden füllte doch ihre Tage – gab ihrem Erwachen in der Frühe doch Zweck und Ziel. Wozu in aller Welt lebte sie sonst?
Die Sorge für die Eltern … Eigentlich sorgten Papa und Mama ganz gut für sich selbst. Unermessliche Räume in ihrem Herzen wurden dadurch nicht ausgefüllt. Sie hatte sich das nicht so gedacht – als sie ihnen so dankbar war für die Liebe und die Verzweiflung an ihrem Krankenbett.
Selbst die Sehnsucht war in ihr verdorrt und gestorben. Sie wusste nicht mehr, wovon sie träumen sollte. Sie grämte sich nicht einmal mehr um Lutz. Es war alles eine grauenhafte Täuschung gewesen. Sie hätte ihn ruhig wiedersehen können. Aber er war in ihrem Dasein ausgelöscht wie ein Licht. Von M. war er fortgegangen – in jenem Sommer, als sie sich in Bornau langsam erholte. Sie wusste nicht, wo er nun lebte, und sie konnte sich nicht vorstellen, dass er sich überhaupt noch auf der Welt befand.
Die Daniel hatte einen Schauspieler geheiratet. Sie – die von ihm geliebt worden war – die Mutter seines Kindes … Agathe verstand die inneren Möglichkeiten solcher Schicksale so wenig, wie sie sich das alltägliche Dasein der Marsbewohner vorstellen konnte.
Martins soziale Schriften hatte sie ihm ohne ein Begleitwort nachgesandt. Sie waren sündiges Gift. Der Rausch, der sie bei ihrem Lesen befallen, war auch eine Versuchung zum Bösen gewesen.
*
Nach und nach gewann Agathe sich stille kleine Siege ab. Bei einem großen Ballsouper neigte sie ruhig das Haupt und sprach mit leise sich bewegenden Lippen ihr Tischgebet. Als sie zu Haus den Gebrauch angenommen hatte, blickte ihr Vater sie einige Male verwundert an, ließ sie aber gewähren. Nach dem Tanzfest beim Oberpräsidenten verwies er ihr strenge, sich in Gesellschaft auffällig zu benehmen.
Als Antwort bat Agathe um die Erlaubnis, keine Bälle mehr besuchen zu dürfen.
»Wie kommst Du auf solche Ideen?« fragte der Regierungsrat ärgerlich. Er legte die Zeitung, in der er las, beiseite. Seine erste Ermahnung hatte er über den Rand des Blattes fort in die Unterhaltung zwischen Mutter und Tochter über den gestrigen Abend einfließen lassen.
Jetzt wurde es ernst.
»Papa«, begann Agathe gesammelt, »Tanzen macht mir kein Vergnügen mehr.«
»Was für ein Unsinn! Du bist ein junges Mädchen, freue Dich Deines Lebens. – Ich will keine alberne, sentimentale Person zur Tochter haben.«
»Ja, Papa. Aber …«
»Was – aber?«
»Mit echtem Christentum verträgt es sich doch nicht, auf Bälle zu gehn. Bitte, bitte – erlaube mir doch nur … Es ist ja auch … Du brauchst mir dann seine Ballkleider mehr anzuschaffen.«
Instinktiv griff Agathe nach dem Grunde, durch den sie ihren Vater am leichtesten zu überzeugen hoffte.
Die Bälle und Gesellschaften waren ihr eine Qual. Nirgends fühlte sie sich so ausgeschlossen von jeder Lebensfreude wie in den lichterhellten Sälen, wo schon ein jüngeres Geschlecht den ersten Platz einnahm und die Herren zu den jungen Frauen drängten, die in glänzenderen Toiletten mit freierer Lustigkeit große Kreise von Anbetern um sich sammelten.
Agathe wollte ja hier gar keine Rolle mehr spielen. Fand sich hin und wieder ein Herr, dem sie gefiel, so machte sie sich Vorwürfe, dass sie sich der Eitelkeit hingab. Blieb sie unbeachtet, so kränkte sie sich über ihren eigenen unwürdigen Ärger. Nie kam sie zur Ruhe, solange sie zween Herren diente – Gott und der Welt.
Mimi Bär hatte es viel leichter, die ging ihren Weg, ohne nach links oder rechts zu sehen. Sie hatte ihr Probejahr in dem Schwesterhause in Berlin vollendet, war vor kurzem an das Krankenhaus nach M. versetzt und trug mit ruhigem Stolz ihre weiße Diakonissenhaube. Was sie zu tun und zu lassen hatte, war ihr genau vorgeschrieben. Wie der Offizier in seiner Uniform, mit seiner Ordre du jour und seinem festgefügten Standesbegriff lebte sie in klar abgegrenztem Kreise ein tätiges und befriedigtes Leben.
Und Agathe konnte nicht einmal Kindespflicht und Christentum vereinen. Zwar … Mimi hatte dies beides auch nicht vereinigt. Sie hatte einfach ihren inneren Beruf über die Kindespflicht gestellt – ihre alten Eltern fröhlich der Obhut und Pflege Gottes überlassend.
Der Regierungsrat verurteilte ihre Handlungsweise aufs schärfste. Er fürchtete den Einfluss, den Mimi auf seine Tochter üben könne und ergriff energisch die Gelegenheit, um seine Meinung dagegenzustellen. Agathes Hinweis auf die Ersparnisse durch die nicht gekauften Ballkleider machte diesmal keinen Eindruck, obgleich der Papa sonst gern über die Ausgaben der Frauen schalt.
»Liebes Kind«, sagte er, sich erhebend, die Hand auf den Tisch stützend und durch den Klemmer einen ernsten Blick auf seine Tochter richtend, »Du hast nicht nur Verpflichtungen gegen Dich selbst, sondern auch gegen die Gesellschaft, vor allem aber gegen die Stellung Deines Vaters. Dich ihnen zu entziehen, wäre gewissenlos gehandelt. Als Vertreter der Regierung habe ich mich in der Öffentlichkeit und bei meinen Vorgesetzten zu zeigen. Was sollen die Leute denken, wenn ich meine Tochter zu Hause lasse? Wir Männer des Staates haben nach oben und nach unten, nach rechts und nach links zu blicken, um keinen Anstoß zu erregen – wir sind keine freien Menschen, die ihren Launen folgen dürfen. Mir ist schon öfter in letzter Zeit zu Ohren gekommen, dass Du mit der eigentümlich strengen religiösen Richtung, die Du angenommen hast, Aufsehen erregst. Mein liebes Kind – das geht durchaus nicht an. Der Oberpräsident hat mir gestern Andeutungen gemacht, die mich sehr peinlich berührt haben … Ich höre, Du besuchst die Versammlungen einer Sekte, die sich Jesubrüder nennen?«
»Papa – ich, war ja nur ein paarmal da«, stammelte Agathe. Ihres Vaters Stimme hatte den strengen Amtston angenommen, den sie und die Mutter so sehr fürchteten.
»Es predigt dort ein gewisser Zacharias – ein Pfarrer, der aus der Landeskirche ausgetreten ist?«
»Ja, Papa! Aber er kommt nur alle vier Wochen. Er redet wundervoll!«
»Ein eigensinniger Kopf! Wegen der Maigesetze geriet er in unliebsamen Streit mit dem Konsistorium. Ich erinnere mich der Sache. – Der Oberpräsident hat mir offen gesagt, man sieht es ungern, dass die Tochter eines hohen Regierungsbeamten die Versammlungen eines solchen Mannes besucht.«
»Aber Papa, man kann ihm ja gar nichts vorwerfen. Er folgte nur seiner Überzeugung. Leicht wird es ihm gewiss nicht geworden sein, mit seinen fünf Kindern die gute Stelle aufzugeben. Oft essen sie zu Mittag nur Kartoffeln und Schmalz. Ja, das weiß ich.«
»Ist ihm ganz recht«, sagte der Regierungsrat, im Zimmer umhergehend. »Du hörst doch, welche unangenehme Szene ich deinetwegen gehabt habe. Es ist mir unbegreiflich, wie Deine Mutter Dir erlauben konnte, zu diesen Sektierern zu gehen! Ich verbiete es Dir hiermit ausdrücklich. Hörst Du! Du hast den Gottesdienst im Dom. Da kannst Du Dir genug Frömmigkeit holen. Jede Übertreibung ist vom Übel.«
Frau Heidling entschuldigte sich verwirrt, Agathe nicht besser beaufsichtigt zu haben, und der Regierungsrat ging verstimmt auf sein Büro.
Als er zum Essen nach Haus kam, versuchten die beiden Frauen, ihn auf jede Weise zu erheitern. Mit besonderer Sorgfalt war das Mahl bereitet. Agathe musste noch einmal selbst zum Fleischer gehen, um ein Stückchen zarte Lende zu bekommen. Und sie hatten Glück, es schmeckte dem Vater. Nach Tisch klopfte er Agathe die Wange und sagte freundlich: »Was so ein kleines Ding immer für Einfälle hat! Ja, ja – Euch muss man ordentlich hüten!«
1 Stoffverzierungen <<<