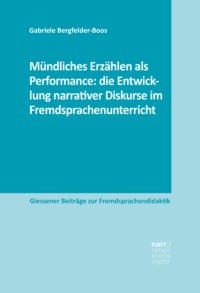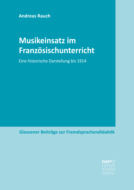Czytaj książkę: «Mündliches Erzählen als Performance: die Entwicklung narrativer Diskurse im Fremdsprachenunterricht»
Gabriele Bergfelder-Boos
Mündliches Erzählen als Performance: Die Entwicklung narrativer Diskurse im Fremdsprachenunterricht.
Eine explorative Studie im Rahmen eines Weiterbildungsprojekts im Fach Französisch
Narr Francke Attempto Verlag Tübingen
[bad img format]
© 2019 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG
Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
www.narr.de • info@narr.de
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ePub-ISBN 978-3-8233-0118-9
Inhalt
Vorbemerkung
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Gesamtkonzeption der Studie2.1 Forschungsgegenstand und Forschungsziele2.1.1 Die Ausgangssituation und ihre Folgen für das Forschungsprojekt2.1.2 Thema, Zielsetzungen und Desiderata2.1.3 Forschungsfragen2.2 Forschungstheoretische und -methodologische Rahmung2.2.1 Verortung des Vorhabens im fremdsprachendidaktischen Forschungsfeld2.2.2 Forschungsentscheidungen der Gesamtstudie2.2.3 Forschungsentscheidungen der empirischen Studie2.3 Forschungsverfahren und Forschungsinstrumente2.3.1 Datenerfassung und -gewinnung2.3.2 Datenauswertung2.4 Chancen, Herausforderungen, Konsequenzen des komplexen Vorhabens2.5 Impulsgebende empirische Untersuchungen zum mündlichen Erzählen2.6 Verlauf und Gesamtaufbau der Studie
Teil A: Mündliches Erzählen als Performance: konzeptionelle Grundlagen
3 Erzählen in Mündlichkeit: die Dimension des Narrativen3.1 Intermediale, grenzüberschreitende Konzeptualisierung des Narrativen3.1.1 Konstituenten des intermedialen Erzählmodels: das Narrative und die Narreme3.1.2 Funktionen des Prototypen: Illustration und Operationalisierung, Stimulus und Gradmesser des Narrativen3.1.3 Impulse des intermedialen Modells für die Konzeption der Studie3.2 Mündlich-verbales Erzählen (1): (Re-)Konstruktions- und Interaktionsprozesse beim Gebrauch der Diskursform3.2.1 Erzählen als Diskurseinheit3.2.2 Narrationsspezifische Aufgaben der Diskursteilnehmer3.2.3 Das Prinzip der Erzählwürdigkeit3.3 Mündlich-verbales Erzählen (2): fiktionales Erzählen3.4 Mündlich-verbales Erzählen (3): Erzählen von Märchen- und Album-Adaptionen3.5 Mündlich-verbales Erzählen (4): ästhetische Konzeption fiktionaler Diskurse zwischen zwei Mündlichkeitsformen3.5.1 Die Medialität der mündlichen Erzählsituation3.5.2 Mediale Mündlichkeit vs. konzeptionelle Mündlichkeit3.5.3 Modellierungsmöglichkeiten konzeptioneller Mündlichkeit3.6 Analysekriterien und Teil 1 des Fünf-Dimensionen-Modells FDM-P3.7 Zusammenfassung: das werkseitige, narrative Potenzial mündlichen Erzählens
4 Mündliches Erzählen als Performance: die Dimension des Performativen4.1 Erzählen als Performance (1): die Aufführung als Ereignis4.1.1 Der Performance- und der Aufführungsbegriff4.1.2 Die Erzählperformance als Aufführung4.2 Erzählen als Performance (2): Medialität und Materialität der Aufführung4.2.1 Mündlichkeit und Körperlichkeit der Erzählperformance – die Nähe zum Theater4.2.2 Kommunikationsmodell mündlich–fiktionalen Erzählens als Performance4.3 Erzählen als Performance (3): die Herstellung von Bedeutung in der Aufführung4.3.1 Die prosodischen Elemente, ihre Art und ihre Funktionen in primärer Verwendung4.3.2 Das Zeicheninventar des Theaters4.3.3 Die linguistischen und non-verbalen Zeichen in erzählperformativer Verwendung4.3.4 Verwendungsmöglichkeiten erzählperformativer Zeichen4.4 Erzählen als Performance (4): die Aufführung als Erlebnis4.4.1 Der Rahmen der Aufführung4.4.2 Die Feedback-Schleife4.4.3 Der performative Pakt4.5 Erzählen als Performance (5): Inszenierung und Interpretation von Erzählperformances und Teil 2 des Modells FDM-P4.5.1 Inszenierungsmöglichkeiten zwischen den Extremen performativer Gestaltung4.5.2 Interpretationskriterien und -schritte und Teil 2 des Fünf-Dimensionen-Modells FDM-P4.6 Zusammenfassung: das performative Potenzial mündlichen Erzählens
5 Erzählen in Mündlichkeit: die werkexterne, kulturelle Anwendungsdimension5.1 Rolle und Konzeption der werkexternen Dimension5.2 Erzählen in Mündlichkeit (1): die kulturpsychologische Sicht5.2.1 Die Ich-Konstruktion5.2.2 Die kulturelle Teilhabe5.2.3 Bruners Liste der Anforderungen an die Fähigkeit des Erzählens5.3 Erzählen in Mündlichkeit (2): die erzähldidaktische Sicht5.3.1 Anforderungen an die Fähigkeiten des Erzählens5.3.2 Die Konstruktion eines Kontinuums narrativer Leistungen5.3.4 Förderliche Einflussfaktoren auf den Erwerb narrativer Fähigkeiten und ressourcendidaktische Strategien zu deren Weiterentwicklung5.4 Erzählen in Mündlichkeit (3): die erzählpädagogische und ästhetische Praxis professioneller Erzählerinnen und Erzähler5.4.1 Die Kreativität des Erzählens in den märchenpädagogischen Konzepten Georges Jeans und Gianni Rodaris5.4.2 Poesie und Musikalität des Erzählens in den Erzählkonzepten und Erzählperformances Marie-Célie Agnants5.5 Erzählen in Mündlichkeit (4): Analyse narrativer Diskurse und Teil 1 des Fünf-Dimensionen-Modells FDM-R5.6 Zusammenfassung: das werkexterne, kulturelle Potenzial mündlichen Erzählens
6 Mündliches Erzählen im Fremdsprachenunterricht: die fremdsprachendidaktische Perspektive6.1 Konzeption und Gliederung der fremdsprachendidaktischen Perspektive6.2 Mündliches Erzählen im Fremdsprachenunterricht (1): Perspektiven bildungspolitischer Vorgaben6.2.1 Mündliches Erzählen als Bestandteil kommunikativer Aktivitäten im GeR6.2.2 Mündliches Erzählen als Bestandteil produktiver und rezeptiver Strategien und der Diskurskompetenz im GeR6.3 Mündliches Erzählen im Fremdsprachenunterricht (2): mündliches Erzählen als Gegenstand6.3.1 Storytelling als inhaltsbezogenes, ganzheitliches Unterrichtsprinzip6.3.2 Ein narratives Gesamtkonzept im Fremdsprachenunterricht: narrative Dimensionen und narrative Kompetenzen6.4 Mündliches Erzählen im Fremdsprachenunterricht (3): mündliches Erzählen als Aufgabe der Akteure6.4.1 Konzeptionelle und performative Aufgaben sowie Reflexionsaufgaben der Lehrkräfte6.4.2 Gemeinsame Aufgaben der Akteure: die Nutzung des fremdsprachlichen Klassenzimmers zur Realisierung des mündlichen Erzählens6.5 Analysekriterien der Unterrichtsdesigns und Teil 2 des FDM-R6.6 Zusammenfassung: das fremdsprachendidaktische Potenzial mündlichen Erzählens
7 Zwischenfazit: Strukturierung der recherchierten Potenziale mündlichen Erzählens als Performance und der Analyseinstrumente
Teil B: Die Entwicklung narrativer Diskurse in den Erzählstunden: die empirische Untersuchung
8 Durchführung der empirischen Studie8.1 Der Weiterbildungs- und Aktionsforschungskontext8.1.1 Das Erzählcurriculum im Weiterbildungsstudiengang8.1.2 Verabredungen zwischen den an den Erzählprojekten Beteiligten8.1.3 Herausforderungen der Projekt- und Forschungsarbeit8.2 Die Datenerhebung8.2.1 Die Akteure der Erzählstunden und die von ihnen gewählten Erzählungen8.2.2 Datenerhebung und Reduktion der Daten für die Zwecke der Studie8.3 Datenaufbereitung und Analyseschritte8.3.1 Die Videografien der beiden Erzählstunden8.3.2 Die Interviews der Akteure der beiden Erzählstunden
9 Analyse von zwei unterschiedlichen Erzählstunden zu demselben Märchen9.1 Die geplanten Erzähldiskurse beider Erzählstunden9.1.1 Analyse des Märchentextes Le conte des échanges : Brüdermärchen und Kettengeschichte9.1.2 Vergleichende Analyse der Textadaptionen und Adaptionsstrategien beider Erzählstunden9.1.3 Ergebnis der Analyse: die Entwicklung der Erzähldiskurse für ihren Einsatz in medialer Mündlichkeit im Fremdsprachenunterricht9.2 Die erste Erzählstunde: das Märchen in einer 9. Klasse (2. FS Französisch)9.2.1 Analyse des Unterrichtsdesigns: eine Erzählstunde mit intermedialem Schwerpunkt9.2.2 Analyse der Erzählperformances als Aufführung: Le conte des échanges als Höhepunktgeschichte9.2.3 Die Analyse der Rekonstruktion der Erzählung9.3 Das Märchen in einer 9. Klasse (1. FS Französisch): die zweite Erzählstunde9.3.1 Vergleichende Analyse des Unterrichtsdesigns: eine Erzählstunde mit einem verbalen Gestaltungschwerpunkt9.3.2 Vergleichende Analyse der Erzählperformances als Aufführung: Le conte des échanges als Fortsetzungsgeschichte9.3.3 Vergleichende Analyse der Rekonstruktion der Erzählung9.4 Interpretation der Analyseergebnisse als Zwischenfazit9.4.1 Die Anwendung des Erzählmodells und des Potenziale-Modells auf den Fremdsprachenunterricht9.4.2 Die realisierten Potenziale mündlichen Erzählens als Performance9.4.3 Der Gebrauch der Fünf-Dimensionen-Modelle – funktionale und flexible Instrumente der mehrdimensionalen Analyse narrativer Aktivitäten
10 Analyse der Reflexionen der Akteure der Erzählstunden10.1 Die Reflexionen der Lehrenden und Lernenden zur ersten Erzählstunde: eine stimmige ‒ eine witzige Erzählstunde10.1.1 Erste Eindrücke10.1.2 Die erste Hauptkategorie: Reflexionen der Erzählung10.1.3 Die zweite Hauptkategorie: Reflexionen der Erzählstunde10.1.4 Die dritte Hauptkategorie: Reflexionen der Erzählperformance10.1.5 Die vierte Hauptkategorie: Reflexionen der Rekonstruktionen10.1.6 Forschungsfragen und Ideen zur Weiterarbeit10.1.7 Erste Interpretation der Interviewanalyse: Vergleich der Perspektive der Akteure mit den Analyseergebnissen der ersten Erzählstunde10.2 Analyse der Reflexionen der Lehrenden und Lernenden zur zweiten Erzählstunde: eine entspannte – eine fröhliche Erzählstunde10.2.1 Erste Eindrücke10.2.2 Die erste Hauptkategorie: Reflexionen der Erzählung10.2.3 Die zweite Hauptkategorie: Reflexionen der Erzählstunde10.2.4 Die dritte Hauptkategorie: Reflexionen der Erzählperformance10.2.5 Die vierte Hauptkategorie: Reflexionen der Rekonstruktionen10.2.6 Forschungsfragen und Ideen zur Weiterarbeit10.2.7 Erste Interpretation der Interviewanalyse: Vergleich der Perspektiven der Akteure mit den Analyseergebnissen der zweiten Erzählstunde10.3 Zwischenfazit: die erste und die zweite Interpretation der Analyseergebnisse10.3.1 Zusammenfassung der ersten Interpretation: Vergleich der Akteure-Perspektive mit den Analyseergebnissen der Erzählstunden10.3.2 Die zweite Interpretation: wirksame Faktoren der Weiterbildung – die von den Akteuren entdeckten Potenziale mündlichen Erzählens10.3.3 Zusammenführung der Interpretationsergebnisse
Teil C: Ergebnisse der Studie: die performative Entwicklung narrativer Diskurse im Fremdsprachenunterricht
11 Impulse für eine performative Entwicklung narrativer Diskurse11.1 Diskussion der Ergebnisse vor dem Hintergrund der ausgewählten empirischen Studien zum mündlichen Erzählen11.2 Bedingungsfaktoren und Impulse für das Ausschöpfen des Potenzials mündlichen Erzählens als Performance11.2.1 Genrespezifische, mündlichkeitsorientierte, erzählwürdige Konstruktion von Erzähldiskursen für die Erzählperformances im Fremdsprachenunterricht11.2.2 Ereignis- und publikumsorientierte Gestaltung von Erzählperformances11.2.3 Handlungs- und mündlichkeitsorientierte Konzeption der Erzählstunden11.2.4 Charakteristische Merkmale und Funktionen mündlichkeitsorientierter und kreativer narrativer Aufgaben11.2.5 Individuelle und kooperative, abwechslungsreiche und progressive Gestaltung der Rekonstruktion der Erzählung11.2.6 Herausforderungen und Chancen für Lehrende und Lernende11.2.7 Der performative Pakt: die Nutzung des performativen Raums und der pädagogischen Situation zur Entwicklung narrativer Interaktion11.3 Mehrdimensionale, performative Konzepte zur Gestaltung des Fremdsprachenunterrichts und der Weiterbildung11.3.1 Das performative Erzählkonzept zur Entwicklung narrativer Diskurse11.3.2 Das mehrdimensionale Analysekonzept11.3.3 Das mehrdimensionale Weiterbildungskonzept
12 Reflexion des Forschungsprozesses 12.1 Der Ausgangspunkt der Forschungsarbeit 12.2 Der spiralförmige Forschungsverlauf und der Theorie-Praxis-Bezug der Studie 12.3 Der Forschungsprozess der Forscherin als Aktionsforschungsprozess 12.4 Gütekriterien der Studie 12.5 Die Reichweite der Studie
13 Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis
Anhang
Vorbemerkung
Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2016/17 am Fachbereich für Philosophie und Geisteswissenschaften der Freien Universität Berlin als Dissertation angenommen.
Auf dem langen Weg von den ersten Ideen und Entwürfen bis zur Endfassung der Arbeit haben mich viele Menschen begleitet und auf unterschiedliche Art und Weise inspiriert und unterstützt. Mein besonderer Dank gilt meiner Doktormutter, Frau Prof. Dr. Daniela Caspari. Sie hat mit ihrer konstruktiven Kritik und ihrer Bereitschaft, auch ungewöhnliche Forschungswege mitzugehen und neue, auf die Verbindung von Theorie und Praxis ausgerichtete Konzepte mitzutragen, meiner Forschungs- und Schreibarbeit wichtige Impulse gegeben und mich davor bewahrt, mich im Gestrüpp des komplexen Forschungsansatzes zu verlieren. Frau Prof. Dr. Lieselotte Steinbrügge danke ich für Ihre Unterstützung und das Zweitgutachten.
Den am Erzählprojekt beteiligten Weiterbildungsstudierenden und ihren Schülerinnen und Schülern danke ich für ihr Engagement, ihre Erzähl- und Diskussionsfreude, ihre wertvollen Anregungen und die interessanten Erzählungen in Bild und Wort. Der Erzählerin und Autorin Marie-Célie Agnant danke ich für ihre mitreißenden Erzählperformances. Sie waren mir und meinen Erzählpartnerinnen und -partnern Ansporn zu performativen Eigenversuchen. Danke auch für die zum Weitererzählen geschenkten Märchen Tipège und Petite madame.
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Arbeitsbereichs „romandid“, insbesondere Helene Pachale, danke ich für die kollegiale Zusammenarbeit der letzten Jahre, die gewinnbringenden Gespräche, die organisatorische und medientechnische Unterstützung und die aufmunternden Worte.
Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Forschungskolloquiums der Didaktik der romanischen Sprachen danke ich für die fruchtbare wissenschaftliche Diskussion und die zahlreichen Anregungen, die mich nach jeder Präsentation der Arbeit einen entscheidenden Schritt weiterbrachten. Einen besonderen Anteil daran hatten Frau Sabrina Noack-Ziegler, Frau Dr. Bettina Deutsch und Frau Dr. Manuela Franke, denen ich deshalb besonders danke.
Meinen Freunden und Freundinnen danke ich für ihre moralische und professionelle Unterstützung, besonders Jürgen Helmchen für die Fenstergespräche. Wilma Melde danke ich für die gemeinsame approche du théâtre.
Mein ganz besonderer Dank gilt meiner Familie, ohne deren ermunternde Worte und tatkräftige Unterstützung ich diese Arbeit nicht hätte zu Ende bringen können. Meinem Mann danke ich für die langjährige und liebevolle Geduld und die intensive Unterstützung in der Endphase der Arbeit. Alexander Kruchten danke ich für die langjährige, professionelle Begleitung und seine unendliche Geduld bei der Arbeit an den Grafiken und am Layout der Arbeit. Meiner Tochter Angela danke ich für ihren liebevollen, kompetenten und kritischen Blick, ihr Interesse an den Ergebnissen meiner Arbeit und die unterschiedlichen Formen, die sie für ihre Feedbacks fand. Meinem Sohn Martin und seiner Frau Karolina danke ich für ihre moralische und tatkräftige Unterstützung auf dem langen Weg in die Zielgerade. Mein Dank gilt auch Carla und Viktor Bergfelder, die mir durch ihr begeistertes Zuhören, Nachfragen und Mitwirken intensive Erzählerlebnisse geschenkt haben.
Abkürzungsverzeichnis
Neben den gebräuchlichen Abkürzungen (s., f., ff., a.a.O., u.a.m.) wurden die nachfolgenden Abkürzungen verwendet:
| 1AJuw | Beispiel für den Codenamen einer Schülerin in Interviewtranskriptionen |
| AT-EZ / 1 | Adaptionstext des Erzähltextes einer Erzählstunde (hier der ersten Erzählstunde) |
| EZ / 1 | Beispiel für die Nummerierung der Erzählstunden (hier der ersten Erzählstunde) |
| FDM-P | Das Fünf-Dimensionen-Modell zur Analyse von Erzählperformances im Fremdsprachenunterricht |
| FDM-R | Das Fünf-Dimensionen-Modell zur Analyse produktiver Narrativierungsleistungen in Rekonstruktionsgesprächen |
| FDM-R-V | Fünf-Dimensionen-Modell zur Analyse produktiver Narratvierungsleistungen in Rekonstruktionsgesprächen, Zielprodukt: performativ gestalteter Vortrag von Fortsetzungsgeschichten |
| FDM-R-WBS | Fünf-Dimensionen-Modell zur Analyse produktiver Narrativierungsleistungen in Rekonstruktionsgesprächen, Zielprodukt: performativ gestaltete Wort-Bilder-Serie |
| Fg-1 | Beispiel für die Nummerierung von Fortsetzungsgeschichten |
| F1-Sw3a | Beispiel für die Codifizierung der Zeichnungen der Schülerinnen und Schüler |
| FS | Fremdsprache |
| GeR | Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen |
| ILKT-EZ / 1 | Transkription des Interviews mit den Lehrkräften der ersten Erzählstunde |
| ISchT- EZ / 1A | Transkription des Interviews mit den Schülerinnen und Schülern der Gruppe A der ersten Erzählstunde |
| KJL | Kinder- und Jugendliteratur |
| LK | Lehrkräfte |
| OT | Bezeichnung des Originaltextes |
| PDLK-EZ / 1 | Projektdossier der Lehrkräfte einer Erzählstunde (hier von EZ / 1) |
| PM | Potenziale-Modell |
| Sm1 | Beispiel für den Codenamen eines Schülers in Videotranskriptionen |
| Sp | Sprecherinnen und Sprecher |
| SuS | Schülerinnen und Schüler |
| TFg-1 | Beispiel für die Nummerierung schriftlicher Notizen von Fortsetzungsgeschichten |
| VT-EZ / 1 | Transkription der Videoaufnahme der ersten Erzählstunde (EZ / 1) |
1 Einleitung
Die vorliegende Publikation untersucht das Phänomen des mündlichen Erzählens im Fremdsprachenunterricht auf theoretischer und empirischer Ebene. Dabei werden beide Ebenen forschungsmethodisch so aufeinander bezogen, dass daraus Erkenntnisse über das Potenzial mündlichen Erzählens für den Fremdsprachenunterricht gewonnen werden können.
Unmittelbarer Anlass zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem mündlichen Erzählen war das Erlebnis einer Erzählperformance im Rahmen einer universitären Lehrveranstaltung. Marie-Célie Agnant, eine frankophone Erzählerin aus Montréal, stellte die Gattung Märchen als outil d’apprentissage dans la classe de langue vor, indem sie vor und mit Studierenden der Freien Universität Berlin1 Märchen eigener Kreation und Märchen ihrer ursprünglichen Heimat Haïti erzählte. Gemeinsam mit dem Publikum entfaltete sie den Plot der Geschichten, schmückte die eine oder andere Handlungsstation aus und gestaltete sowohl die Erzähler- als auch die Figurenrede theatralisch – mithilfe ihrer Körperlichkeit und ihrer Musikalität. Narration und Theater verbanden sich in dieser Vortragsweise zu einer ästhetischen Einheit. Dabei war der pädagogisch-didaktische Wirkungszusammenhang präsent, störte aber nicht das ästhetische Erlebnis. Das war für mich neu und faszinierend. Neugier und Motivation, hinter das Geheimnis dieser Performance zu kommen, waren geweckt. Es schien mir lohnenswert, das Potenzial dieses Instruments der ästhetischen Kommunikation und der Interaktion mit dem Publikum für den Fremdsprachenunterricht auszuloten. Weitere Inspiration lieferten die Ausführungen Marie-Célie Agnants zu ihrem ästhetischen und didaktischen Konzept2, das sie in Gesprächen und Interviews erläuterte. Marie-Célie Agnant betont die Formbarkeit des zu erzählenden Textes im Augenblick der Performance und die Wirkmächtigkeit der mündlich Erzählenden, die ihren Diskurs der Erzählsituation anpassen können. Sie richtet ihr Erzählen auf die Teilhabe des Publikums am Erzählen aus und begreift das Erzählen als Recherche neuer Ausdrucksformen. Eine tragende Rolle bei dieser Recherche kommt dem Wortmaterial, der Musikalität der Wörter und dem Rhythmus der Rede zu:
[L]e conte pour moi, c´est le matériau premier. Et je dis toujours que le conte, c´est un élastique qu´on peut changer selon la journée, selon… Dans le conte, il y a toute la liberté, tu sais, de se mouvoir. Et souvent, j´encourage les enfants à changer les textes. A changer la fin du texte. En fait, le conte, c´est l´exploration de nouvelles façons, de nouveaux mots, d´une nouvelle musique. C´est ça, l´important pour moi. Pas le conte lui-même. C´est la musique qui va …. C´est le rythme qui va ouvrir les horizons. (Agnant / Bergfelder-Boos 2006: 2)
Dieser erste Kontakt mit der Kunst des mündlichen Erzählens lieferte Ideen für ein Forschungsprojekt, bei dem die Auffassung vom Text als Erzählmaterial und die Auffassung vom Erzählen als Recherche im Mittelpunkt stehen sollten. Ich machte mich auf die Suche nach Anknüpfungspunkten für meine Recherche.
Erste Auseinandersetzungen mit dem Forschungsgegenstand und der Forschungsliteratur ließen vermuten, dass das Potenzial mündlichen Erzählens in seiner Mehrdimensionalität begründet ist (Kap. 3.1). Sie beruht zum einen in der Auffassung vom Narrativen als einem Konstrukt, in dem sich zwei Dimensionen miteinander verbinden: die Dimension des Erzählten, die histoire, und die Dimension des Erzählens, der discours.3. Sie beruht zum anderen darin, dass an der mündlichen Realiserung einer Erzählung mehrere Zeichensysteme beteiligt sind: verbale, paralinguistische, akustische und visuelle Zeichen. Mit dieser Nähe zum Theater gewinnt das mündliche Erzählen eine weitere Dimension: die der Aufführung und des Performativen (Kap. 4.1).
Die Recherche führte weiter zur Mehrfunktionalität mündlichen Erzählens. Mündliches Erzählen kann in unterschiedlichen Wirkungszusammenhängen eingesetzt werden, von denen in dieser Studie vor allem die Institution Unterricht und die Institution Theater, d.h. die didaktische und die ästhetische Anwendung, relevant sind. Aus der Erzählpraxis in anderen Verwendungszusammenhängen wie dem Erzählen im Alltag oder dem Erzählen in gesellschaftlich-kultureller Praxis (Kap. 5.1) können ebenfalls Anregungen für seinen Einsatz im Fremdsprachenunterricht gewonnen werden. Gerade seine vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten machen das mündliche Erzählen für eine Potenzialrecherche interessant.
Zur Mehrdimensionalität und Mehrfunktionalität des Forschungsgegenstandes kommt die Mehrperspektivität seiner Untersuchung im Rahmen dieser Studie hinzu, denn das mündliche Erzählen wird aus unterschiedlichen Forschungsperspektiven erkundet. Dazu gehören die Perspektive der narratologischen Forschung (Kap. 3), der Theaterwissenschaft (Kap. 4), außerdem die Perspektive von Erzählpraktikerinnen und -praktikern (Kap. 5.4), der Erzähl- und der Fremdsprachendidaktik (Kap. 6) und vor allem die Perspektive der Unterrichtspraxis und ihrer Akteure (Kap. 8, 9, 10). Diese Perspektive wird durch die Projektarbeit von Teilnehmerinnen und Teilnehmern einer von der Forscherin betreuten Lehrkräfteweiterbildung einbezogen. Deren Projektarbeit liefert das empirische Material der Studie.
Die bisher genannten Leitideen der Studie sind im Titel der Dissertation wiederzufinden. Es handelt sich um eine explorative Studie, die mit dem Begriff ‚mündliches Erzählen als Performance‘ ihren Forschungsgegenstand aus der werkseitigen und aus der Perspektive ihrer Realisierung als Aufführung erfasst, auf der Basis von Materialien der Weiterbildung empirisch erforscht und sich zum Ziel setzt, die Forschungsergebnisse für die Praxis des Fremdsprachenunterrichts fruchtbar zu machen.