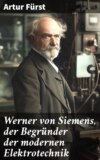Czytaj książkę: «Werner von Siemens»
Die Persönlichkeit
Vor dem stolz ragenden Gebäude der Technischen Hochschule in Charlottenburg ist ein Bronzestandbild aufgerichtet, das Werner Siemens in schlichter Gestalt zeigt. Gewiß konnte der Bildhauer, der heutigen Kunstrichtung entsprechend, nichts Besseres tun, als dem heranreifenden Ingenieurgeschlecht das große Vorbild im Gewand des Bürgers vor Augen führen. Aber die Phantasie, die keine bildnerischen Schwierigkeiten kennt, darf sich Werner Siemens anders vorstellen.
Wir Jüngeren, die mit ihm nicht mehr in persönliche Berührung gekommen sind, sehen ihn gern in zeusähnlicher Gestalt mit einer modern geformten Ägis in der Hand. Ist er es doch gewesen, der so recht eigentlich dem furchtbaren Schildschütterer die Blitze aus der Hand genommen. Sein Schaffen erst hat dem Menschen die Kraft und die Fähigkeit gegeben, den elektrischen Funken sicher einzufangen, ihn zu meistern und weithin zucken zu lassen. Was vor ihm war, erscheint uns heute als dilettantisches Spiel mit der Elektrizität, durch sein Wirken erst wurde die weltfüllende Kraft wirklich in den Dienst des Menschen gezwungen, der Blitz aus den Wolken den Sterblichen als Werkzeug beigesellt.
Den Grundbau der modernen Elektrotechnik haben wir aus Werner Siemens' Händen empfangen. Es ist ein Ganzes, das die Menschheit ihm verdankt, nicht blendende Teile, die erst von anderen einem Ganzen angefügt werden mußten. Zwar war auch Werner Siemens ein großer Erfinder, aber ihn kennzeichnet nicht eine Fülle genialer »Einfälle«; sondern ein langsames, stetiges Weiterführen dessen, was er als noch nicht vollkommen erkannt hatte, ließ ihn ein Lebenswerk von seltener Geschlossenheit aufrichten. Niemals findet man bei ihm, von einer kurzen Jugendperiode abgesehen, ein Herumirren der Gedanken auf krausen Wegen; den Zufallserfolg hat er stets verschmäht. Wie auf einem Gleis ward sein Streben und Forschen stets zwangläufig geführt, und diese ihm von seiner Natur gewiesene feste Bahn, auf der er in stets gleicher Richtung, aber zu den höchsten Zielen vorwärts eilen mußte, hieß Wissenschaft.
Er schöpfte bei seiner Arbeit stets aus der Tiefe wissenschaftlicher Erkenntnis, und dieses stark gegründete Fundament des Siemensschen Schaffens bringt es mit sich, daß in der Reihe der erlauchten Namen, die in die Ehrentafel der Technik eingegraben sind, der seinige eine besondere Stellung einnimmt.
Man nennt Montgolfier den Erfinder des Luftballons, Franklin den Erfinder des Blitzableiters, Philipp Reis den Erfinder des Telephons, aber Werner Siemens lebt nicht fort als der Urheber einer bestimmten Erfindung, sondern man bezeichnet ihn als den Mann, der das elektrische Zeitalter, unser Zeitalter, heraufgeführt hat.
Auch von anderen Namen aus dem Reich der Technik strahlt ein blendendes Licht, aber die meisten gleichen doch punktförmigen Lichtquellen, bei deren Beobachtung man deutlich wahrnimmt, daß all die weit hinausgesandten Strahlen an einer einzigen Stelle entstehen. Siemens' Schaffen jedoch ist wie die Sonne, die aus leicht verhangenem Himmel niederstrahlt; auch sie verbreitet ein sehr starkes Licht, das aber weit verstreut ist, von überall her, aus sämtlichen Richtungen zu kommen scheint und ein ungeheures Gebiet erhellt. Warm, wohltuend und ganz gleichmäßig ist dieses Licht; nur wenn man ganz scharf beobachtet, sieht man einen besonders kräftig erhellten Abschnitt. Hier ist der Ort am Firmament des Siemensschen Schaffens, von wo die Leuchtkraft seiner größten Tat, der Schöpfung der Dynamomaschine, niederstrahlt.
Daß die Wirksamkeit dieses Manns, die ihre Kraft aus der Tiefe der Wissenschaft heraufholte, zugleich so sehr sich in die Breite entwickeln, dem praktischen Leben von so bedeutendem Nutzen sein konnte, verdanken wir einer seltenen Mischung verschiedener Fähigkeiten in der Person von Werner Siemens.
Aus drei Farben stellt die heutige Drucktechnik jede mögliche Tönung her; aus drei Eigenschaften vermochte Siemens so viele und so mannigfaltige Leistungen herauszuentwickeln, daß sein Lebenswerk fast unübersehbar geworden ist.
In ihm vereinigten sich der Mann der Wissenschaft, der Techniker und der Kaufmann zu einem schillernden und doch einheitlichen Ganzen. Für den Apparat, den der Techniker als unzureichend und verbesserungsbedürftig erkannt hatte, entwickelte der Wissenschaftler die theoretische Grundlage, schuf er das Fundament, auf dem weitergebaut werden konnte; wurde im wissenschaftlichen Laboratorium eine neue Erkenntnis geboren, dann war der Ingenieur imstande, das Geisteserzeugnis mit einem Körper zu umschließen, der Knochen, Blut und Muskeln besaß, so daß es lebendig zu wirken vermochte. Der Kaufmann aber kannte die Wege, um den Gegenstand so auf den Markt zu bringen, daß er Käufer fand und Geld einbrachte, das nun wieder die Möglichkeit zu weiteren wissenschaftlichen Forschungen schuf. Auf diese Weise entstand ein Kreislauf, der zu immer Größerem führen mußte. Er stellte die vorausgenommene Anwendung des von Siemens später gefundenen dynamo-elektrischen Prinzips auf sein eigenes Leben dar, dieses Prinzips, nach dem der Induktor durch die Leitung die Polmagnete verstärkt und diese dann wieder rückwirkend den Induktor zu höheren Leistungen befähigen.
»Naturwissenschaftliche Forschung war meine erste, meine Jugendliebe … daneben habe ich freilich immer den Drang gefühlt, die naturwissenschaftlichen Errungenschaften dem praktischen Leben nutzbar zu machen,« so hat er von sich gesagt. »Dabei kann ich mir selbst das Zeugnis geben, daß es nicht Gewinnsucht war, die mich bewog, meine Arbeitskraft und mein Interesse in so ausgedehntem Maß technischen Unternehmungen zuzuwenden. In der Regel war es zunächst das wissenschaftlich-technische Interesse, das mich einer Aufgabe zuführte. Indessen will ich auch die mächtige Einwirkung nicht unterschätzen, welche der Erfolg und das ihm entspringende Bewußtsein, Nützliches zu schaffen und zugleich Tausenden von fleißigen Arbeitern dadurch ihr Brot zu geben, auf den Menschen ausübt.«
Diese mächtige Einwirkung trieb hier nun nicht zu Spekulationen, sondern eben zur wissenschaftlichen Forschung zurück in dem unbewußten Drang, der das echte Genie stets auf den richtigen Weg lenkt.
Die Dreigestalt von Siemens' Persönlichkeit hat auch äußerlich zu eigenartigen Konstellationen geführt. Der praktisch schaffende Ingenieur wurde als ordentliches Mitglied in die preußische Akademie der Wissenschaften berufen, die doch, wie Du Bois-Reymond damals betonte, die Wissenschaft um ihrer selbst willen betreibt, und eben derselbe Mann hatte als Dr. phil. honoris causa einmal Gelegenheit, den Titel Kommerzienrat, den man ihm antrug, als nicht ganz zusagend abzulehnen.
Als Werner Siemens nach Berlin kam, um seine Laufbahn zu beginnen, war die erste Eisenbahn in Deutschland noch nicht eröffnet; eine Technik in unserem heutigen Sinn gab es überhaupt nicht. Faraday hatte gerade erst seine Untersuchungen über die Magnetinduktion bekannt gegeben, die in der Folge die theoretische Grundlage für den Bau sämtlicher elektrischer Maschinen geworden sind; an eine Elektrotechnik war also überhaupt noch nicht zu denken. Das Wort Elektrotechnik selbst ist erst viel später bei der unter Siemens' Mitwirkung erfolgten Begründung des Elektrotechnischen Vereins geschaffen worden.
Der junge Mann selbst kam vom Land, aus den engen Verhältnissen einer ärmlichen, kinderreichen Familie. Er war ohne Mittel und ohne besondere Schulbildung. Er hatte auch nicht das Glück, nun gleich systematische Studien beginnen zu können, sondern sah sich gezwungen, die Laufbahn eines Artillerieoffiziers einzuschlagen. Viele, viele Jahre lang konnte er an nichts anderes denken als nur daran, wie er sich die Mittel zu seinem kargen Lebensunterhalt verschaffte.
Und doch! Das Wunderbare geschah, das Unbegreifliche trat auch hier wieder ein, dem wir immer begegnen, wenn die geheimnisvoll über uns gebietende Macht jemanden dazu ausersehen hat, ihr Werkzeug bei der Fortentwicklung des Menschengeschlechts zu werden.
Das in den freien Luftraum geworfene und am Wachstum behinderte Samenkorn keimte dennoch, ward groß und stark, schöpfte seine Kraft aus unbekannten Regionen, in die nur die Wurzeln des Genies den Eingang finden, entfaltete sich als ein Baum, der köstliche Früchte trug und seine breitästige Krone auf kerngesundem, knorrigem Stamm weit ausbreitete.
Als Werner Siemens die Augen schloß, da war mit seiner Hilfe, durch seine Forschungen und Erfindungen das Reich des elektrischen Schwachstroms prachtvoll errichtet und gefestigt. Die Elektrizität war als Übermittlungswerkzeug des menschlichen Gedankens unentbehrlich geworden, sie schloß Erdteile zusammen und überbrückte die Weltmeere. Schon damals waren die Drähte die Harfensaiten, auf denen das brausende Lied der menschlichen Kultur gespielt wurde. Die Starkstromtechnik hatte den festen Unterbau erhalten, auf dem sie sich bald zu ihrer heutigen umfassenden Bedeutung entwickeln sollte. Siemens selbst, der mit der Dynamomaschine der Menschheit das Mittel zu ungeahnter Beherrschung und Dienstbarmachung der Naturkräfte in die Hand gegeben hatte, konnte auch hier noch die erste Entwicklungsstufe selbst leiten und geistig begleiten, bis mit seinem zunehmenden Alter ein anderer Führer wurde: Emil Rathenau.
Der Sohn des armen Landwirts hinterließ ein Vermögen, das eine sehr stattliche Zahl von Millionen umfaßte. Die von ihm begründete und geleitete Industriefirma war eine der angesehensten und bedeutendsten in Deutschland geworden; er hat ihren Namen für immer mit der Geschichte der Technik verbunden. Was an Ehrungen einem Gelehrten, einem Erfinder, einem Industriellen zuteil werden kann, ist ihm in reichster Fülle zugeflossen.
Er verdiente diese Auszeichnungen um so mehr, als er neben seinen großen Taten auf ureigenstem Gebiet dem Gedeihen des Staats zeitlebens eine lebhafte und tatkräftige Aufmerksamkeit zugewendet hat. In die preußische Politik hat er ratend und rettend eingegriffen. Ein starkes soziales Pflichtgefühl trieb ihn schon zu einer Zeit, als man diesen Einrichtungen in industriellen Kreisen noch recht bedenklich gegenüberstand, dazu, für die Angestellten und Arbeiter seiner Firma eine Invaliditätskasse und Altersversorgungseinrichtung zu schaffen. Er fand nicht Ruhe, bis es ihm gelungen war, der erfinderischen Tätigkeit in Deutschland einen gesunden Boden zu schaffen. Werner Siemens ist als der Vater unserer Patentgesetzgebung anzusehen. Durch die Errichtung der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt, deren Gründung er geistig vorbereitete und durch reiche finanzielle Beihilfe ermöglichte, ließ er das erste Institut in Deutschland entstehen, das ausschließlich der wissenschaftlichen Forschung gewidmet ist.
Sein universeller Geist trieb ihn auch unablässig, über naturwissenschaftliche Fragen nachzusinnen, die abseits der Technik lagen. Wenn man seine Arbeiten über solche Themen durchblättert und zugleich die Fülle der wissenschaftlichen Aufsätze wahrnimmt, die er über technische Probleme geschrieben hat, so wird man mit Staunen erfüllt über die geistige Kapazität dieses Manns, der schließlich zu wissenschaftlicher Tätigkeit doch nur in den kargen Mußestunden Zeit hatte, die ihm seine weitest ausgebreitete industrielle Wirksamkeit ließ.
Man sollte meinen, daß in dem Leben eines solchen Manns kein Raum zu dem geblieben wäre, was man im landläufigen Sinn »Erlebnis« nennt. Doch da sehen wir wieder, wie das Genie den Fassungsraum des Jahrs und der Stunde zu weiten vermag, so daß sie für ihn ein Mehrfaches der Sekundenzahl zu enthalten scheinen, die der gewöhnliche Mensch abzählt. Werner Siemens' Erdenwallen ist erfüllt von romantischen Begebenheiten, von Abenteuern könnte man sagen, wie sie in solcher Zahl nur wenigen begegnen.
Fortwährend erlebt er Außerordentliches. Das Plötzliche, das seinen Erfindungsideen fremd ist, tritt im Gang seines Lebens fortwährend auf. Unerwartete Ereignisse werfen ihn häufig in andere Richtung, als er gerade einzuschlagen beabsichtigt. Dreimal verursacht er schwere Explosionen, er erobert eine Festung, kämpft mit Beduinen auf der Spitze einer Pyramide, wird durch einen Schiffbruch auf eine unbewohnte Insel gebannt, eine lose gewordene Kabeltrommel droht sein Schiff zu zerschmettern, das Meer strömt mit furchtbarem Wüten in seltsamer Weise gegen ihn an. Und – was das erstaunlichste ist – in all diesem Getümmel oft schwerer Gefahren bleibt er jeden Augenblick der ruhige, sorgsam beobachtende Mann der Wissenschaft. Ein Ausbruch des Vesuv läßt in ihm Gedanken über die Beschaffenheit des Erdinnern erwachsen, er treibt Navigation während des Schiffbruchs und Meeresforschung inmitten der Wasserhose.
Auch der Kreis der Familie, aus dem er hervorging, zeigt uns ein ungewöhnliches Bild. Unter den zahlreichen Kindern, die Werner Siemens' Eltern hinterließen, ist er nicht das einzige gewesen, das als schaffender Mensch Bedeutung erlangte. Zeitlebens war er auf seinem Höhenpfad aufs engste mit drei Brüdern verbunden, von denen jeder in seinem Gebiet Großes geschaffen hat. Wilhelm, Friedrich und Karl Siemens umgeben als ein leuchtendes Dreigestirn die Zentralsonne Werner. In ihren jungen Jahren waren sie alle seine Helfer, und auch später haben sie häufig in seinem Interessenkreis gearbeitet. Aber die wissenschaftlich-technischen Schöpfungen Wilhelms und Friedrichs, die außerordentliche organisatorische Begabung Karls würden auch ohne den großen Bruder es jedem von den Dreien ermöglicht haben, den Namen Siemens bekannt und bedeutsam zu machen.
Die Mitwelt hat die vier Männer mit gleichem Namen gewissermaßen individuell angesiedelt, um sie leichter unterscheiden zu können. Werner war natürlich der »Berliner Siemens«, Wilhelm (William), der während des größten Teils seines Lebens in England wirkte und dort als hochberühmter und verehrter Mann starb, der Schöpfer des nach ihm benannten, auf der ganzen Erde angewendeten Stahlbereitungsverfahrens, hieß der »Londoner Siemens«. Friedrich, der Erfinder des Regenerativofens und verdiente Förderer der Glasindustrie, wurde der »Dresdener Siemens« genannt. Karl endlich, der lange Zeit in Petersburg und im Kaukasus gewirkt hat, war als der »Russische Siemens« bekannt.
Nachzuforschen, wie die gemeinsame Quelle gestaltet war, aus der diese vier prächtigen Ströme entsprangen, ist gewiß eine lohnende Aufgabe. Ihr wollen wir uns zunächst zuwenden, um dann zu beobachten, wie der größte und mächtigste von ihnen in seinem Lauf sich um sperrende Krümmungen windet, über Hindernisse brausend hinwegschießt, Arme aussendet, die sich später wieder mit dem Hauptlauf vereinigen, wie aus dem schmalen Wasser allmählich ein breiter Strom wird, der endlich ruhig und gelassen ins unendliche Meer des Weltruhms und der Unsterblichkeit ausmündet.
Voreltern und Elternhaus
Die Ahnenreihe der Siemens schließt sich zu einer Familie von bestem Bürgeradel zusammen. Der Stammbaum läßt sich bis zum Jahre 1523 zurückverfolgen. Da wird in der Bürgerrolle der Stadt Goslar ein Petrowin Siemens als Mitglied der Krämergilde und Hauseigentümer genannt. Seine Nachkommen sind Ratsherren und Stadthauptleute in Goslar. Noch heute steht dort ein altes schönes Haus mit geschnitztem Gebälk und Butzenscheiben, das einer der Siemensschen Ahnen errichtet hat; in ihm werden jetzt noch in gewissen Abständen Zusammenkünfte der Siemens abgehalten. Es bestand in der Familie von jeher ein in Bürgerkreisen seltenes Zusammengehörigkeitsgefühl, das bis zum heutigen Tag sorgsam gepflegt wird.
Werner Siemens erwähnt in seinen »Lebenserinnerungen« eine alte, höchst romantische Familienlegende, die er als geschichtlich nicht erwiesen bezeichnet. Indessen ist durch die Forschungen von Stephan Kekulé von Stradonitz festgestellt worden, daß die Erzählung wirklich einen Urahnen des Hauses betrifft und zwar eine Stammutter des Geschlechts. Der Historiograph hat darüber in den »Grenzboten« berichtet:
»Von 1618 bis 1648 wütete in Deutschland der Dreißigjährige Krieg: ein Menschenalter von Blut, Mord und Brand, gänzlicher Vernichtung der beweglichen, Zerstörung der unbeweglichen Habe, eine Zeit geistigen und materiellen Verderbens der Nation.
»Vor den Kriegsgreueln war Anna Maria Crevet, die am 4. März 1611 zu Lippstadt geborene bildschöne, schwarzlockige Tochter eines Barbiers mit Namen Gerhard Crevet und seiner ehrsamen Hausfrau Anna Gallenkamm, zu ihrem Vetter Jobs Bruckmann, einem vornehmen Kaufmann, nach Magdeburg geflohen, um in dessen Haus eine sichere Zufluchtsstätte zu finden.
»Im Frühjahr des Jahres 1631 kam es zur Belagerung der Stadt, am 10. Mai alten, 20. Mai neuen Stils zu jener furchtbaren Plünderung, die alles, was bisher im großen Krieg an Scheußlichkeiten verübt worden war, in den Schatten stellte.
»Im Heer der Belagerer diente damals ein Soldat mit Namen Hans Volkmar, geboren am 24. November 1607 zu Hollenstedt an der Leine in der heutigen Provinz Hannover. Einer der eifrigsten bei der Plünderung, drang er mit einer Anzahl Spießgesellen in das Bruckmannsche Haus. Dieses wurde von unten bis oben durchsucht, und so gelangten die Plünderer auch auf den Heuboden, wo ein großer Heuhaufen ihre Aufmerksamkeit anzog, weil erfahrungsgemäß die Einwohner der Häuser derartige Verstecke zu benutzen pflegten, um Wertvolles darin zu bergen.
»Eifrig stocherte Hans Volkmar mit seinem Mordgewehr im Heuhaufen. Da! Ein dumpfer Schrei, Geraschel. Er wühlt weiter. Da stürzt sich aus dem Heuhaufen ihm zu Füßen, seine Knie umklammernd, ein schönes junges Weib, notdürftig gekleidet, zum Tod erschrocken, aus einer frischen Wunde an der Lende blutend, und fleht mit heißem Ringen ums Leben. Einen Augenblick steht er erstarrt, dann stürzt er sich auf sie, reißt sie hoch, wehrt mit wildem Ruf die Gefährten zurück und eilt mit seiner süßen Beute ins Lager, alle Schätze vergessend.
»Vier Tage nachher, am 14. Mai alten, 24. Mai neuen Stils, wurde das Paar durch einen Feldprediger im Lager getraut.
»Hans Volkmar diente noch eine Zeitlang als Soldat, später ließ er sich in der alten Kaiserstadt Goslar am Harz nieder. Dort erwarb er 1650 das Bürgerrecht, wurde 1652 Achtsmann, 1660 Stadthauptmann und ist am 28. Mai 1678 im 71. Lebensjahr, nachdem er mit seiner bei der Belagerung Magdeburgs gewonnenen Ehefrau 47 Jahre im glücklichsten Ehestand gelebt hatte, gestorben. Seine Witwe überlebte ihn noch lange. Sie starb erst im Jahre 1696 im 85. Jahr ihres Lebens, nachdem sie von 11 Kindern Mutter, von 31 Enkeln Großmutter, von 30 Urenkeln Urgroßmutter geworden war.«
Die älteste Tochter dieser Anna Maria Crevet-Volkmar, namens Anna, die am 1. August 1636 geboren wurde, heiratete einen Hans Siemens, Stadthauptmann und Achtsmann zu Goslar. Sie brachte in das Geschlecht der Siemens eine Eigentümlichkeit hinein, die es bis heute bewahrt hat, nämlich den Kinderreichtum. Kommen doch in einzelnen Fällen 13, 14 und 15 Kinder eines Ehepaars vor. Das Geschlecht ist noch heute sehr ausgebreitet. An einem Familientag waren nicht weniger als 63 Vertreter des Geschlechts versammelt. Augenblicklich zählt die Familie 38 Mitglieder.
Vom Anfang des achtzehnten Jahrhunderts ab bis auf den Vater der vier berühmten Brüder sind die Ahnen der Siemens meist Landwirte gewesen. Aber das Interesse für mechanisch-technische Dinge und die Erfinderbegabung treten doch mit jenen nicht zum erstenmal in diesem Geschlecht auf.
Schon ein Großonkel der Brüder beschäftigte sich in seinen Mußestunden viel mit optischen Instrumenten und fertigte gern Mikroskope und Fernrohre als Geschenke für seine Verwandten an. Der Onkel Ernst Franz Siemens, der 1780 in Lutter am Barenberg geboren wurde, hat das Sieden und Zerkleinern der Kartoffel bei hoher Temperatur und die Anwendung des Wasserdampfs zur Destillation in die Brennerei eingeführt. Sein Sohn Karl Georg errichtete in Braunschweig die erste große Zuckerfabrik mit Dampfeinrichtung und war Professor der technischen Werkstatt an der Hochschule zu Hohenheim. Ein anderer Sohn, Adolf Siemens, der Offizier bei der Hannoverschen Artillerie war, erfand eine Verbesserung der Schrapnelleinrichtung und einen elektrischen Apparat zum Entfernungsmessen für Geschütze. So ist es also nicht etwas Neues, sondern nur eine freilich rasche und großartige Weiterentwicklung, wenn Werner Siemens den Ruhm des Familiennamens über die ganze Erde trug.
Er wurde am 13. Dezember 1816 als der Sohn des Landwirts Christian Ferdinand Siemens und seiner Gattin Eleonore, der Tochter des Amtsrats Deichmann in Poggenhagen, zu Lenthe bei Hannover geboren. Die Eltern hatten 14 Kinder, nämlich 11 Söhne und 3 Töchter. Das älteste Kind war Ludwig, von dem wir nichts näheres wissen, da er verschollen und ohne Kinder gestorben ist. Mathilde, die geliebte Schwester von Werner, war das zweite Kind. Dann folgte ein Sohn Werner, der kurz nach der Geburt gestorben ist. Unser großer Ernst Werner Siemens war das vierte Kind seiner Eltern, Wilhelm das achte, Friedrich das neunte und Karl das zehnte.
Das Obergut Lenthe, auf dem die Eltern lebten, liegt an einem bewaldeten Bergrücken, der vom Deistergebirge abfällt. Es gehörte zu der damaligen Königlich Großbritannischen Provinz Hannover, deren staatliche Organisation noch fast mittelalterlich war. Der Vater wagte es einstmals, ein Rudel der Hirsche einzusperren, die in großer Zahl die Saaten auf schlimmste Weise verwüsteten, aber von niemand angegriffen werden durften. Sofort wurde vom Oberhofjägeramt in Hannover eine Untersuchung gegen ihn eingeleitet, und der Vater hatte es nur einem Glückszufall zu verdanken, daß er mit einer schweren Geldstrafe davonkam. Dieses Erlebnis gab ihm Anlaß, ein Land mit freieren Zuständen aufzusuchen, und er pachtete die Domäne Menzendorf im Fürstentum Ratzeburg, das zu – Mecklenburg gehörte. Dort hat Werner glückliche Jugendjahre verlebt. Die ökonomischen Verhältnisse im Elternhaus waren freilich recht trübselig; die Domäne warf nur einen geringen Gewinn ab, viel zu wenig, um eine so zahlreiche Familie zu ernähren.
Bis zu seinem elften Lebensjahr unterrichtete Großmutter Deichmann – geborene von Scheiter, wie sie nie ihrer Unterschrift beizufügen vergaß – ihren Enkelsohn, und auch der Vater erteilte einige Unterrichtsstunden. Dann wurde die einfache Bürgerschule des eine Stunde weit entfernten Städtchens Schöneberg bezogen. Die wissenschaftlichen Resultate dort waren, wie Werner Siemens selbst feststellt, recht mäßig.
Im Jahre 1828 berief der Vater für seine Kinder einen Hauslehrer, den Kandidaten der Theologie Sponholz, der Ausgezeichnetes geleistet haben muß, da Werner seiner noch in hohem Alter mit lebhafter Dankbarkeit gedachte. Leider machte Sponholz nach einigen Jahren seinem Leben durch Selbstmord ein Ende, und nun kam ein trockener Pedant als Lehrer ins Haus, der vieles verdarb, was die Kinder vorher schon in sich aufgenommen hatten.
Als auch dieser Mann im Siemensschen Haus gestorben war, wurde Werner endlich einem systematischen Unterricht zugeführt, indem man ihn auf die Katharinenschule, ein Gymnasium zu Lübeck, sandte. Bei der Prüfung erwies er sich als reif für die Aufnahme in Obertertia. Es hat ihm viel Verdruß bereitet, daß auf diesem Gymnasium ein fast ausschließlicher Wert auf das Erlernen der alten Sprachen gelegt wurde. Für diese hatte er gar kein Interesse, da es bei den grammatischen Regeln »nichts zu denken und nichts zu erkennen gab«. Fast gar nicht gepflegt wurde die Mathematik, für die der junge Werner eine starke Begeisterung fühlte, und in der er auch schon viel wußte, obgleich seine beiden Hauslehrer gar nichts davon verstanden hatten. Nur aus einem inneren Drang heraus hatte er sich so lebhaft mit dieser Wissenschaft beschäftigt, daß er auf dem Gymnasium in dieser Disziplin sogleich eine höhere Klasse besuchen durfte. Schon in der Sekunda ließ er das Studium des Griechischen vollständig fallen und nahm statt dessen Privatstunden in Mathematik und Feldmessen, um sich für das Baufach vorzubereiten, das einzige technische Fach, das es damals gab.
Sein glühender Wunsch war, an der Bauakademie in Berlin studieren zu dürfen. Aber die sehr geringen Mittel des Vaters erlaubten ihm das nicht. Sein Lehrer im Feldmessen, der Leutnant im Lübecker Kontingent Freiherr von Bülzinglöwen, der früher bei der preußischen Artillerie gedient hatte, empfahl ihm, beim preußischen Ingenieurkorps einzutreten, wo er mit Aufwendung geringer Summen dasselbe lernen könnte wie auf der Bauakademie. Das schien Werner hoffnungsreich zu sein, und um Ostern 1834, in seinem siebzehnten Lebensjahr, nahm er Abschied vom Elternhaus, um nach der preußischen Hauptstadt überzusiedeln.
Wir wissen nicht, mit welchen Gefühlen die Eltern, damals wohl schon kränklich und von schweren Sorgen niedergedrückt, ihren Sohn haben fortziehen lassen. Sie mögen ihn als einen Jüngling betrachtet haben, der mit etwas exzentrischen Ideen aus der Art schlug, da er durchaus nicht in dem hergebrachten Kreis der Landwirte bleiben wollte. Niemand konnte gewiß ahnen, daß die als Kuriosität betrachtete Vorliebe für die Mathematik so hohe Bedeutung für das ganze Geschlecht gewinnen sollte.